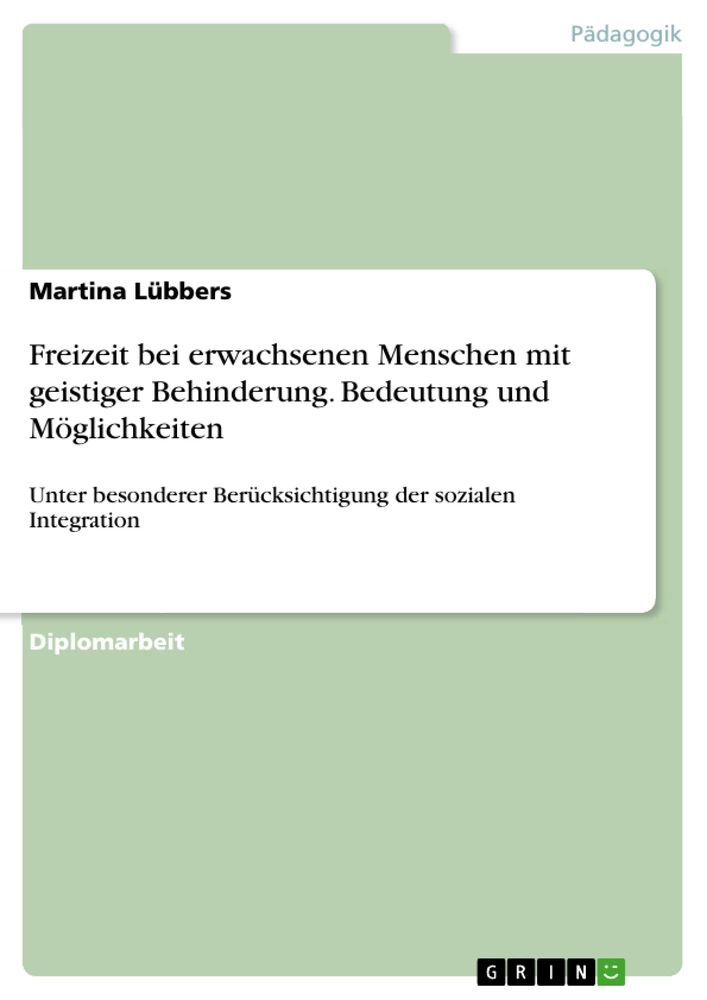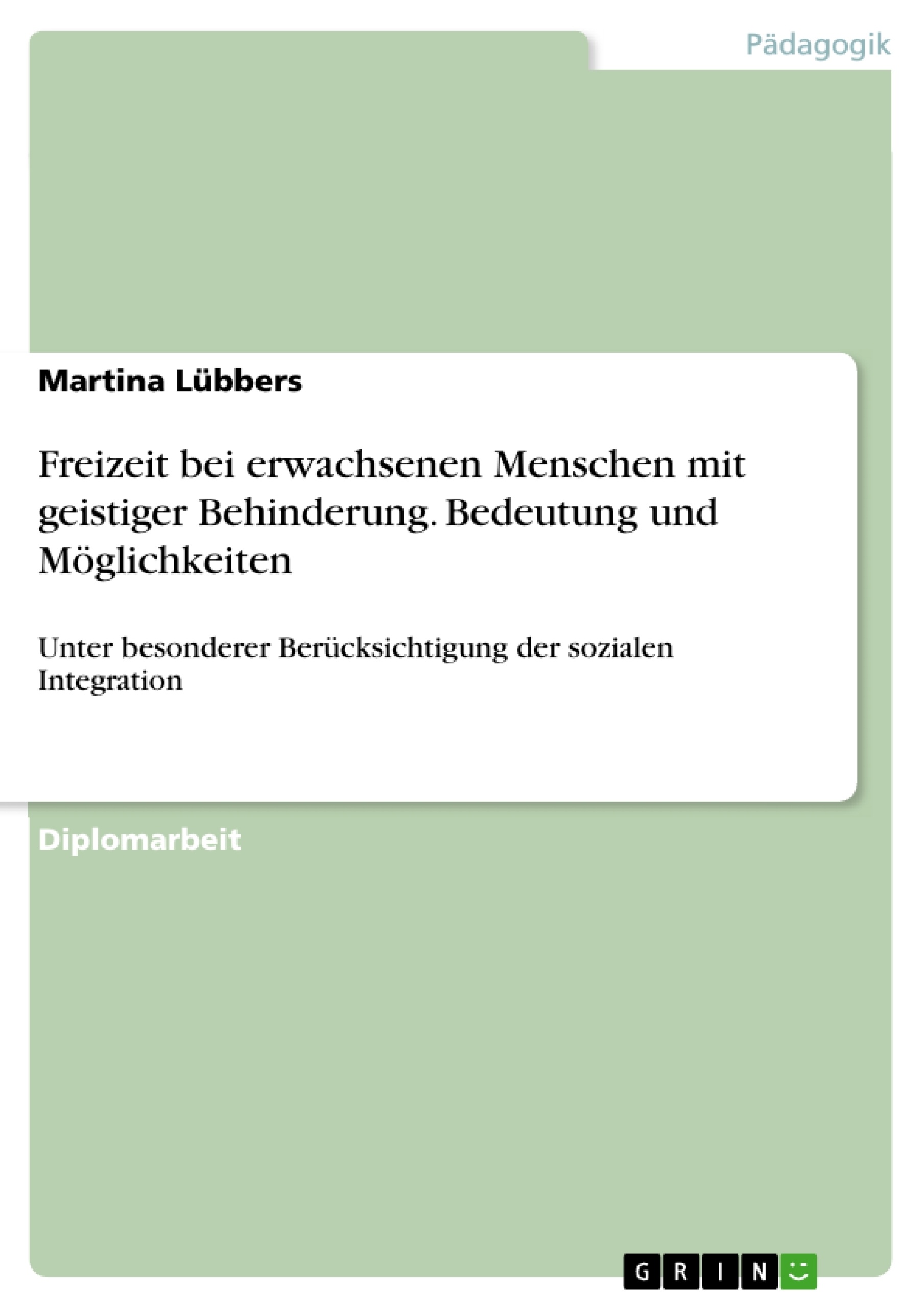Gegenstand dieser Arbeit ist die Freizeitsituation von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Fragestellungen, inwieweit der Freizeitbereich zur sozialen Integration dieser Menschen beitragen kann, wie die pädagogische Leitidee der Normalisierung umgesetzt wird und ob die Forderung nach Selbstbestimmung im Freizeitbereich erfüllt wird.
Mein besonderes Interesse an der Freizeitsituation von Menschen mit geistiger Behinderung entwickelte sich zum einen durch meine praktische Tätigkeit beim Familienunterstützenden Dienst (FuD) der Lebenshilfe Gießen, zum anderen durch die vielfältigen Anregungen die ich in dem Seminar „Freizeitförderung bei Menschen mit geistiger Behinderung“ von Herrn Ulrich Niehoff-Dittmann am Institut für Heil- und Sonderpädagogik der Justus-Liebig-Universität Gießen im Wintersemester 2004/05 erhalten habe. Schon während meiner praktischen Tätigkeit für den FuD fiel mir immer wieder auf, dass die Freizeit von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung von anderen Personen verplant wird und ihre Sozialkontakte, abgesehen von denen zu ihrer Familie und zu professionellen Begleitern, fast ausschließlich aus Kontakten zu anderen Menschen mit geistiger Behinderung bestehen. In dem erwähnten Seminar wurden dann die theoretischen Bezüge zu Leitgedanken der Behindertenpädagogik hergestellt. Augenfällig wurde dabei, dass die Freizeit, im Gegensatz zu den Bereichen Wohnen und Arbeit, ein bislang stark vernachlässigter Lebensbereich in der Behindertenpädagogik ist.
Vor diesem Hintergrund werde ich untersuchen, welche Möglichkeiten zur Verbesserung der Freizeitsituation von Menschen mit geistiger Behinderung bestehen und wie dabei die bereits oben genannten Ziele der Integration, Normalisierung und Selbstbestimmmung erreicht werden können.
Da der Bereich Selbstbestimmung ein zentraler Aspekt dieser Arbeit ist, werde ich mich thematisch auf die Freizeitsituation von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung beschränken. Ich gehe davon aus, dass das Konzept der Selbstbestimmung auch bei Menschen ohne Behinderung erst im Erwachsenenalter voll zur Anwendung kommt. Ferner unterscheiden sich die Freizeitsituationen von Kindern und Erwachsenen grundlegend. Eine Darstellung beider Situationen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Lebenssituation von Menschen mit geistiger Behinderung
- 2.1 Definitionsproblematik des Begriffs »geistige Behinderung«
- 2.2 Behindertenpolitische und -rechtliche Rahmenbedingungen
- 2.3 Einstellungen gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung und Möglichkeiten zu ihrer Veränderung
- 2.4 Historische Entwicklungen der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung in Westdeutschland seit 1945
- 2.5 Zusammenfassung
- 3. Soziale Integration, Teilhabe und Inklusion: Leitideen und Konzepte zu ihrer praktischen Umsetzung
- 3.1 Soziale Integration, Teilhabe und Inklusion
- 3.2 Wurzeln des inklusiven Gedankens
- 3.2.1 Normalisierungsprinzip
- 3.2.2 Selbstbestimmung
- 3.3 Konzepte zur Umsetzung der Leitideen
- 3.3.1 Empowerment
- 3.3.2 Assistenz
- 3.3.3 Community Care
- 3.4 Zusammenfassung
- 4. Freizeit
- 4.1 Freizeit - Die Schwierigkeiten einer Begriffbestimmung
- 4.2 Der positive Freizeitbegriff
- 4.3 Freizeitbedürfnisse
- 4.4 Voraussetzungen an den Lebensbereich Freizeit
- 4.5 Freizeit in Deutschland
- 4.5.1 Beliebte Freizeittätigkeiten
- 4.5.2 Trends in der Freizeit
- 4.5.3 Einkommen und Bildung = Determinanten des Freizeitverhaltens?
- 4.6 Zusammenfassung
- 5. Freizeit im Leben von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung
- 5.1 Sonderpädagogische Auseinandersetzung mit dem Handlungsfeld Freizeit im Wandel der Zeit
- 5.1.1 Freizeit ohne besondere Hilfen
- 5.1.2 Freizeit als Aufgabengebiet der Rehabilitation
- 5.1.3 Freizeit und soziale Integration
- 5.1.4 Selbstbestimmte Freizeit
- 5.2 Freizeit als soziales und gesellschaftliches Integrationsfeld
- 5.3 Aktuelle Freizeitsituation von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung
- 5.3.1 Empirische Studien zur Freizeitsituation von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung
- 5.3.1.1 Freizeitsituation in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe
- 5.3.1.2 Freizeitsituation in Familien
- 5.3.1.3 Freizeitsituation in Einrichtungen der Lebenshilfe
- 5.3.2 Freizeitbedürfnisse
- 5.3.3 Erschwernisse
- 5.3.3.1 Erschwernisse aufgrund der Lebenssituation in der Familie
- 5.3.3.2 Erschwernisse aufgrund der Lebenssituation in Wohneinrichtungen
- 5.4 Ausblick und Forderungen
- 5.5 Zusammenfassung
- 6. Praxisbeispiele: Sozialintegrative Freizeitangebote
- 6.1 PFIFF
- 6.2 Orientalische Bauchtanzgruppe
- 6.3 Inklusionsbeauftragte für den Bereich Sport
- 7. Interpretation und Reflektion der Ergebnisse
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Freizeitsituation erwachsener Menschen mit geistiger Behinderung und deren Beitrag zur sozialen Integration. Ein Fokus liegt auf der Umsetzung pädagogischer Leitideen wie Normalisierung und Selbstbestimmung im Freizeitbereich. Die Arbeit analysiert die aktuelle Situation, zeigt Verbesserungsmöglichkeiten auf und beleuchtet relevante Konzepte.
- Definition und Bedeutung von Freizeit für Menschen mit geistiger Behinderung
- Soziale Integration und Inklusion im Freizeitkontext
- Umsetzung von Normalisierung und Selbstbestimmung im Freizeitbereich
- Analyse der aktuellen Freizeitsituation (Wohneinrichtungen, Familien, Lebenshilfe)
- Praxisbeispiele sozialintegrativer Freizeitangebote
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht die Freizeitsituation erwachsener Menschen mit geistiger Behinderung, insbesondere den Beitrag des Freizeitbereichs zur sozialen Integration und die Umsetzung der Leitideen Normalisierung und Selbstbestimmung. Die Autorin beschreibt ihre Motivation durch praktische Erfahrungen und ein relevantes Seminar. Es wird die Forschungsfrage nach Verbesserungsmöglichkeiten der Freizeitsituation und der Erreichung der genannten Ziele formuliert.
2. Lebenssituation von Menschen mit geistiger Behinderung: Dieses Kapitel beleuchtet die Lebenssituation von Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland. Es beginnt mit einer Auseinandersetzung mit der Definition von geistiger Behinderung, geht auf die rechtlichen Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Einstellungen ein und schließt mit einem historischen Überblick über die Arbeit mit dieser Personengruppe. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen und den rechtlichen Grundlagen der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
3. Soziale Integration, Teilhabe und Inklusion: Leitideen und Konzepte zu ihrer praktischen Umsetzung: Das Kapitel erläutert die Konzepte der sozialen Integration, Teilhabe und Inklusion und deren Bedeutung für Menschen mit geistiger Behinderung. Es werden die Wurzeln des inklusiven Gedankens im Normalisierungsprinzip und dem Selbstbestimmungsgedanken verortet. Weiterhin werden Konzepte wie Empowerment, Assistenz und Community Care als mögliche Wege zur Umsetzung einer normalisierten und selbstbestimmten Lebenssituation diskutiert. Das Kapitel stellt einen theoretischen Rahmen für die spätere Analyse der Freizeitsituation dar.
4. Freizeit: Dieses Kapitel widmet sich dem Begriff Freizeit und dessen Bedeutung im Leben des Menschen. Es werden verschiedene Freizeitbedürfnisse identifiziert und die Voraussetzungen für deren Erfüllung beschrieben. Abschließend wird die Freizeitsituation in Deutschland anhand von Aktivitäten, Trends und sozioökonomischen Determinanten dargestellt. Dieser Teil liefert eine allgemeine Grundlage für die spätere Betrachtung der spezifischen Freizeitsituation von Menschen mit geistiger Behinderung.
5. Freizeit im Leben von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung: Das Kapitel analysiert die Freizeitsituation erwachsener Menschen mit geistiger Behinderung. Es betrachtet die sonderpädagogische Auseinandersetzung mit dem Thema Freizeit im Wandel der Zeit, die Bedeutung von Freizeit als Integrationsfeld und die aktuelle Situation in verschiedenen Kontexten (Wohneinrichtungen, Familien, Lebenshilfe). Empirische Studien und die Untersuchung von Freizeitbedürfnissen sowie erschwerenden Faktoren bilden den Kern dieses Kapitels. Die Synthese der Ergebnisse aus verschiedenen Bereichen liefert ein umfassendes Bild der aktuellen Freizeitsituation.
6. Praxisbeispiele: Sozialintegrative Freizeitangebote: Dieses Kapitel präsentiert Beispiele für sozialintegrative Freizeitangebote, um die theoretischen Überlegungen zu konkretisieren und zu veranschaulichen. Die Beispiele zeigen Möglichkeiten der praktischen Umsetzung von inklusiven Freizeitaktivitäten auf.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, Soziale Integration, Inklusion, Freizeit, Normalisierung, Selbstbestimmung, Teilhabe, Empowerment, Assistenz, Community Care, Empirische Studien, Lebenshilfe, Rehabilitation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Freizeit und Soziale Integration Erwachsener Menschen mit Geistiger Behinderung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Freizeitsituation erwachsener Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland und ihren Beitrag zur sozialen Integration. Ein besonderer Fokus liegt auf der Umsetzung pädagogischer Leitideen wie Normalisierung und Selbstbestimmung im Freizeitbereich.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Bedeutung von Freizeit für Menschen mit geistiger Behinderung, soziale Integration und Inklusion im Freizeitkontext, Umsetzung von Normalisierung und Selbstbestimmung im Freizeitbereich, Analyse der aktuellen Freizeitsituation (Wohneinrichtungen, Familien, Lebenshilfe), sowie Praxisbeispiele sozialintegrativer Freizeitangebote. Die Arbeit beleuchtet auch die historische Entwicklung der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung und die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Lebenssituation von Menschen mit geistiger Behinderung, Soziale Integration, Teilhabe und Inklusion, Freizeit allgemein, Freizeit im Leben von Menschen mit geistiger Behinderung, Praxisbeispiele sozialintegrativer Freizeitangebote, Interpretation und Reflektion der Ergebnisse sowie ein Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit den jeweiligen Aspekten.
Welche Konzepte werden im Zusammenhang mit Inklusion und Teilhabe diskutiert?
Die Arbeit diskutiert wichtige Konzepte wie Normalisierung, Selbstbestimmung, Empowerment, Assistenz und Community Care als Wege zur Umsetzung einer inklusiven und selbstbestimmten Lebenssituation für Menschen mit geistiger Behinderung im Freizeitbereich.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine Literaturrecherche, die Analyse bestehender empirischer Studien zur Freizeitsituation von Menschen mit geistiger Behinderung in verschiedenen Kontexten (Wohneinrichtungen, Familien, Lebenshilfe) und die Präsentation von Praxisbeispielen für sozialintegrative Freizeitangebote.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der Arbeit bieten ein umfassendes Bild der aktuellen Freizeitsituation von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland. Sie analysieren Herausforderungen und zeigen Verbesserungsmöglichkeiten auf, um eine höhere soziale Integration und Selbstbestimmung im Freizeitbereich zu erreichen.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Arbeit richtet sich an Fachkräfte in der Behindertenhilfe, Pädagogen, Sozialarbeiter, Angehörige von Menschen mit geistiger Behinderung und alle, die sich mit dem Thema Inklusion und Teilhabe auseinandersetzen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Geistige Behinderung, Soziale Integration, Inklusion, Freizeit, Normalisierung, Selbstbestimmung, Teilhabe, Empowerment, Assistenz, Community Care, Empirische Studien, Lebenshilfe, Rehabilitation.
Wo finde ich Praxisbeispiele?
Kapitel 6 der Arbeit präsentiert konkrete Praxisbeispiele sozialintegrativer Freizeitangebote, wie z.B. das Projekt "PFIFF", eine orientalische Bauchtanzgruppe und die Arbeit einer Inklusionsbeauftragten im Sportbereich.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst und Handlungsempfehlungen für eine Verbesserung der Freizeitsituation von Menschen mit geistiger Behinderung ableitet.
- Arbeit zitieren
- Martina Lübbers (Autor:in), 2005, Freizeit bei erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung. Bedeutung und Möglichkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/71286