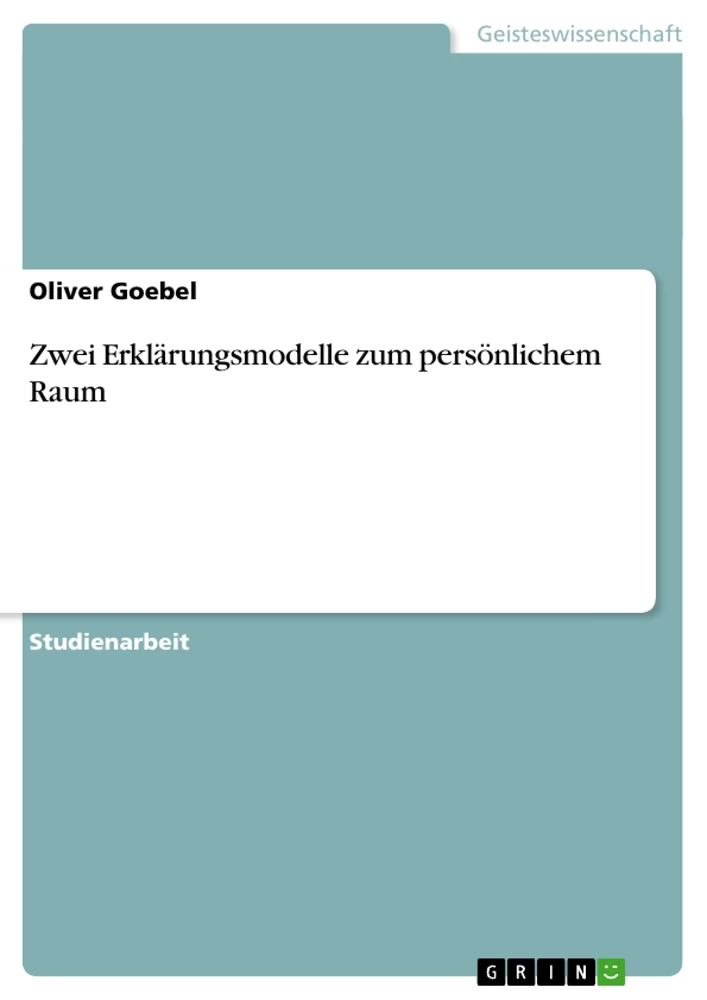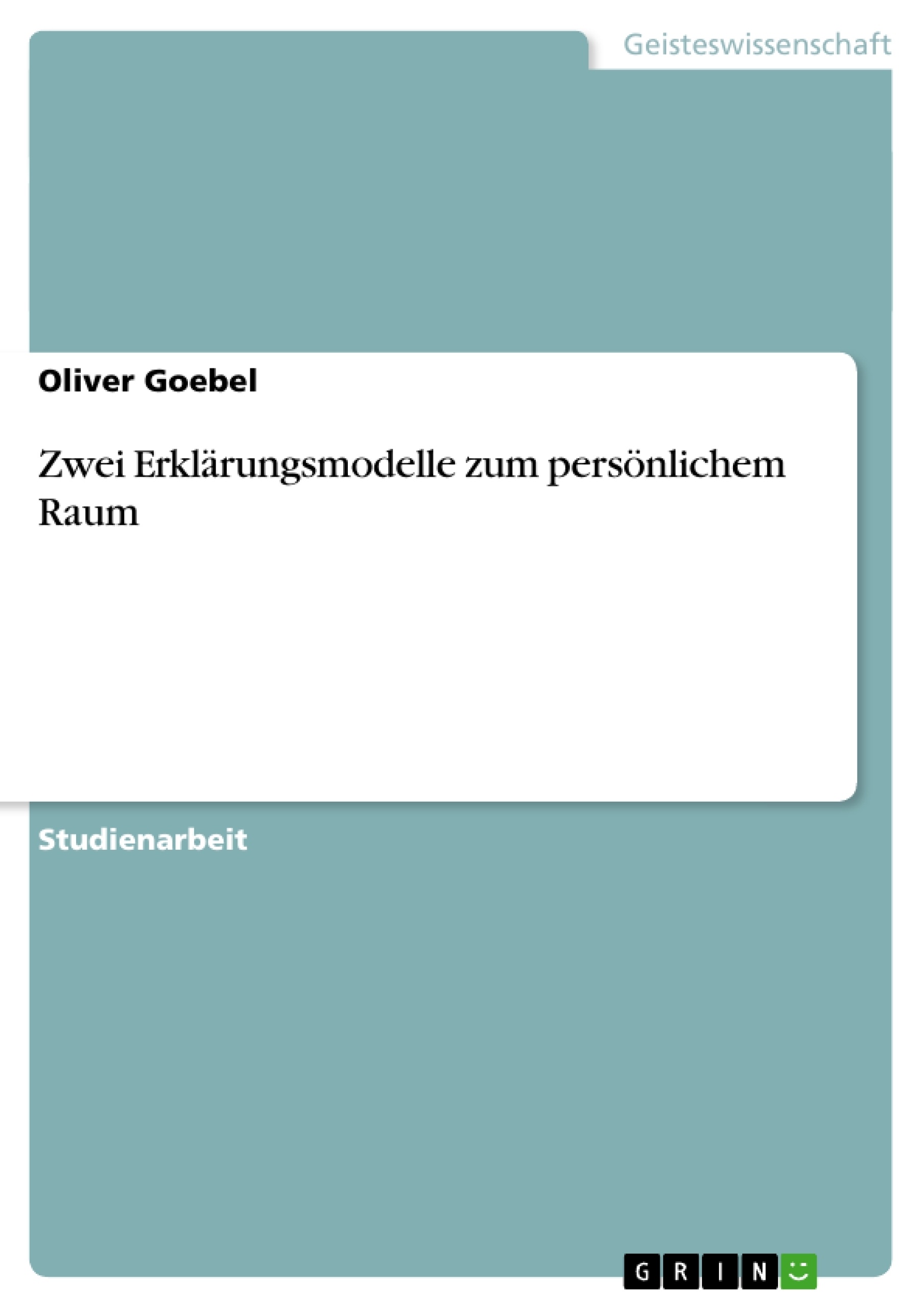Diese Arbeit behandelt räumliches Verhalten von Menschen in Interaktionen, also meßbare Distanzen, die Menschen zueinander einnehmen.
Die psychologische Forschung beschäftigte sich insbesondere in den 50er und 70er Jahren intensiv mit menschlichen Distanzverhalten (Salewski, 1993a, S. 12). Neben der Sozialpsychologie hat sich insbesondere die ökologische Psychologie dieses Thema zu eigen gemacht. Die ökologische Psychologie, die sich aus der Sozialpsychologie heraus entwickelte, befaßt sich mit Auswirkungen der physisch-materiellen und kulturellen Außenwelt sowie den räumlich-sozialen Einflußfaktoren auf das Erleben und Verhalten der Menschen (Hellbrück & Fischer, 1999, S. 28-29). Bezugnehmend auf räumliches Verhalten entwickelten sich neben dem Forschungsgebiet des persönlichen Raumes; die Bezeichnung „Distanzverhalten“ ist ebenfalls gebräuchlich (Hellbrück & Fischer, 1999, S. 321); weitere Disziplinen wie Privacy, Territorialverhalten und Crowding.
Im ersten Kapitel dieser Arbeit wird der Begriff „Persönlicher Raum“ erläutert und gegenüber den eben genannten Teildisziplinen räumlichen Verhaltens abgegrenzt.
Im zweiten Kapitel wird die Äquilibriumstheorie von Argyle und Dean (1965) ausführlich erörtert. Sie erhält ihre besondere Bedeutung dadurch, daß sie den Ausgangspunkt eines Gesamtkonzeptes darstellt, aus dem sich die weiteren Erklärungsansätze entwickelt haben (Salewski, 1993a, S. 6).
Im anschließenden dritten Kapitel wird das Erregungsmodell interpersonaler Intimität von Patterson (1976), welches als Modifikation der Äquilibriumstheorie angesehen werden kann, erörtert.
Im vierten und letzten Kapitel dieser Arbeit wird ein kurzer Blick auf den gegenwärtigen Stand der Forschung gewagt. An dieser Stelle wird versucht, die Frage zu beantworten, ob eine Theorie existiert, die das Phänomen persönlicher Raum erschöpfend erklären kann.
Inhaltsverzeichnis
- Inhalt der Arbeit
- 1. Das Phänomen persönlicher Raum
- 1.1 Zwei Beispiele räumlichen Verhaltens aus dem Alltag
- 1.2 Definitionen des Begriffes persönlicher Raum
- 1.3 Zusammenhang mit anderen ökopsychologischen Teilkonzepten
- 2. Die Äquilibriumstheorie von Argyle und Dean
- 2.1 Beschreibung der Äquilibriumstheorie
- 2.2 Empirische Überprüfung der Äquilibriumstheorie
- 2.3 Bewertung der Theorie
- 3. Pattersons Erregungsmodell interpersonaler Intimität
- 3.1 Grundannahmen des Erregungsmodells
- 3.2 Empirische Herleitung des Modells
- 3.3 Bewertung des Erregungsmodells
- 4. Der gegenwärtige Stand der Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert räumliches Verhalten von Menschen in Interaktionen, insbesondere die Distanzen, die Menschen zueinander einnehmen. Der Fokus liegt auf der Erforschung des „Persönlichen Raumes“ und der zwei dominanten Erklärungsmodelle: der Äquilibriumstheorie von Argyle und Dean sowie Pattersons Erregungsmodell interpersonaler Intimität.
- Definition und Abgrenzung des Konzepts „Persönlicher Raum“
- Analyse und Vergleich der Äquilibriumstheorie von Argyle und Dean
- Untersuchung des Erregungsmodells interpersonaler Intimität von Patterson
- Bewertung der beiden Modelle und Einordnung in den aktuellen Forschungsstand
- Diskussion der Frage nach einer umfassenden Theorie zum Phänomen des persönlichen Raumes
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich dem Begriff des „Persönlichen Raumes“ und grenzt diesen gegenüber anderen Teildisziplinen des räumlichen Verhaltens ab. Kapitel zwei stellt die Äquilibriumstheorie von Argyle und Dean vor, die den Ausgangspunkt für viele spätere Erklärungsansätze bildet. Es werden die zentralen Elemente der Theorie sowie empirische Befunde und deren Bewertung diskutiert. Im dritten Kapitel wird das Erregungsmodell interpersonaler Intimität von Patterson als Modifikation der Äquilibriumstheorie behandelt. Hier werden die Grundannahmen, empirische Herleitung und die Bewertung des Modells erörtert. Das vierte Kapitel bietet einen kurzen Einblick in den aktuellen Forschungsstand und stellt die Frage, ob es eine erschöpfende Theorie zum Phänomen des persönlichen Raumes gibt.
Schlüsselwörter
Persönlicher Raum, räumliches Verhalten, Distanzverhalten, Äquilibriumstheorie, Argyle und Dean, Erregungsmodell, Patterson, ökologische Psychologie, ökopsychologische Teilkonzepte.
- Quote paper
- Oliver Goebel (Author), 2001, Zwei Erklärungsmodelle zum persönlichem Raum, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/7089