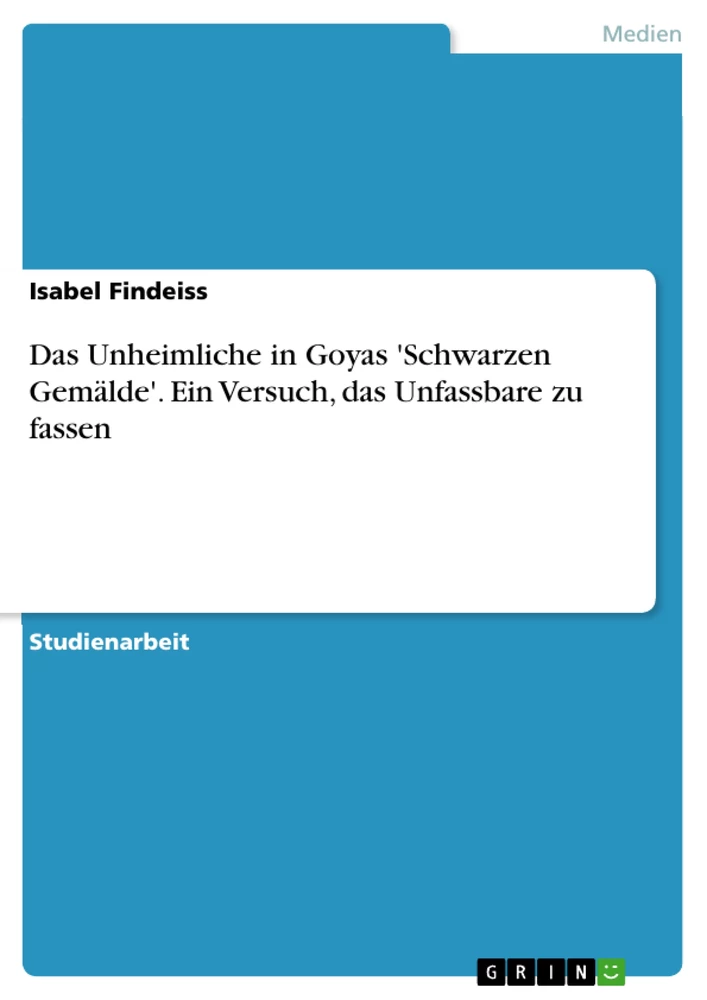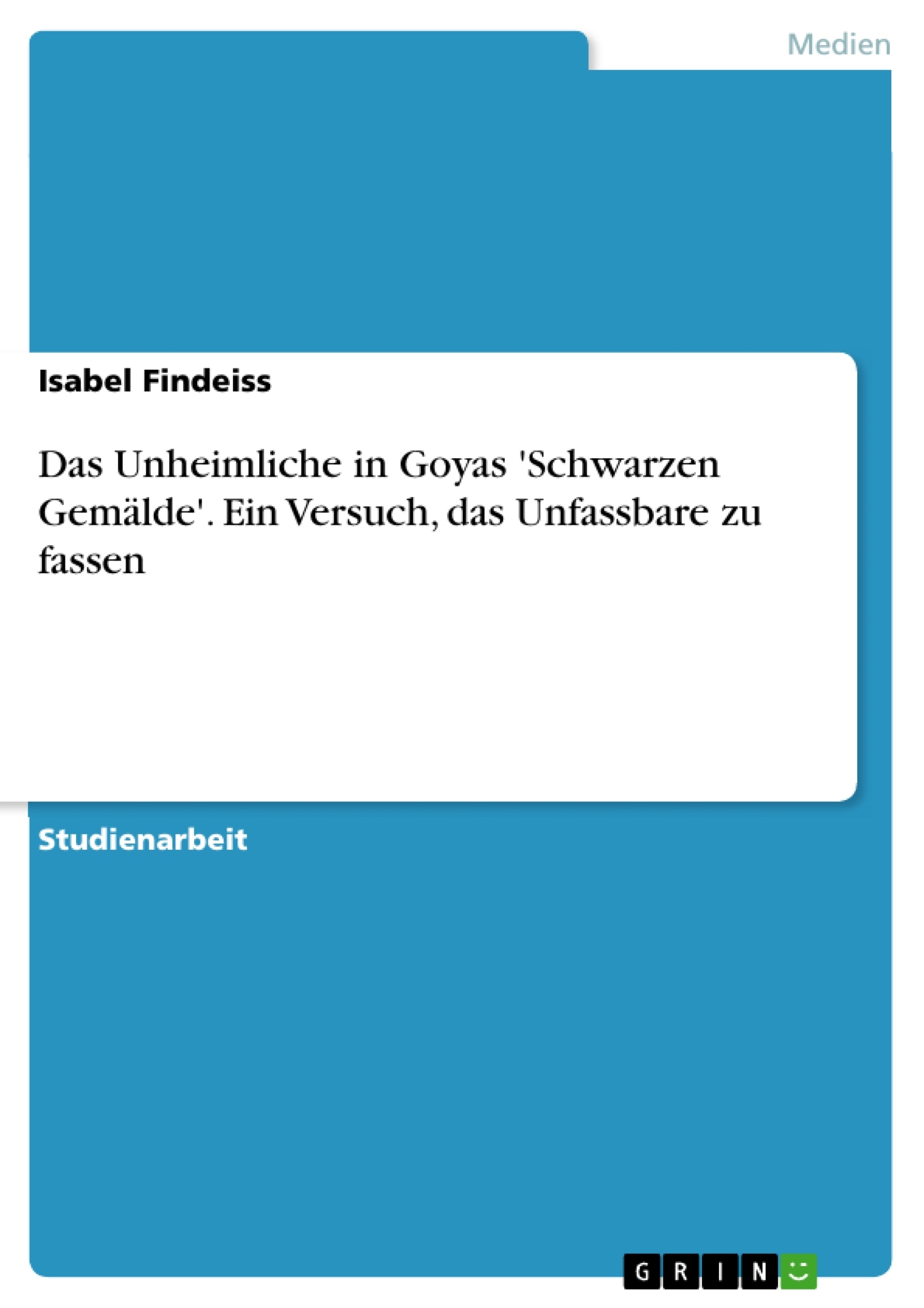Goyas „Schwarze Gemälde“ (im Original „Pinturas Negras“), die er um 1820 in Öl direkt auf die Wände seines Landhauses bei Madrid malt, gehören zu den außergewöhnlichsten und auch furchteinflößendsten Werken des spanischen Künstlers. Sie strahlen etwas unheimliches aus, das sich jedoch kaum greifen oder in Worte fassen lässt. Dem Betrachter fällt es sehr schwer, genau festzustellen, worin das Unheimliche in diesen Gemälden liegt. Ist es nur die Farbe bzw. die düstere Stimmung? Oder das Motiv? Vielleicht auch die Art der Darstellung? Dies sind Fragen, die sich wohl jeder vor den Pinturas Negras stellt und doch so schwer zu beantworten sind.
In dieser Arbeit soll versucht werden, Antworten auf diese Fragen zu finden. Der Ausgangspunkt ist der sozialgeschichtliche Hintergrund zur Zeit der Entstehung der Schwarzen Gemälde um 1820. Es soll kurz auf die Geschichte Spaniens eingegangen werden, die Umstände in Madrid und die allgemeine wirtschaftliche, gesellschaftliche und soziale Situation, wie sie sich Goya dargeboten hat. Weiter soll Goyas Leben in diesem Zeitraum (ca. 1818-1824) betrachtet werden, seine familiäre Situation sowie die Umstände des Kaufs und der Ausmalung des „Quinta del Sordo“, Haus des Tauben, genannten Landsitzes. Dabei wird auch auf die sogenannte„Krise der Kunst um 1800“ eingegangen, die sich besonders in Goyas Werken manifestiert. Indem er sich radikal von den bis dahin geltenden Normen der Bildgestaltung abwendet, ist es ihm möglich, eine neue Art von Kunst zu entwickeln, in der der Künstler als Individuum und die Themen aus seiner eigenen Wirklichkeit in den Mittelpunkt treten.
Danach sollen die Pinturas Negras innerhalb von Goyas gesamten Oeuvre kunsthistorisch verortet werden. Quasi als „Vorläufer“ zu den Schwarzen Gemälden wird das kurz zuvor entstandene „Selbstporträt mit Arrieta“ (1820) behandelt, das Goyas Auseinandersetzung mit seiner schweren Krankheit, die ihn 1819 befällt, zeigt. Nach der Einbettung der Pinturas Negras in den Gesamtkontext von Goyas Oeuvre soll weiter auf die motivischen Rückbezüge zu Werken aus seiner Frühzeit eingegangen werden. In der Art eines Selbstzitats verwendet Goya hier Bildmotive, die er früher schon einmal, beispielsweise in den Teppichkartons oder den Gemälden für die Familie Osuna, verwendet hat, jetzt jedoch auf groteske Weise verfremdet und dem Betrachter damit vollends verunsichert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sozialgeschichtlicher Hintergrund
- Spanien um 1820
- Goyas Leben
- Krise der Kunst um 1800
- Kunsthistorische Einordnung der „Schwarzen Gemälde“
- „Selbstporträt mit Arrieta“ (1820) als „Vorläufer“
- Rückbezüge auf eigene Werke aus früheren Jahren
- Das Unheimliche
- Definition
- Versuch der Beschreibung des Unheimlichen in Goyas Gemälde „Die Wallfahrt zum Brunnen des Hl. Isidor“ (um 1820)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die „Schwarzen Gemälde“ von Goya, entstanden um 1820, mit dem Ziel, das Unheimliche in diesen Werken zu erfassen. Die Arbeit beleuchtet den sozialgeschichtlichen Kontext der Entstehung der Gemälde, untersucht die kunsthistorische Einordnung innerhalb von Goyas Gesamtwerk und befasst sich mit der Definition des Unheimlichen im Kontext der Werke.
- Sozialgeschichtlicher Hintergrund der Entstehung der „Schwarzen Gemälde“
- Kunsthistorische Einordnung der „Schwarzen Gemälde“ innerhalb von Goyas Gesamtwerk
- Die Bedeutung des Unheimlichen als zentrales Thema der „Schwarzen Gemälde“
- Analyse des Unheimlichen anhand von Goyas Gemälde „Die Wallfahrt zum Brunnen des Hl. Isidor“
- Die Verbindung von sozialgeschichtlichem Kontext, kunsthistorischer Einordnung und dem Unheimlichen in Goyas „Schwarzen Gemälden“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der „Schwarzen Gemälde“ von Goya ein und stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor. Im Anschluss wird der sozialgeschichtliche Hintergrund zur Zeit der Entstehung der Werke um 1820 beleuchtet, wobei die politische und wirtschaftliche Situation in Spanien, die Umstände in Madrid und die allgemeine soziale Situation, wie sie sich Goya dargeboten hat, betrachtet werden. Des Weiteren wird Goyas Leben in diesem Zeitraum beleuchtet, insbesondere seine familiäre Situation und die Umstände des Kaufs und der Ausmalung des Landhauses „Quinta del Sordo“. Darüber hinaus wird auf die „Krise der Kunst um 1800“ eingegangen, die sich besonders in Goyas Werken manifestiert. Die kunsthistorische Einordnung der „Schwarzen Gemälde“ innerhalb von Goyas gesamten Oeuvre folgt im nächsten Kapitel. Das „Selbstporträt mit Arrieta“ wird dabei als „Vorläufer“ betrachtet, das Goyas Auseinandersetzung mit seiner schweren Krankheit zeigt. Anschließend wird auf die motivischen Rückbezüge zu Werken aus seiner Frühzeit eingegangen, die Goya in den „Schwarzen Gemälden“ auf groteske Weise verfremdet. Der Hauptteil der Arbeit widmet sich schließlich dem Unheimlichen in den Gemälden. Ausgehend von Sigmund Freunds Definition des Unheimlichen werden verschiedene Elemente wie Farbe, Form, Motiv, Gestaltung etc. exemplarisch an Goyas Gemälde „Die Wallfahrt zum Brunnen des Hl. Isidor“ auf ihre „unheimlichen“ Qualitäten hin befragt.
Schlüsselwörter
Goya, Schwarze Gemälde, Unheimliche, Spanien, 1820, Krise der Kunst, Sigmund Freud, Sozialgeschichte, Kunsthistorie, „Selbstporträt mit Arrieta“, „Die Wallfahrt zum Brunnen des Hl. Isidor“
- Quote paper
- Isabel Findeiss (Author), 2006, Das Unheimliche in Goyas 'Schwarzen Gemälde'. Ein Versuch, das Unfassbare zu fassen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/68791