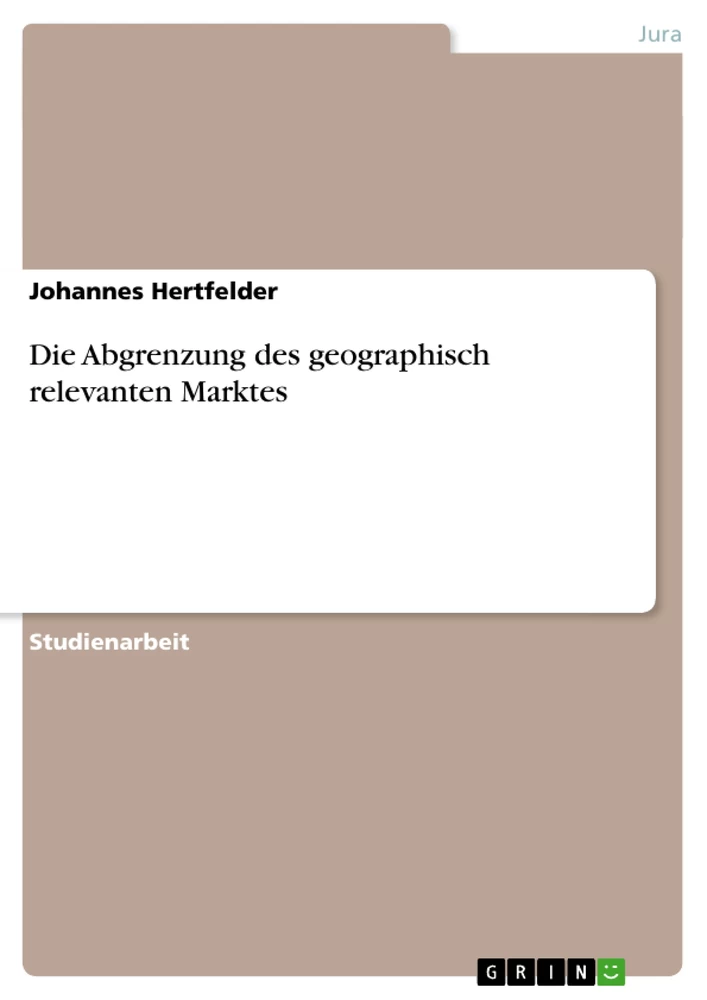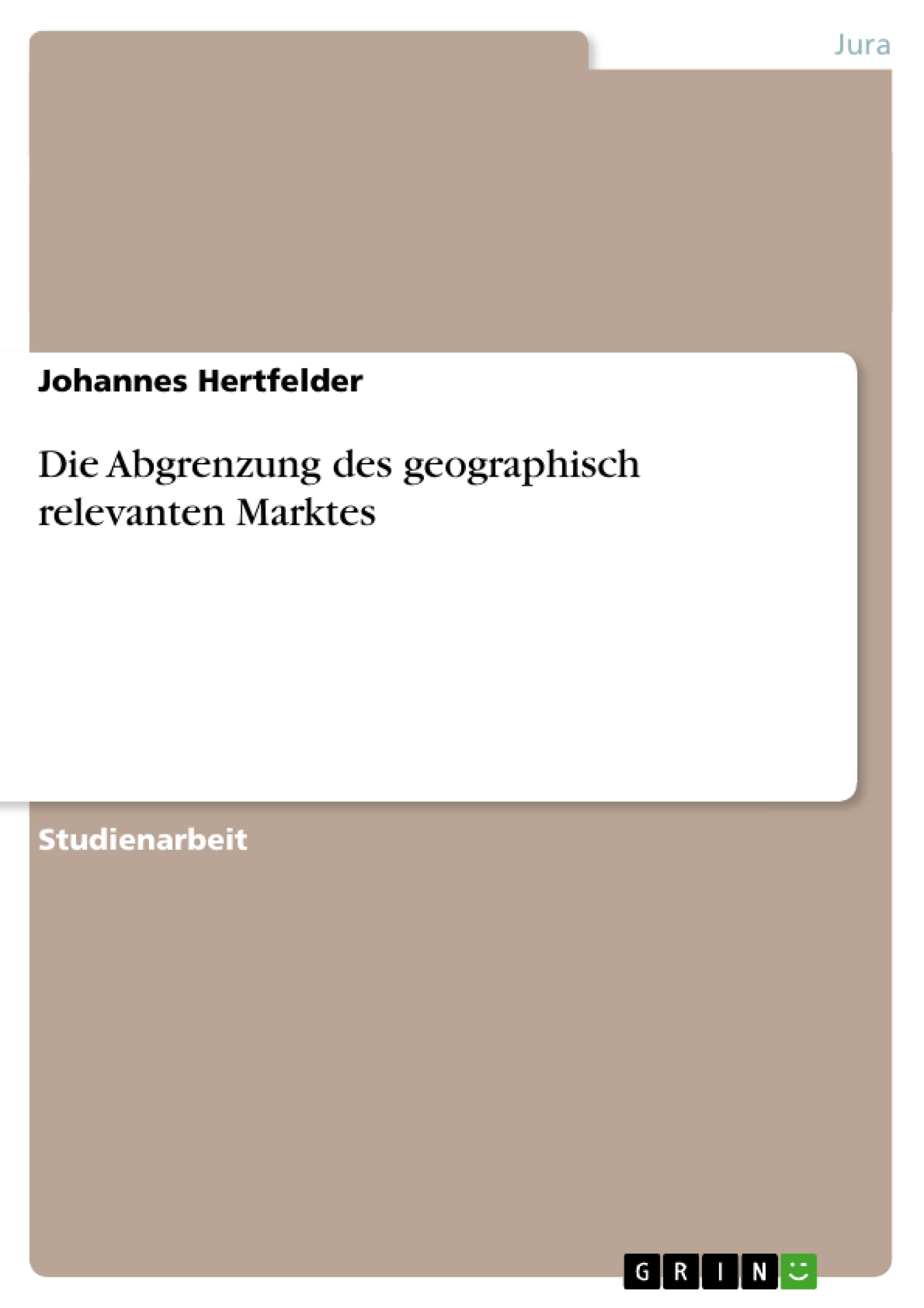Die Abgrenzung des sachlich, geographisch und zeitlich relevanten Marktes ist ein elementarer Bestandteil fast jeder kartellrechtlichen Prüfung. Insbesondere in der Fusionskontrolle und in der Missbrauchsaufsicht werden in einem ersten Schritt der Produktmarkt und der räumliche Markt abgegrenzt, auf denen die wettbewerbliche Untersuchung durchgeführt werden soll. Oft ist dabei die Marktabgrenzung bereits entscheidend für das spätere Ergebnis. Meist liegt innerhalb der Marktabgrenzung der Schwerpunkt der Betrachtung auf dem relevanten Produktmarkt. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass die Abgrenzung des geographisch (bzw. räumlich) relevanten Marktes ebenso entscheidungsrelevant sein kann wie die des Produktmarktes. Auch ist die räumliche Marktabgrenzung häufig problematisch und wirft Fragen verschiedenster Art auf. Zudem sind geographische Märkte aufgrund der wirtschaftlichen Dynamik – hier sei nur an die fortschreitende europäische Integration gedacht – nicht statisch, sondern können sich wandeln. Dies bereitet gerade in Fusionskontrollentscheidungen mit ihrem prognostischen Element Probleme. Wohl auch wegen dieser Schwierigkeiten haben sich klare und systematische Prüfungskriterien für die Abgrenzung des geographisch relevanten Marktes in der Entscheidungspraxis bislang nicht herausgebildet. Die vorliegende Arbeit versucht eine systematische Darstellung der vielen Kriterien der räumlichen Marktabgrenzung und beleuchtet zudem einige Problemfelder.
Inhaltsverzeichnis
- A. EINFÜHRUNG.
- B. GRUNDLAGEN DER GEOGRAPHISCHEN MARKTABGRENZUNG
- I. Der Begriff des relevanten Marktes.
- II. Kritik am Konzept des relevanten Marktes.
- III. Die Notwendigkeit der geographischen Marktabgrenzung im deutschen und europäischen Wettbewerbsrecht
- 1. Missbrauchsaufsicht.
- 2. Fusionskontrolle.
- 3. Kartellverbot.
- 4. Gesetzliche Anknüpfungspunkte.
- C. WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE KONZEPTE ZUR GEOGRAPHISCHEN MARKTABGRENZUNG UND IHRE EIGNUNG FÜR DIE RECHTSANWENDUNG.
- I. Relevanz und Grenzen der Ökonomie für die Rechtsanwendung im Wettbewerbsrecht.
- II. Grundlegende Modelle zur geographischen Marktabgrenzung in den Wirtschaftswissenschaften
- 1. Das Industriekonzept.
- 2. Die räumliche Marktabgrenzung in der Preistheorie.
- 3. Die räumliche Marktabgrenzung in den Substitutionskonzepten
- 4. Zwischenergebnis.
- III. Einzelne ökonometrische Methoden zur geographischen Marktabgrenzung
- 1. SSNIP-Test.
- 2. Warenstrommessungen
- 3. Die Kreuzpreiselastizität
- D. SYSTEMATISCHE DARSTELLUNG DER KRITERIEN ZUR GEOGRAPHISCHEN MARKTABGRENZUNG.
- I. Einführung
- II. Das Kriterium der „Hinreichenden Homogenität der Wettbewerbsbedingungen“.
- III. Marktergebniskriterien
- 1. Die Betrachtung von Preisen.
- a) Entscheidungsüberblick
- b) Stellungnahme.
- 2. Die Betrachtung der Marktanteile.
- a) Entscheidungsüberblick
- b) Stellungnahme.
- 3. Die Betrachtung von Handelsströmen.
- a) Entscheidungsüberblick
- b) Stellungnahme.
- 4. Zwischenergebnis.
- IV. Marktstrukturkriterien
- 1. Rechtliche Beschränkungen
- a) Gesetzliche Monopole und Gewerbliche Schutzrechte
- b) Staatliche Einfuhrbeschränkungen.
- c) Spezielle Zulassungs- und Genehmigungsvorschriften.
- d) Weitere rechtliche Beschränkungen
- e) rechtliche Beschränkungen in der deutschen Praxis.
- f) Zwischenergebnis.
- 2. Anbieterbezogene Kriterien
- a) tatsächliches Absatzgebiet.
- b) Möglicher Lieferradius/Ortsgebundenheit der Leistung
- c) Transportkosten.
- d) Vertriebs- und Markenpolitik.
- 3. Nachfragerbezogene Kriterien
- a) Art der Nachfrager.
- b) Nachfragerpräferenzen.
- aa) Räumliche Nähe des Anbieters
- bb) Markenpräferenz.
- cc) Unterschiedliche Bedürfnisse.
- dd) kulturelle und sprachliche Marktschranken
- ff) Feststellung von Nachfragerpräferenzen
- V. Zusammenfassung und praktische Anwendung der Kriterien
- 1. Exakte räumliche Marktabgrenzung überhaupt notwendig?.
- 2. Offensichtliches Vorhandensein unüberwindbarer Marktgrenzen.
- 3. Marktergebnisse als Indizien.
- 4. Art der Anbieter, Nachfrager und des Produkts.
- 5. Marktbetrachtung aus Sicht der Nachfrager
- 6. Marktbetrachtung aus Sicht der Anbieter.
- VI. Unterschiede zwischen der geographischen Marktabgrenzung in der Missbrauchsaufsicht und in der Fusionskontrolle.
- E. SPEZIELLE FRAGESTELLUNGEN
- I. Marktüberschneidung
- 1. Das Konzept der Entscheidungspraxis.
- 2. Alternative Konzepte
- 3. Stellungnahme.
- II. Potenzieller Wettbewerb.
- III. Normative Begrenzung des räumlich relevanten Marktes?
- 1. BGH: Von der Backofenmarkt- zur Staubsaugerbeutelmarktentscheidung.
- 2. Kollisionen mit anderen Rechtsordnungen wegen § 19 Abs. 2 S. 3 GWB?.
- G. ZUSAMMENFASSENDE THESEN UND SCHLUSSWORT.
- Begriff und Relevanz des relevanten Marktes im Wettbewerbsrecht
- Wirtschaftswissenschaftliche Modelle zur geographischen Marktabgrenzung
- Kriterien zur Bestimmung des geographisch relevanten Marktes
- Spezielle Fragestellungen und Anwendungsbeispiele
- Unterschiede zwischen der geographischen Marktabgrenzung in der Fusionskontrolle und der Missbrauchsaufsicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Abgrenzung des geographisch relevanten Marktes im Wettbewerbsrecht. Sie analysiert die verschiedenen Konzepte und Methoden, die für die Bestimmung des relevanten Marktes verwendet werden, insbesondere im Kontext der deutschen und europäischen Fusionskontrolle und Missbrauchsaufsicht. Die Arbeit geht außerdem auf spezifische Fragestellungen wie Marktüberschneidung und potenziellen Wettbewerb ein.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der geographischen Marktabgrenzung ein und erläutert deren Bedeutung im Kontext des deutschen und europäischen Wettbewerbsrechts. Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen der geographischen Marktabgrenzung behandelt, inklusive des Begriffs des relevanten Marktes, der Kritik am Konzept und der Notwendigkeit der Marktabgrenzung in verschiedenen Rechtsbereichen. Das dritte Kapitel befasst sich mit wirtschaftswissenschaftlichen Konzepten und Methoden zur Marktabgrenzung, beleuchtet die Relevanz der Ökonomie für die Rechtsanwendung und analysiert verschiedene Modelle und ökonometrische Methoden. Kapitel vier bietet eine systematische Darstellung der Kriterien zur geographischen Marktabgrenzung, unterteilt in Marktergebniskriterien, Marktstrukturkriterien und eine Zusammenfassung der praktischen Anwendung der Kriterien. Das fünfte Kapitel widmet sich speziellen Fragestellungen wie Marktüberschneidung und potenziellem Wettbewerb und analysiert deren Relevanz für die Marktabgrenzung. Das sechste Kapitel behandelt die normative Begrenzung des räumlich relevanten Marktes, insbesondere im Kontext von Rechtskollisionen und der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs.
Schlüsselwörter
Geographische Marktabgrenzung, Wettbewerbsrecht, Fusionskontrolle, Missbrauchsaufsicht, Relevanter Markt, Wirtschaftswissenschaftliche Konzepte, Ökonometrie, Kriterien, Marktergebniskriterien, Marktstrukturkriterien, Marktüberschneidung, Potenzieller Wettbewerb, Normative Begrenzung, Rechtskollisionen.
- Quote paper
- Johannes Hertfelder (Author), 2006, Die Abgrenzung des geographisch relevanten Marktes, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/68720