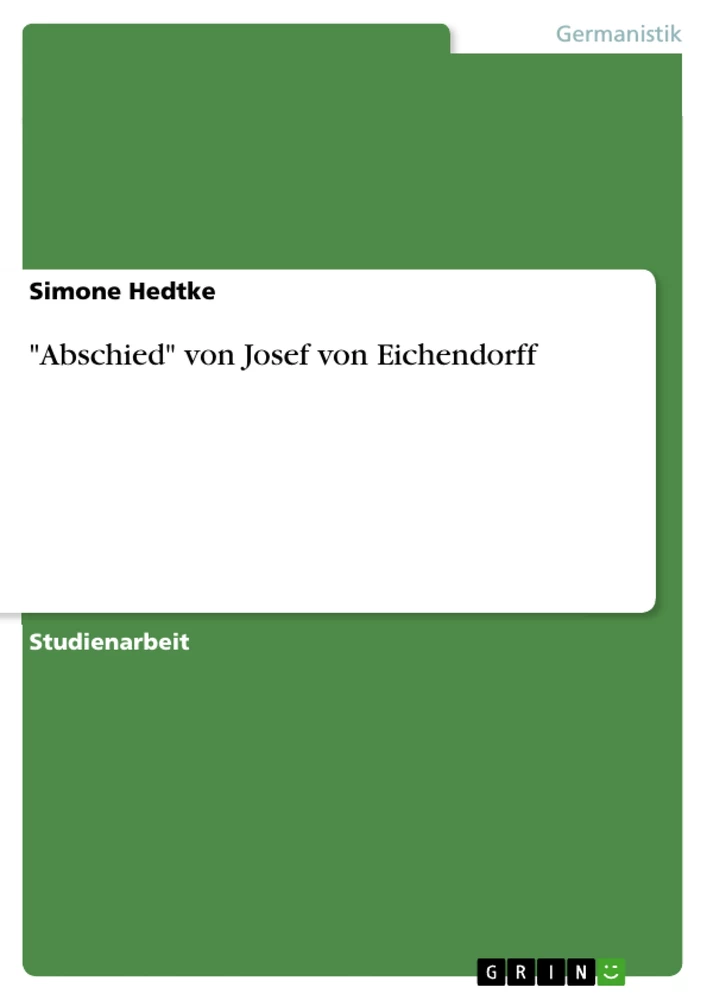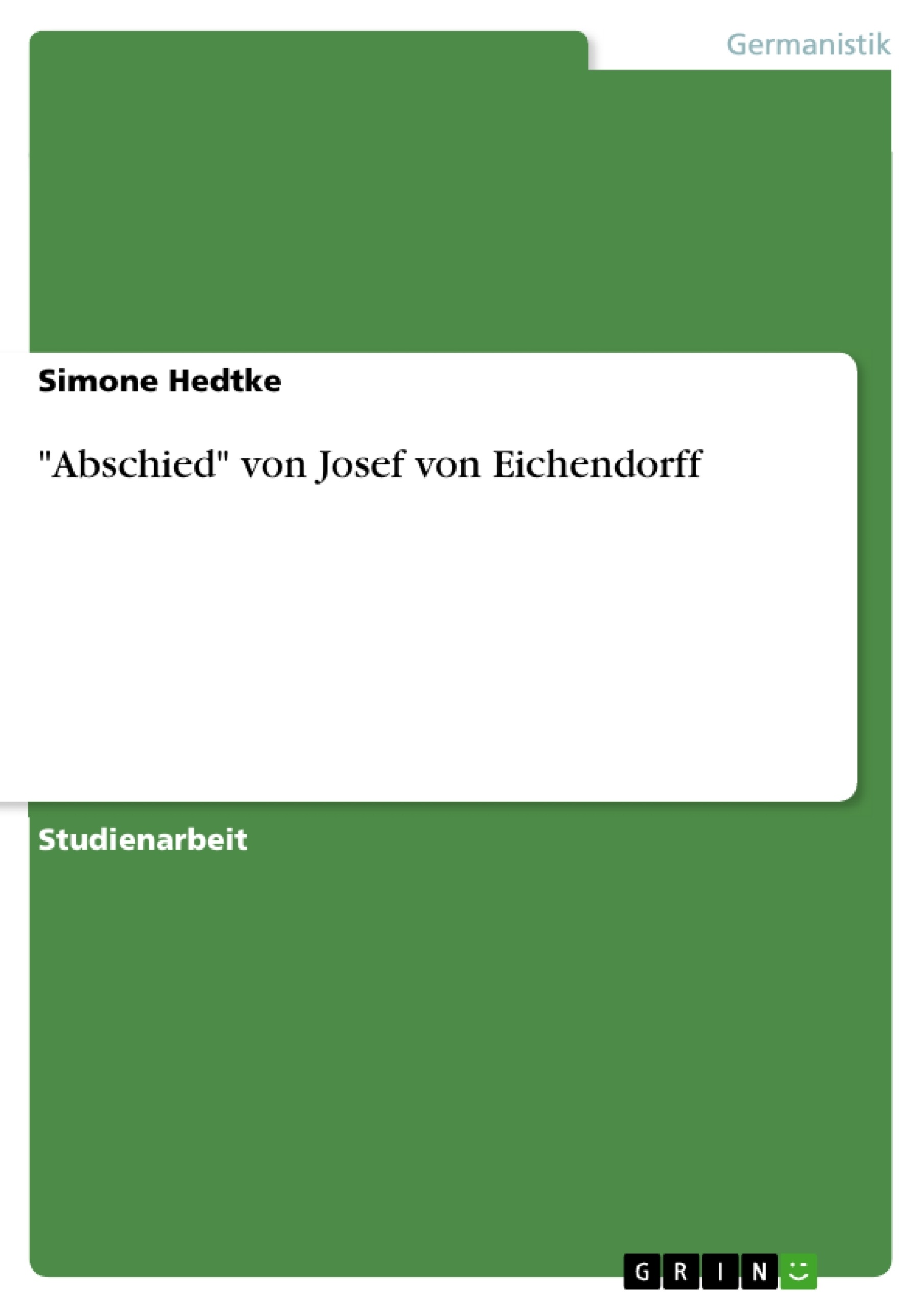Der vorliegende Text Abschied von Josef von Eichendorff (1815) ist in 4 Strophen gegliedert, die jeweils in 8 Verse unterteilt sind. Jeweils vier Verse weisen zusammen einen Kreuzreim auf, d.h. zwischen dem vierten und fünften Vers ist jeweils eine Zäsur. In Vers 13 findet man einen einzelnen Binnenreim („ vergehn, verwehen“). In dem gesamten Gedicht findet man nur
ein Enjambement vor: zwischen Vers 7 und Vers 8 („Schlag noch einmal die Bogen Um mich, du grünes Zelt.“)Das Versmaß ist ein 3-hebiger Jambus und die Verse enden abwechselnd mit einer weiblichen und einer männlichen Kadenz, wobei mit einer weiblichen Kadenz begonnen wird. Die einzige Ausnahme ist das Wort „ Saust“ in Vers 6. Hier ist man versucht, diese Silbe zu betonen, da ein Verb in der gesprochenen Sprache stärker betont wird, als ein Artikel.
Eichendorff hat aber trotzdem eine Einheit des Versmaßes versucht, herzustellen, so dass man „Saust“ nicht als betont lesen darf. Dieser regelmäßige Aufbau und der volksliedhafte Charakter lassen das Gedicht sehr harmonisch wirken. Deshalb vermutet man ein Gedicht über die Natur, findet aber eine Klage über die industrialisierte Welt vor.
Inhaltsverzeichnis
- Metrik
- Rhetorik
- Semantische Relationen
- Oppositionen
- Semantisierung des Weltmodells
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Gedicht „Abschied“ von Joseph von Eichendorff (1815) und untersucht die verwendeten rhetorischen Mittel und sprachlichen Besonderheiten. Der Fokus liegt auf der Analyse der Sprache, um die Semantisierung des Weltmodells im Gedicht zu ergründen.
- Die Verwendung von Metrik und Reimschema im Gedicht
- Die Rolle von rhetorischen Figuren wie Anaphern, Metaphern und Antithesen
- Die Semantisierung des Natur- und Gesellschaftsbildes im Gedicht
- Die Darstellung des lyrischen Ichs und seiner Beziehung zur Welt
- Die Bedeutung von sprachlichen Oppositionen und Kontrasten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Metrik
Das Gedicht „Abschied“ ist in vier Strophen mit je acht Versen gegliedert. Das Versmaß ist ein 3-hebiger Jambus mit abwechselnd weiblicher und männlicher Kadenz. Einzigartig ist die Verwendung eines Binnenreims in Vers 13 und eines Enjambements zwischen Vers 7 und 8. Durch den regelmäßigen Aufbau und die volksliedhafte Struktur wirkt das Gedicht harmonisch und vermittelt einen ersten Eindruck von der Natur, der sich jedoch in eine Klage über die industrialisierte Welt wandelt.
2. Rhetorik
Die erste Strophe zeichnet sich durch eine Anapher mit dem betonten „O“ aus, die den Leser auf die Natur lenkt. Eine Akkumulation mit den Wörtern „Täler“, „Höhen“ und „Wald“ verstärkt diesen Effekt. Der Wald wird personifiziert und als „grünes Zelt“ bezeichnet, während die „geschäftge Welt“ als Gegensatz zur Natur dargestellt wird. Die Antithese von „Lust und Wehen“ verdeutlicht die Erfahrungen des lyrischen Ichs im Wald. Auch die „geschäftge Welt“ wird personifiziert, indem sie „Saust“ und „stets betrogen“ wird. Die zweite Strophe zeigt einen Adressatenwechsel. Die Natur wird nun in ihren Einzelheiten beschrieben und die Vögel werden als Teil dieser Natur dargestellt. Die Verwendung von Emphase und Pleonasmus unterstreicht bestimmte Aussagen. Die Person, die in dieser Strophe angesprochen wird, wird dazu aufgefordert, aus ihrem geistigen Ableben wieder aufzuwachen, um sorglos leben zu können. Die dritte Strophe befasst sich mit dem inneren Erleben des lyrischen Ichs, das die Worte im Wald still in sich aufnehmen und wirken lassen kann. Die letzte Strophe kehrt zum Wald als Adressaten zurück und stellt eine Brücke zur ersten Strophe her. „Fremd in der Fremde gehn“ verdeutlicht die Einsamkeit des lyrischen Ichs in der geschäftigen Gesellschaft. Die Gesellschaft wird als oberflächlich und maskiert dargestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themen des Gedichtes sind: Natur, Industrialisierung, Gesellschaft, lyrisches Ich, Einsamkeit, Abschied, Metaphern, Personifizierung, Oppositionen, Semantisierung.
- Quote paper
- Simone Hedtke (Author), 2006, "Abschied" von Josef von Eichendorff, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/67761