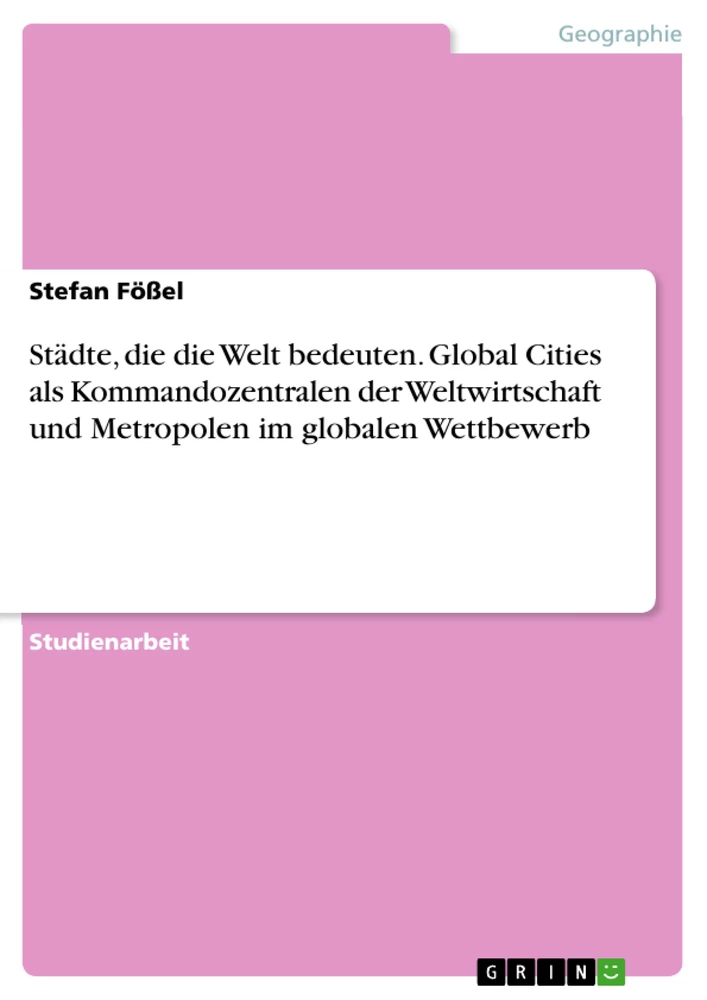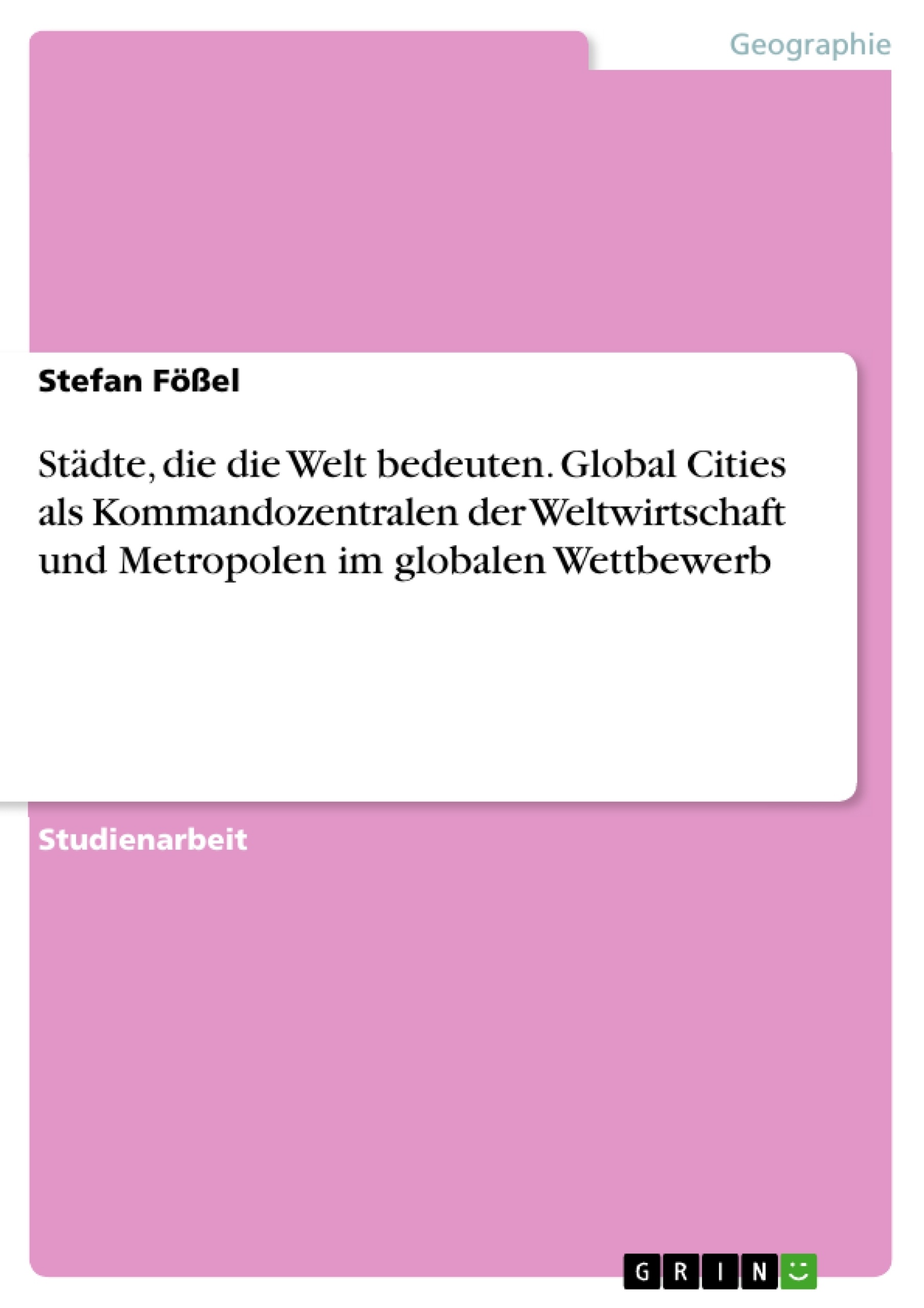Warum werden in einigen wenigen Städten Entscheidungen getroffen, die erheblichen Einfluss auf die gesamte Weltwirtschaft, auf Kultur und auf Politik nehmen? Die vorliegende Arbeit befasst sich mit solchen Städten, den Global Cities, einem neuen Typ von Städten mit transkontinentalem Aktionsradius. Die Entstehung und Bedeutung des Begriffes „Global City“ wird untersucht und die noch relativ junge Forschungsgeschichte dieser besonderen Form der Stadtgeographie beschrieben. Ausführlicher eingegangen wird dabei auf die Weltstadthypothese John Friedmanns, der anhand von sieben Annahmen eine Hierarchie der Weltstädte erstellt hat, auf die Global City-Thesen Saskia Sassens und auf die Arbeiten der GaWC-Gruppe an der Universität Loughborough. Ein Exkurs führt in das Feld der Global City-Region-Forschung, die auch das Umland der neuen Weltwirtschaftszentren einbezieht.
Vor allem sind es drei Städte, die die Global City-Hierarchie anführen, New York, London und Tokio, bei manchen Autoren kommt auch Paris hinzu. Warum es gerade diese Städte sind, um die sich alles zu drehen scheint, soll untersucht werden. Dahinter herrscht reger Wettbewerb, denn die Hierarchie der Weltstädte ist kein starres Gefüge. Westliche und fernöstliche Metropolen buhlen mit Megastädten des Südens um die besten oder zumindest bessere Plätze. Die negativen Folgen der Global City-Werdung, hohe Preise, Ausbeutung billiger Arbeitskräfte und extreme Ungleichheit, werden dabei bereitwillig in Kauf genommen.
Inhaltsverzeichnis
- Thematische Einführung
- Global City Begriffsbestimmung und -abgrenzung
- Wissenschaftshistorische Entwicklung der Global City-Forschung
- Gedanken von Welt - John Friedmanns Weltstadthypothesen
- Die Global City-These von Saskia Sassen
- Quod erat demonstrandum – die Arbeiten der GaWC
- Mehr als die Summe ihrer Teile - Global City-Regions
- Die Champions League der Global Cities
- New York - das erschütterte Symbol
- London – vom Commonwealth- zum Weltfinanzzentrum
- Tokio – Moloch der Superlative
- Paris die vierte Macht
- Gewehr bei Fuß - Global Cities zweiter Ordnung
- Noch Platz an der Sonne? - Aufstrebende Megastädte des Südens
- Fazit: Ungleiche Welt voller Glokalitäten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff und die Bedeutung von Global Cities, einen neuen Typ von Stadt mit transkontinentalem Aktionsradius. Sie beleuchtet die wissenschaftliche Entwicklung des Forschungsfeldes, analysiert die Thesen von John Friedmann und Saskia Sassen, und betrachtet die empirische Arbeit der GaWC-Gruppe. Die Arbeit untersucht auch die Rolle von Global City-Regionen und den Vergleich verschiedener Städte, insbesondere der führenden Global Cities wie New York, London, Tokio und Paris, sowie aufstrebender Megastädte im Süden.
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung von Global Cities im Vergleich zu Weltstädten
- Wissenschaftliche Entwicklung und bedeutende Theorien der Global City-Forschung
- Analyse der hierarchischen Struktur von Global Cities und deren regionale Vernetzung
- Untersuchung der Rolle von führenden Global Cities und aufstrebenden Megastädten
- Die Bedeutung von Global Cities im Kontext der Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Thematische Einführung: Die Arbeit führt in das Thema Global Cities ein und beschreibt deren Bedeutung als zentrale Knotenpunkte der globalisierten Wirtschaft. Sie hebt die Herausforderungen und die anhaltende Relevanz dieser Städte trotz negativer Ereignisse wie Terroranschlägen hervor. Die Arbeit kündigt die folgenden Kapitel an, die sich mit der Begriffsbestimmung, der Forschungsgeschichte, den Theorien bedeutender Wissenschaftler und der Analyse verschiedener Global Cities befassen.
2. Global City - Begriffsbestimmung und -abgrenzung: Dieses Kapitel untersucht den Begriff "Global City" und differenziert ihn vom Begriff "Weltstadt". Es verdeutlicht, dass Global Cities mehr sind als nur international bedeutende Städte, sondern als Knotenpunkte globaler Wirtschaftsnetzwerke fungieren. Die Arbeit skizziert die Entwicklung der Terminologie und betont die grenzüberschreitende Vernetzung dieser Städte als entscheidendes Merkmal.
3. Wissenschaftshistorische Entwicklung der Global City-Forschung: Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Global City-Forschung, beginnend mit den frühen Ansätzen von Geddes und Halls Erweiterung des „World City“-Begriffs. Es unterstreicht die Bedeutung von Peter Hall als Pionier der Weltstadtforschung und die späteren Beiträge von Saskia Sassen mit ihrer Betonung der Knotenfunktion von Global Cities in der globalisierten Weltwirtschaft. Die Kapitel erwähnt auch die Kritik an der dünnen empirischen Basis früherer Arbeiten.
4. Gedanken von Welt - John Friedmanns Weltstadthypothesen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf John Friedmanns Weltstadthypothesen, die eine Hierarchie von Weltstädten anhand von sieben Annahmen erstellen. Friedmanns Arbeit gilt als wichtiger Meilenstein in der Global City-Forschung und lieferte den Ausgangspunkt für viele weiterführende Studien. Die Arbeit analysiert die Annahmen des Modells und dessen Bedeutung für das Verständnis der Global City-Hierarchie.
5. Die Global City-These von Saskia Sassen: Das Kapitel widmet sich den Thesen von Saskia Sassen zu Global Cities. Im Gegensatz zu vorherigen Ansätzen unterstreicht Sassen die spezifische Rolle von Global Cities als Knotenpunkte globaler Wirtschaftsströme, besonders im Hinblick auf Unternehmensnetzwerke und internationale Finanzmärkte. Die Arbeit analysiert Sassens Beitrag und seine Bedeutung für das Verständnis der Global City-Dynamik.
6. Quod erat demonstrandum – die Arbeiten der GaWC: Dieses Kapitel behandelt die Arbeit der GaWC-Gruppe der Universität Loughborough und deren Beitrag zur empirischen Forschung im Bereich der Global Cities. Die Arbeit der GaWC-Gruppe schliesst Lücken in der empirischen Datenlage und bietet eine systematische Analyse der Global City-Hierarchie. Das Kapitel erläutert die Methodik und Ergebnisse der GaWC-Gruppe und deren Einfluss auf das Forschungsfeld.
7. Mehr als die Summe ihrer Teile - Global City-Regions: Das Kapitel erweitert die Perspektive über einzelne Städte hinaus und betrachtet Global City-Regionen als Städtesysteme. Es betont die Rolle des Umlands und die Vernetzung mit benachbarten Städten für die Funktion und Bedeutung der Global City. Die Arbeit analysiert die Bedeutung dieser regionalen Verflechtungen für das Verständnis der Global City-Dynamik.
8. Die Champions League der Global Cities: Dieses Kapitel präsentiert eine Analyse der führenden Global Cities, insbesondere New York, London, Tokio und Paris. Es untersucht die Gründe für deren herausragende Stellung im globalen Wirtschaftsgeschehen und diskutiert die spezifischen Charakteristika jeder Stadt.
9. Gewehr bei Fuß - Global Cities zweiter Ordnung: Dieses Kapitel diskutiert Global Cities, die hinter den Top-Städten stehen, wie z.B. Frankfurt. Es untersucht die Gründe für das Zurückbleiben dieser Städte im Vergleich zu den "großen Vier" und analysiert die Faktoren, die ihre Position in der globalen Hierarchie beeinflussen.
10. Noch Platz an der Sonne? - Aufstrebende Megastädte des Südens: Das Kapitel befasst sich mit dem rasanten Wirtschaftswachstum in China und dem Bevölkerungswachstum in anderen asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Städten. Es diskutiert das Potential dieser aufstrebenden Megastädte, sich zu neuen Global Cities zu entwickeln.
Schlüsselwörter
Global Cities, Weltstädte, Globalisierung, Weltwirtschaft, John Friedmann, Saskia Sassen, GaWC, Megastädte, Urbanisierung, transnationaler Wettbewerb, Netzwerk, Finanzplätze, Wirtschaftszentren
Häufig gestellte Fragen zu "Global Cities: Eine Analyse"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Begriff und die Bedeutung von Global Cities als einen neuen Typ von Stadt mit transkontinentalem Aktionsradius. Sie analysiert die wissenschaftliche Entwicklung des Forschungsfeldes, die Theorien von John Friedmann und Saskia Sassen, sowie die empirische Arbeit der GaWC-Gruppe. Der Fokus liegt auf der hierarchischen Struktur von Global Cities, deren regionaler Vernetzung und dem Vergleich verschiedener Städte, insbesondere der führenden Global Cities und aufstrebender Megastädte im Süden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Thematische Einführung; Global City - Begriffsbestimmung und -abgrenzung; Wissenschaftshistorische Entwicklung der Global City-Forschung; Gedanken von Welt - John Friedmanns Weltstadthypothesen; Die Global City-These von Saskia Sassen; Quod erat demonstrandum – die Arbeiten der GaWC; Mehr als die Summe ihrer Teile - Global City-Regions; Die Champions League der Global Cities (inkl. New York, London, Tokio, Paris); Gewehr bei Fuß - Global Cities zweiter Ordnung; Noch Platz an der Sonne? - Aufstrebende Megastädte des Südens; Fazit: Ungleiche Welt voller Glokalitäten.
Welche Theorien werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die Theorien von John Friedmann mit seinen Weltstadthypothesen und die Thesen von Saskia Sassen zur Rolle von Global Cities als Knotenpunkte globaler Wirtschaftsströme. Es wird auch die empirische Arbeit der GaWC-Gruppe (Globalization and World Cities) und deren Methodik zur Analyse der Global City-Hierarchie behandelt.
Welche Städte werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert im Detail die führenden Global Cities New York, London, Tokio und Paris. Zusätzlich werden Global Cities zweiter Ordnung und aufstrebende Megastädte im Süden untersucht, um ein umfassendes Bild der globalen Stadtlandschaft zu zeichnen.
Was ist der Unterschied zwischen Global Cities und Weltstädten?
Die Arbeit differenziert zwischen den Begriffen "Global City" und "Weltstadt". Global Cities werden als Knotenpunkte globaler Wirtschaftsnetzwerke definiert, die über einen transkontinentalen Aktionsradius verfügen und mehr sind als nur international bedeutende Städte. Die Arbeit verdeutlicht die Entwicklung der Terminologie und die grenzüberschreitende Vernetzung als entscheidendes Merkmal von Global Cities.
Welche Rolle spielt die GaWC-Gruppe in dieser Arbeit?
Die Arbeit der GaWC-Gruppe (Globalization and World Cities) der Universität Loughborough, welche eine systematische Analyse der Global City-Hierarchie bietet, wird ausführlich behandelt. Die Methodik und Ergebnisse der GaWC-Gruppe und deren Einfluss auf das Forschungsfeld werden erläutert, da sie Lücken in der empirischen Datenlage schließt.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit der Arbeit betont die ungleiche Verteilung von globalen Ressourcen und die Komplexität des Begriffs "Glokalität", welche die Verflechtung von globalen und lokalen Prozessen beschreibt. Die Arbeit unterstreicht die anhaltende Relevanz der Global Cities trotz globaler Herausforderungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Global Cities, Weltstädte, Globalisierung, Weltwirtschaft, John Friedmann, Saskia Sassen, GaWC, Megastädte, Urbanisierung, transnationaler Wettbewerb, Netzwerk, Finanzplätze, Wirtschaftszentren.
- Quote paper
- Stefan Fößel (Author), 2006, Städte, die die Welt bedeuten. Global Cities als Kommandozentralen der Weltwirtschaft und Metropolen im globalen Wettbewerb, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/67539