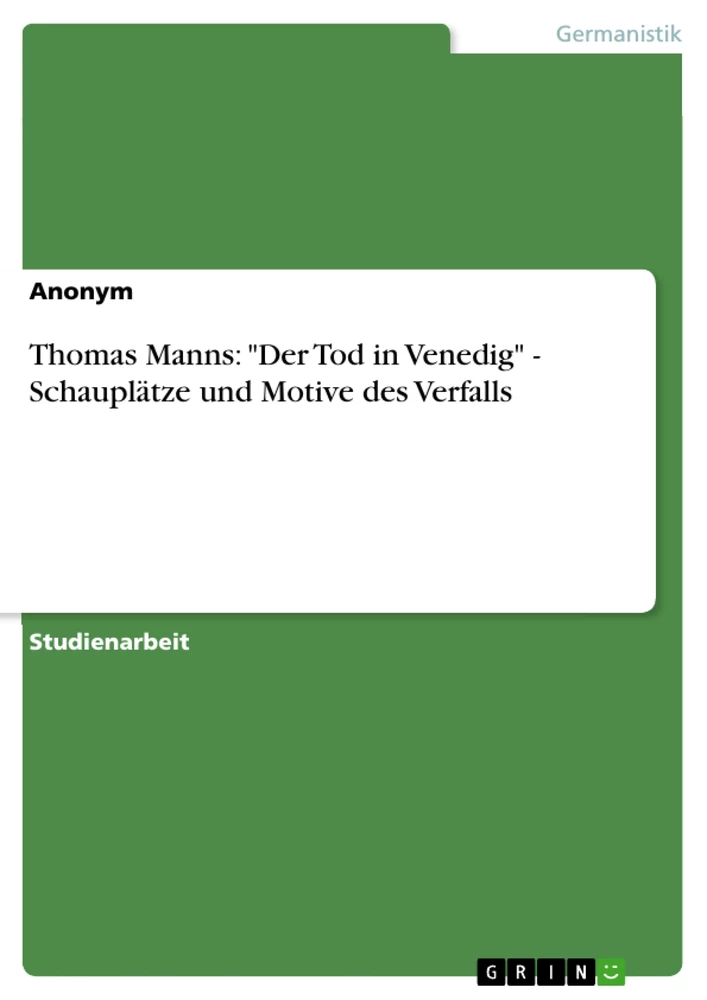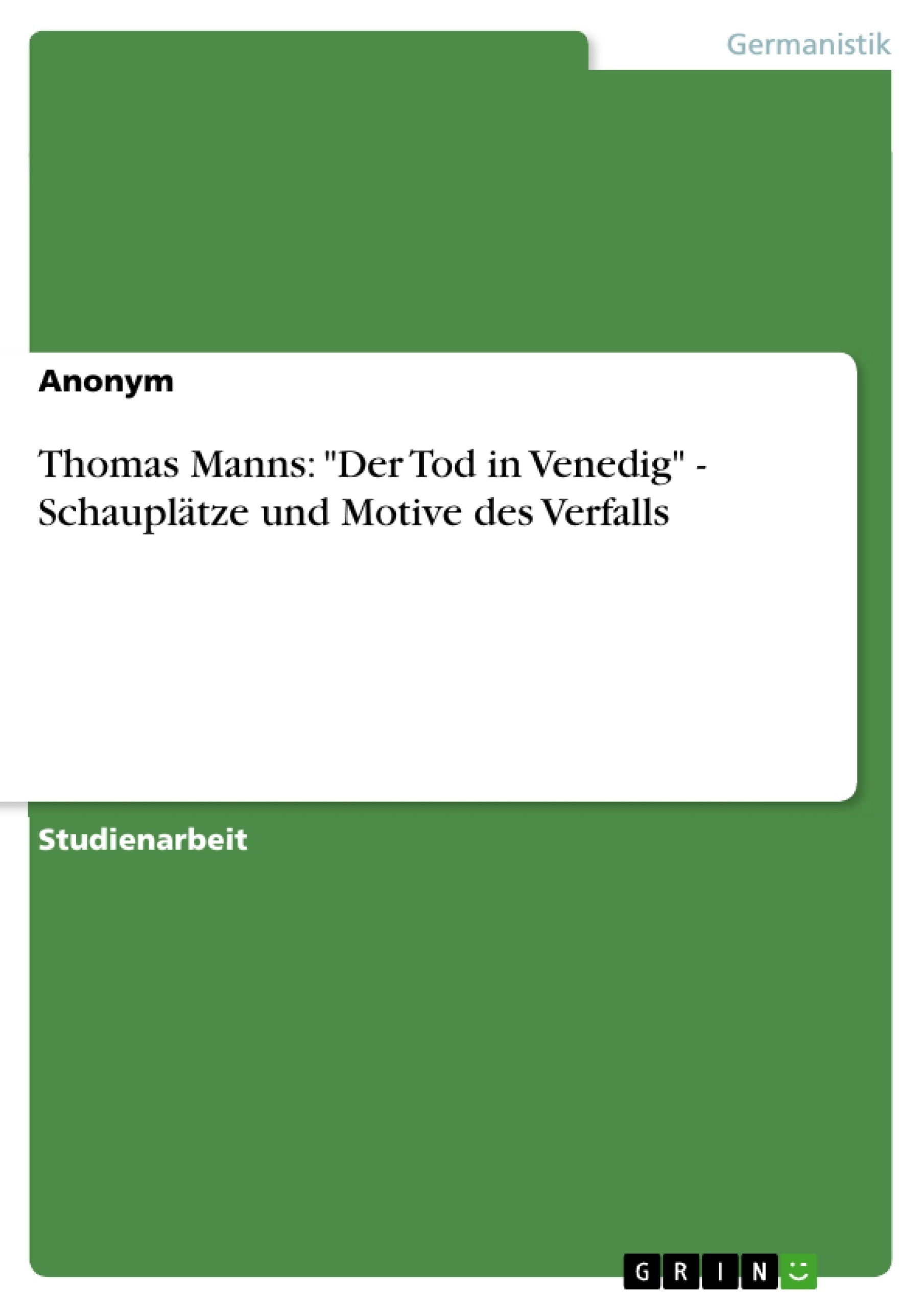Verfall und Niedergang, kurz Dekadenz, waren in der Zeit um 1900 ein verbreitetes Thema in der Literatur. In dieser Zeit, Juli 1911 bis Juli 19121, verfasste auch Thomas Mann sein Werk „Der Tod in Venedig“. Beschäftigt man sich mehr mit der Entstehungsgeschichte der Novelle, zeigt sich, dass Thomas Mann im Sommer 1911 selbst einige Tage in Venedig verbracht hat und dort „eine Reihe kurioser Umstände und Eindrücke“ erlebt hat. Thomas Mann hat sich, ebenso wie der Protagonist Gustav von Aschenbach, aufgrund einer Schreibkrise zu dieser Reise entschlossen. Auch andere Gemeinsamkeiten zwischen dem Autor und dem Protagonisten sind offensichtlich, v.a. bezüglich des Typus, der Herkunft und der literarischen Vergangenheit. Thomas Mann verarbeitet also im Tod in Venedig ein Ereignis, welches er zum Teil selbst erlebt hat. Denn auch er hatte in Venedig eine Begegnung mit einem polnischen Knaben, wobei er nach seiner Rückkehr aus Venedig von einer „recht sonderbaren Sache“ spricht, die er von da mitgebracht hat, „einen Fall von Knabenliebe bei einem alternden Künstler“. Auch die Choleraepidemie und die Haltung der venezianischen Behörden waren tatsächliche Ereignisse, denen Thomas Mann in dieser Zeit begegnete. Denn in Hamburg brach im Jahr 1905 die Cholera aus, wobei die tödliche Gefahr der Krankheit aus kommerziellen Gründen vertuscht wurde. Thomas Mann selbst hatte die Wirkung ansteckender Krankheiten miterlebt, als seine Frau Katja 1911 an Tuberkulose erkrankte. Trotz dieser vielen Gemeinsamkeiten zu Thomas Mann, zeigen sich bei der Physiognomie Gustav Aschenbachs auch gewisse Ähnlichkeiten zu dem Komponisten Gustav Mahler, der im Jahre 1911 gestorben ist. Über die Gründe dafür wird seither spekuliert. Klar ist jedoch, dass all die autobiographischen Züge und die Beziehungen zu aktuellen Themen und Personen noch ein Grund mehr sind, den „Tod in Venedig“ als eines der modernsten und bemerkenswertesten Werke Thomas Manns zu bezeichnen und sich intensiv mit dem Thema der Novelle zu beschäftigen. Die Dekadenz taucht scheinbar auch schon im Titel „Der Tod in Venedig“ auf und ist im Verlauf der Geschichte durch spezielle Schauplätze und Motive allgegenwärtig, die den Verfall des Protagonisten begleiten und veranschaulichen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Schauplätze des Verfalls
- 1. Münchner Friedhof
- 2. Schifffahrt nach Venedig
- 3. Venedig
- III. Motive des Verfalls
- 1. Todesboten
- a) Wegbegleiter
- b) Seelengeleiter
- 2. Todesmotive
- a) Gondel
- b) Sanduhr
- c) Erdbeere und Granatapfel
- 1. Todesboten
- IV. Der dionysische Verfall
- 1. Aschenbachs Haltung
- 2. Cholera und Karbolgeruch
- 3. Vision und Traum
- V. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Thomas Manns Novelle „Der Tod in Venedig“ mit Fokus auf die Darstellung von Verfall und Dekadenz. Sie untersucht, wie Schauplätze und Motive im Text den Prozess des Verfalls des Protagonisten Gustav von Aschenbach begleiten und veranschaulichen. Die Arbeit beleuchtet die autobiographischen Elemente der Novelle und deren Bezug zu zeitgenössischen Ereignissen.
- Darstellung von Verfall und Dekadenz
- Analyse der Schauplätze als Ausdruck des Verfalls
- Interpretation der Motive als Symbole des Todes und des Untergangs
- Bezug zu autobiographischen Elementen und zeitgenössischen Ereignissen
- Die Rolle Venedigs als ambivalenten Schauplatz
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Dekadenz um 1900 ein und stellt Thomas Manns „Der Tod in Venedig“ in diesen Kontext. Sie beleuchtet die Entstehungsgeschichte der Novelle, die enge Verbindung zwischen Autor und Protagonist, sowie die autobiographischen Elemente, insbesondere Manns eigene Reise nach Venedig und seine Begegnung mit einem polnischen Knaben. Die Einleitung betont die Aktualität und Bedeutung der Novelle und kündigt die Analyse der Schauplätze und Motive des Verfalls an, die im weiteren Verlauf der Arbeit im Mittelpunkt stehen werden. Die Parallelen zwischen Aschenbach und Gustav Mahler werden kurz angesprochen, ohne jedoch auf eine detaillierte Analyse einzugehen.
II. Schauplätze des Verfalls: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Schauplätze der Novelle als Orte, die den Verfall Aschenbachs symbolisch vorwegnehmen oder begleiten. Zunächst wird der Münchner Friedhof als Ort der Stille und des Todes beschrieben, der bereits zu Beginn der Novelle den bevorstehenden Tod Aschenbachs andeutet. Die Reise nach Venedig wird als eine Reise in den Untergang dargestellt, wobei das alte, düstere Schiff und seine Besatzung die Verfallserscheinungen symbolisieren. Schließlich wird Venedig selbst als ambivalenter Schauplatz beschrieben: Eine Stadt der Schönheit und des Verfalls, in der die Hitze, die Schwüle, und der faulige Geruch der Lagune den Untergang des Protagonisten vorwegnehmen.
Häufig gestellte Fragen zu Thomas Manns "Der Tod in Venedig"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert Thomas Manns Novelle "Der Tod in Venedig" mit Fokus auf die Darstellung von Verfall und Dekadenz. Sie untersucht, wie Schauplätze und Motive den Verfall des Protagonisten Gustav von Aschenbach begleiten und veranschaulichen. Autobiographische Elemente und der Bezug zu zeitgenössischen Ereignissen werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Darstellung von Verfall und Dekadenz, Analyse der Schauplätze als Ausdruck des Verfalls, Interpretation der Motive als Symbole des Todes und des Untergangs, Bezug zu autobiographischen Elementen und zeitgenössischen Ereignissen sowie die Rolle Venedigs als ambivalenten Schauplatz.
Welche Kapitel umfasst die Analyse?
Die Analyse umfasst fünf Kapitel: Einleitung, Schauplätze des Verfalls (Münchner Friedhof, Schifffahrt, Venedig), Motive des Verfalls (Todesboten, Todesmotive), Der dionysische Verfall (Aschenbachs Haltung, Cholera, Vision und Traum) und Zusammenfassung.
Wie werden die Schauplätze analysiert?
Das Kapitel "Schauplätze des Verfalls" analysiert den Münchner Friedhof als Ort der Stille und des Todes, die Schifffahrt als Reise in den Untergang und Venedig als ambivalente Stadt der Schönheit und des Verfalls, deren Hitze, Schwüle und fauliger Geruch den Untergang Aschenbachs vorwegnehmen.
Welche Motive des Verfalls werden untersucht?
Das Kapitel "Motive des Verfalls" untersucht Todesboten (Wegbegleiter und Seelengeleiter) und Todesmotive (Gondel, Sanduhr, Erdbeere und Granatapfel) als Symbole des Todes und des Untergangs.
Wie wird der "dionysische Verfall" beschrieben?
Das Kapitel "Der dionysische Verfall" beleuchtet Aschenbachs Haltung, die Cholera und den Karbolgeruch sowie seine Visionen und Träume im Kontext seines Verfalls.
Welche Rolle spielt die Einleitung?
Die Einleitung führt in die Thematik der Dekadenz um 1900 ein, stellt die Novelle in diesen Kontext, beleuchtet die Entstehungsgeschichte, die Verbindung zwischen Autor und Protagonist sowie autobiographische Elemente (Manns Reise nach Venedig und Begegnung mit einem polnischen Knaben). Sie betont die Aktualität und Bedeutung der Novelle und kündigt die Analyse der Schauplätze und Motive an.
Welche Zusammenfassung bietet die Arbeit?
Das Kapitel "Zusammenfassung" fasst die Ergebnisse der Analyse von Schauplätzen und Motiven des Verfalls zusammen und bietet eine Gesamtinterpretation der Novelle im Hinblick auf die Darstellung von Verfall und Dekadenz.
Welche autobiographischen Elemente werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt Manns eigene Reise nach Venedig und seine Begegnung mit einem polnischen Knaben als autobiographische Elemente, die die Entstehung und Interpretation der Novelle beeinflussen.
Welchen Bezug hat die Novelle zu zeitgenössischen Ereignissen?
Die Arbeit beleuchtet den Bezug der Novelle zu zeitgenössischen Ereignissen, ohne dies im Detail darzustellen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2004, Thomas Manns: "Der Tod in Venedig" - Schauplätze und Motive des Verfalls, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/67068