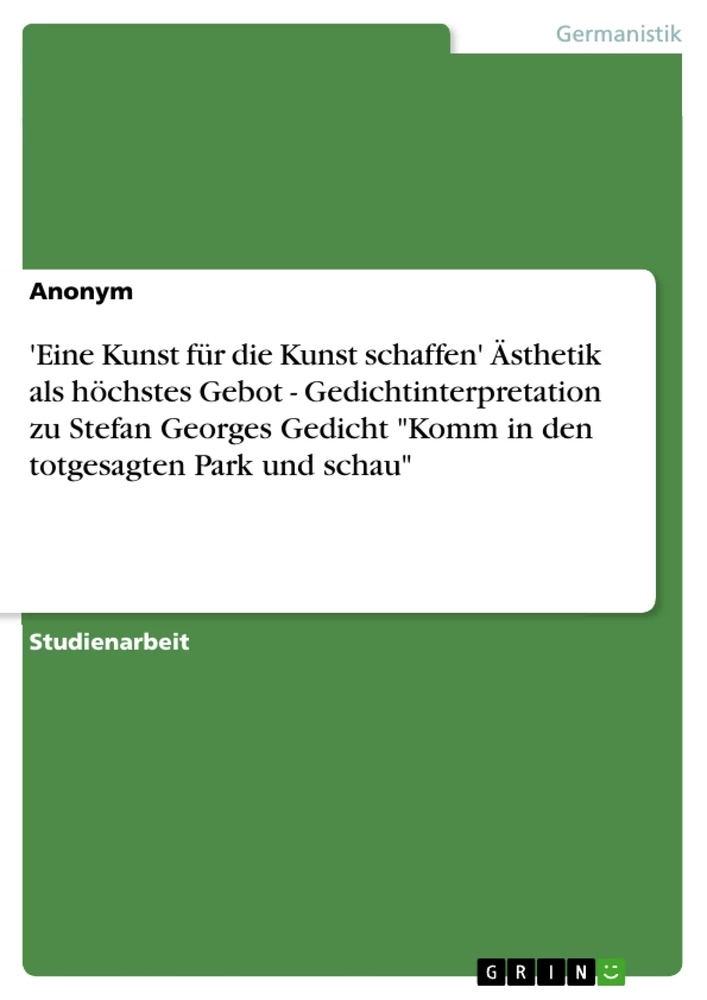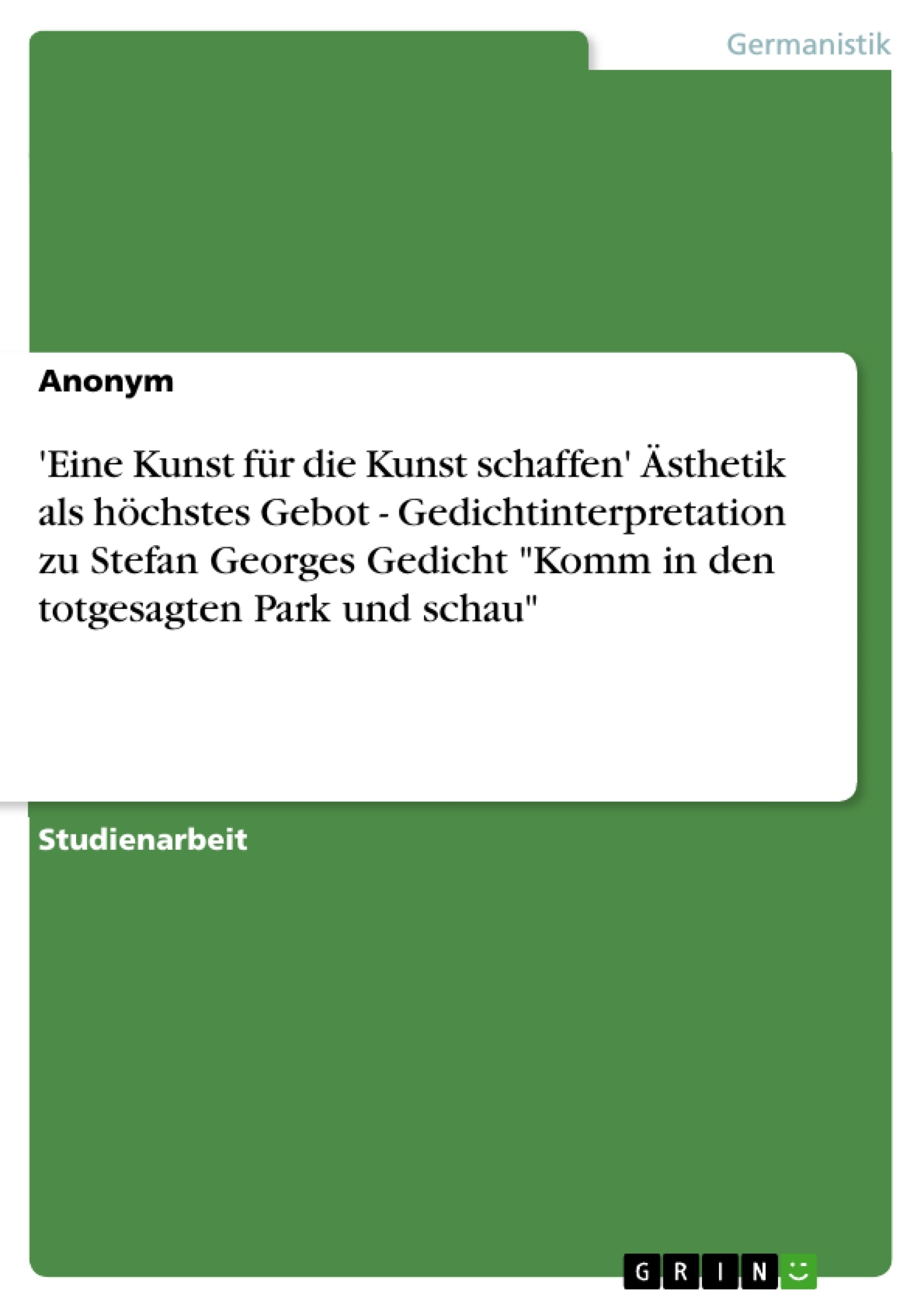Komm in den totgesagten park und schau: Der schimmer ferner lächelnder gestade · Der reinen wolken unverhofftes blau Erhellt die weiher und die bunten pfade. Dort nimm das tiefe gelb · das weiche grau Von birken und von buchs · der wind ist lau · Die späten rosen welkten noch nicht ganz · Erlese küsse sie und flicht den kranz · Vergiss auch diese letzten astern nicht · Den purpur um die ranken wilder reben · Und auch was übrig blieb von grünem leben Verwinde leicht im herbstlichen gesicht.
„Komm in den totgesagten park und schau“ lautet der Titel, wie auch der Anfang dieses Gedichts von Stefan George. Als Einleitungsgedicht zum Gedichtzyklus „Das Jahr der Seele“ von 1897, gehört es zum ersten Teil des Zyklus, der den Titel „Nach der Lese“ trägt. Obwohl „Das Jahr der Seele“ Georges meistgelesenes Werk und auch eines der erfolgreichsten modernen Gedichtbücher ist, sind die Kritiker an Georges Stil weit verbreitet. So hört man auch des öfteren von Studenten ein kategorisches „George wird nicht gelesen!“. Doch wie lässt sich diese Aussage mit der Popularität dieses Gedichts in Lesebüchern und Anthologien vereinbaren? Die Gedichte Georges werden gelesen, vor allem „Komm in den totgesagten park und schau“, entgegen der kritischen Stimmen oder vielleicht gerade deswegen. Liest man es flüchtig, könnte der Eindruck entstehen, dass es sich um ein wohlklingendes Herbstgedicht handelt, schön zu lesen, aber mit wenig Hintergrund. Doch schon bei genauerem Hinsehen fällt die sonderbare Schreibweise auf, die eigentümliche Wortwahl und die nicht auf Anhieb zu erfassenden literarischen und sprachlichen Bilder. Dies sind Merkmale, die über den Charakter eines Gelegenheitsgedichts weit hinausgehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Stefan George und sein „Kreis“
- 3. Verabsolutierung des Ästhetischen
- 3.1. Form
- 3.2. Wortwahl
- 4. Naturerlebnis im Park
- 4.1. Herbstlicher Park, die künstliche Natur als Quelle der Dichtung
- 4.2. Kommunikationssituation im Gedicht
- 4.3. Flechten des Kranzes
- 4.4. Symbolistische Verschlüsselung
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Proseminar untersucht Stefan Georges Gedicht „Komm in den totgesagten Park und schau“ im Kontext seines „Kreises“ und seiner ästhetischen Prinzipien. Es analysiert die formale Gestaltung des Gedichts und deren Bedeutung, sowie die künstlerische Intention hinter der Wortwahl und dem gewählten Bildraum.
- Die ästhetische Theorie Stefan Georges und ihre Umsetzung in „Komm in den totgesagten Park und schau“
- Die Rolle der Form und der Wortwahl in der Vermittlung der dichterischen Botschaft
- Die Darstellung der Natur und deren symbolische Bedeutung
- Der „Kreis“ um Stefan George und seine Bedeutung für die Entstehung und Rezeption des Gedichts
- Die Verbindung von Kunst und Esoterik in Georges Werk
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt das Gedicht „Komm in den totgesagten Park und schau“ von Stefan George vor, positioniert es innerhalb des Gedichtzyklus „Das Jahr der Seele“ und thematisiert die kontroversen Reaktionen auf Georges Werk, die zwischen Popularität und harscher Kritik schwanken. Der einführende Abschnitt deutet bereits auf die ungewöhnliche Schreibweise, die Wortwahl und die symbolischen Bilder hin, die das Gedicht über ein einfaches Herbstgedicht hinausheben.
2. Stefan George und sein „Kreis“: Dieses Kapitel beschreibt den „Kreis“ um Stefan George, eine Gemeinschaft, die seine Kunstvorstellungen teilte und in der Literatur als esoterisches Ritual gepflegt wurde. Georges Abneigung gegenüber dem Alltäglichen (Proletariat, Imperialismus, Kapitalismus) und sein Streben nach einer von ihm als „kunstfeindlich“ empfundenen Welt führten zu einem exklusiven Umgang mit seinen Werken – Privatdrucke, selbstbestimmte Gestaltung bis hin zur Typografie, alles unterstreicht seinen Anspruch an die Kunst für die Kunst. Der formale Aspekt, die Interpunktionslosigkeit und die Kleinschreibung, wird als bewusster Verstoß gegen die Konventionen interpretiert und als Ausdruck exklusiver Ästhetik gesehen, beeinflusst von französischen Symbolismus.
3. Verabsolutierung des Ästhetischen: Der Abschnitt analysiert die formale Gestaltung des Gedichts. Die strenge Struktur (drei Strophen à vier Verse), der Jambus, das Reimschema, Alliterationen, Assonanzen – alles wird als Ausdruck eines formvollendeten ästhetischen Anspruchs gedeutet. Die Wortwahl mit ihren vielen Adjektiven, die die Substantive detailliert beschreiben, lenkt die Wahrnehmung des Lesers auf spezifische Details und unterstreicht die Bedeutung der sinnlichen Erfahrung. Georges Fokus liegt klar auf der Form, der strengen Komposition der Elemente, die über dem inhaltlichen Sinn rangiert.
4. Naturerlebnis im Park: Dieser Abschnitt fehlt im bereitgestellten Text.
5. Schluss: Dieser Abschnitt fehlt im bereitgestellten Text.
Schlüsselwörter
Stefan George, „Komm in den totgesagten Park und schau“, „Das Jahr der Seele“, Ästhetizismus, Symbolismus, Form, Wortwahl, „Kreis“, Exklusivität, Kunst für die Kunst, Herbst, Natur, Gedichtinterpretation.
Häufig gestellte Fragen zu Stefan Georges "Komm in den totgesagten Park und schau"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Stefan Georges Gedicht "Komm in den totgesagten Park und schau" im Kontext seines "Kreises" und seiner ästhetischen Prinzipien. Der Fokus liegt auf der formalen Gestaltung, der Wortwahl und der symbolischen Bedeutung des Gedichts.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die ästhetische Theorie Stefan Georges und deren Umsetzung im Gedicht, die Rolle von Form und Wortwahl in der Vermittlung der dichterischen Botschaft, die Darstellung der Natur und deren symbolische Bedeutung, den "Kreis" um Stefan George und dessen Einfluss auf das Gedicht sowie die Verbindung von Kunst und Esoterik in Georges Werk.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Stefan George und sein „Kreis“, Verabsolutierung des Ästhetischen, Naturerlebnis im Park und Schluss. Die Kapitel 4 und 5 sind im vorliegenden Auszug jedoch unvollständig.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt das Gedicht vor, positioniert es innerhalb des Gedichtzyklus „Das Jahr der Seele“ und thematisiert die kontroversen Reaktionen auf Georges Werk. Es wird auf die ungewöhnliche Schreibweise, Wortwahl und die symbolischen Bilder hingewiesen.
Was wird im Kapitel über Stefan George und seinen "Kreis" beschrieben?
Dieses Kapitel beschreibt den "Kreis" um Stefan George, eine Gemeinschaft, die seine Kunstvorstellungen teilte. Es wird Georges Abneigung gegenüber dem Alltäglichen und sein Streben nach einer von ihm als "kunstfeindlich" empfundenen Welt erläutert. Der formale Aspekt des Gedichts, die Interpunktionslosigkeit und die Kleinschreibung, wird als bewusster Verstoß gegen Konventionen interpretiert.
Wie wird die "Verabsolutierung des Ästhetischen" analysiert?
Dieser Abschnitt analysiert die formale Gestaltung des Gedichts: Struktur, Jambus, Reimschema, Alliterationen, Assonanzen werden als Ausdruck eines formvollendeten ästhetischen Anspruchs gedeutet. Die detaillierte Wortwahl und der Fokus auf sinnliche Erfahrung werden ebenfalls untersucht. Georges Fokus auf Form über Inhalt wird hervorgehoben.
Was wird im Kapitel "Naturerlebnis im Park" behandelt (laut Inhaltsverzeichnis)?
Laut Inhaltsverzeichnis werden in diesem Kapitel der herbstliche Park als Quelle der Dichtung, die Kommunikationssituation im Gedicht, das Flechten des Kranzes und die symbolistische Verschlüsselung behandelt. Der Text zu diesem Kapitel fehlt jedoch im vorliegenden Auszug.
Was ist über den Schluss bekannt?
Der Text zum Schluss fehlt im vorliegenden Auszug.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Stefan George, "Komm in den totgesagten Park und schau", "Das Jahr der Seele", Ästhetizismus, Symbolismus, Form, Wortwahl, "Kreis", Exklusivität, Kunst für die Kunst, Herbst, Natur, Gedichtinterpretation.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2002, 'Eine Kunst für die Kunst schaffen' Ästhetik als höchstes Gebot - Gedichtinterpretation zu Stefan Georges Gedicht "Komm in den totgesagten Park und schau", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/67067