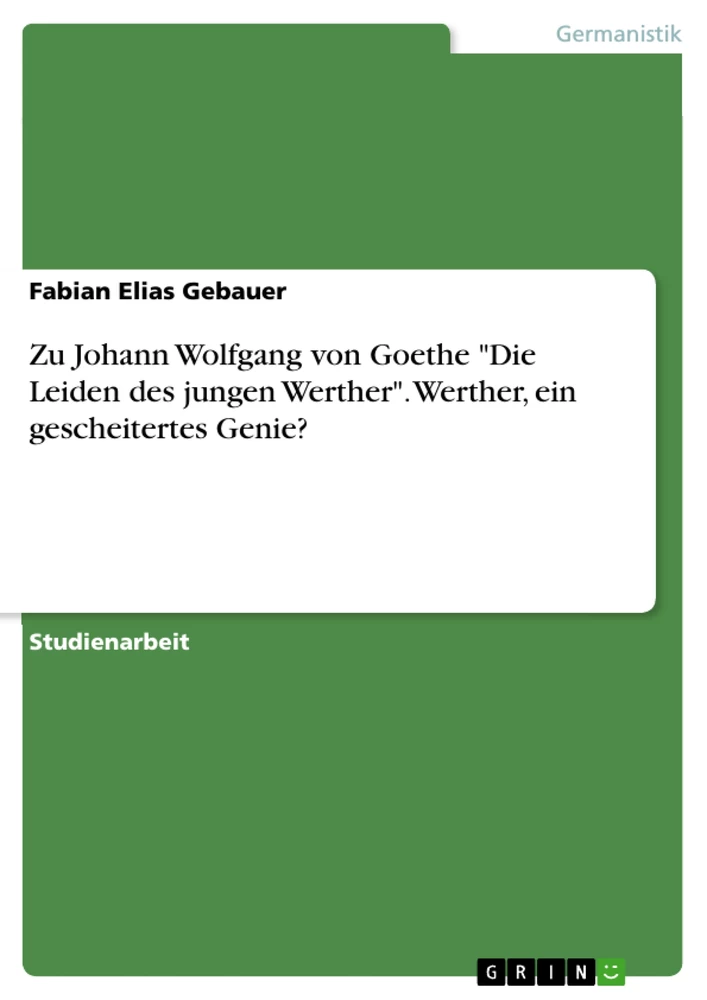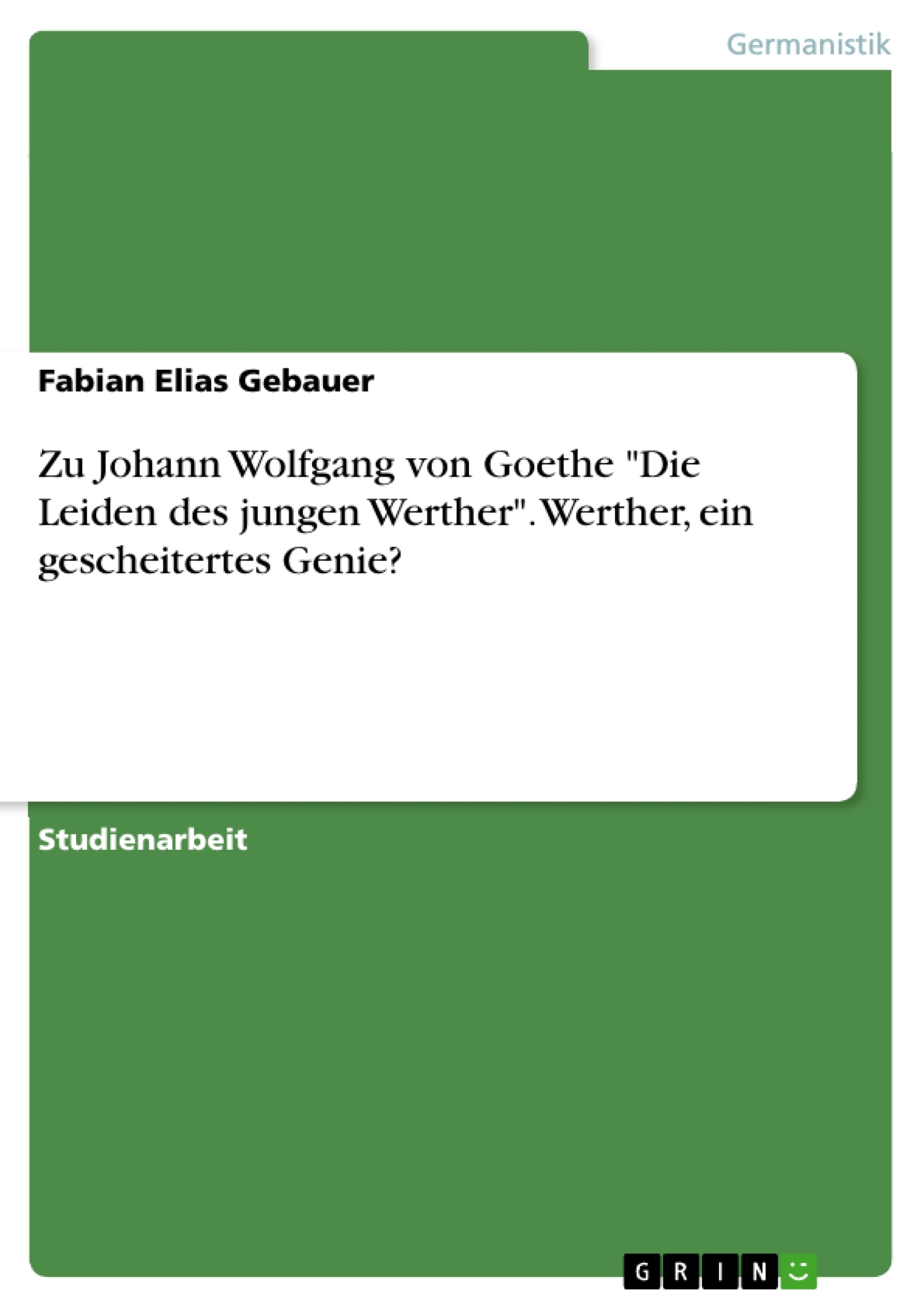[Aus der Einleitung] „Es ist ein Meisterwerk, worin hinreißendes Gefühl und frühreifer Kunstverstand eine fast einmalige Mischung eingehen. Jugend und Genie sind sein Gegenstand, und aus Jugend und Genie ist es selbst geboren.“ Ausgehend von diesem Zitat Thomas Manns über Die Leiden des jungen Werthers wird sich diese Arbeit mit dem ‚Genie‘ beschäftigen. Dies mag zwar insofern verwundern, als die unglückliche Liebe zu Lotte lange Zeit allein im Mittelpunkt des Romans für die Rezipienten, seien es Leser oder Kritiker, stand, doch verweist die Forschung ab dem 19. Jahrhundert auf die ungerechtfertigte Reduzierung auf die Liebessemantik, die der Qualität des Briefromans nicht gerecht wird. Die Leiden sind eben nicht nur Ausdruck einer gescheiterten Liebe, sondern spiegeln unter anderem in zentraler Weise das Scheitern eines Menschen wider, der sich selbst als Genie fühlt und den damit verbundenen Anspruch an sich selbst zu erfüllen sucht. Betrachtet man den Werther als ein maßgebliches Werk der Genieperiode, ist es umso interessanter, nach Elementen der Stürmer und Dränger zu suchen und Werthers Genialität zu erfassen und zu beurteilen. Als Zeitgenosse Goethes hatte Lenz zur Beschreibung Werthers schon damals ein bis in die Gegenwart hinein oft zitiertes, prägnantes Wort gefunden, indem er ihn als „gekreutzigte[n] Prometheus“ bezeichnete. Doch inwiefern war Werther wirklich ein Genie, wie es Prometheus, als Idealtypus für die Stürmer und Dränger, war? Kann man den jungen Selbstmörder wirklich als Genie bzw. als gescheitertes Genie ansehen? Was war überhaupt ein Genie? Der Bearbeitung dieser Fragen werden in dem Hauptteil ‚Werther als Genie?‘ drei große Themenblöcke gewidmet, in welchen genialische Merkmale sowie Widersprüche zur Genieidentifizierung Werthers besprochen werden: Gesellschaft, Natur und Kunst. Die jeweiligen spezielleren Unterteilungen werden an Ort und Stelle vorgestellt und begründet. Die Frage nach der Genialität Werthers erfordert zunächst eine Definition davon, was im Sturm und Drang überhaupt als Genie galt. Damit eröffnet die Analyse des Geniebegriffes den Hauptteil und bildet das Grundgerüst der Arbeit.
Als Hauptquelle wird die erste Fassung des Werthers von 1774 benutzt, da Goethe (beeinflusst von seiner gehobenen gesellschaftlichen Position und abgekehrt von seinen Idealen des Sturm und Drang) in der zweiten Version von 1787 große sprach-stilistische sowie inhaltliche Eingriffe vorgenommen hat. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Geniebegriff im Sturm und Drang
- Werther als Genie?
- Gesellschaft
- Kritik am Adel
- Kritik am Bürgertum
- Gesellschaftsvorstellungen
- Natur
- Kunst
- Malerei
- Dichtung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Quellen
- Darstellungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Geniebegriff im Kontext des Sturm und Drang und untersucht, ob Werther in Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ als gescheitertes Genie betrachtet werden kann. Sie beleuchtet die gesellschaftlichen, naturbezogenen und künstlerischen Aspekte, die für Werthers Genialität oder deren Fehlen relevant sind.
- Der Geniebegriff im Sturm und Drang und seine Bedeutung für die Künstlerrolle
- Werthers Selbstbild als Genie und seine Ansprüche an sich selbst
- Die Kritik an der Gesellschaft und deren Einfluss auf Werthers Selbstverständnis
- Die Rolle der Natur und ihrer ergreifenden Schönheit in Werthers Leben
- Werthers künstlerisches Schaffen und seine Ausdrucksform in der Malerei und Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach Werthers Genialität und den damit verbundenen Herausforderungen für den Protagonisten dar. Sie beleuchtet die Bedeutung des Romans „Die Leiden des jungen Werthers“ im Kontext des Sturm und Drang und der Geniezeit.
Der Geniebegriff im Sturm und Drang
Dieser Abschnitt untersucht die Bedeutung des Geniebegriffs im Sturm und Drang. Er analysiert die Veränderungen im Künstlerbild und die Abkehr von normativen Poetikregeln. Edward Youngs Werk „Gedanken über Original-Werke“ sowie Herders „Shakespeare“ werden als wichtige Quellen für die Entwicklung des Geniebegriffs vorgestellt.
Werther als Genie?
Das dritte Kapitel untersucht die Frage, ob Werther als Genie bezeichnet werden kann. Es analysiert seine Beziehung zur Gesellschaft, zur Natur und zur Kunst. Unterteilt wird dieses Kapitel in drei Unterkapitel, die die jeweiligen Aspekte und deren Einfluss auf Werthers Selbstverständnis näher beleuchten.
- Quote paper
- Fabian Elias Gebauer (Author), 2006, Zu Johann Wolfgang von Goethe "Die Leiden des jungen Werther". Werther, ein gescheitertes Genie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/66830