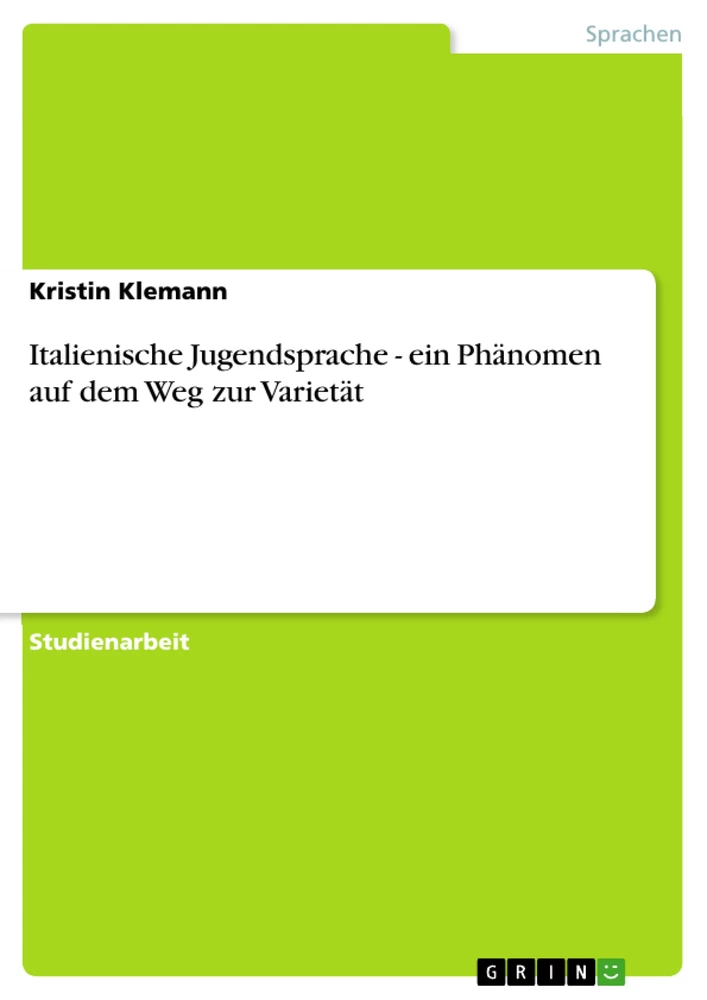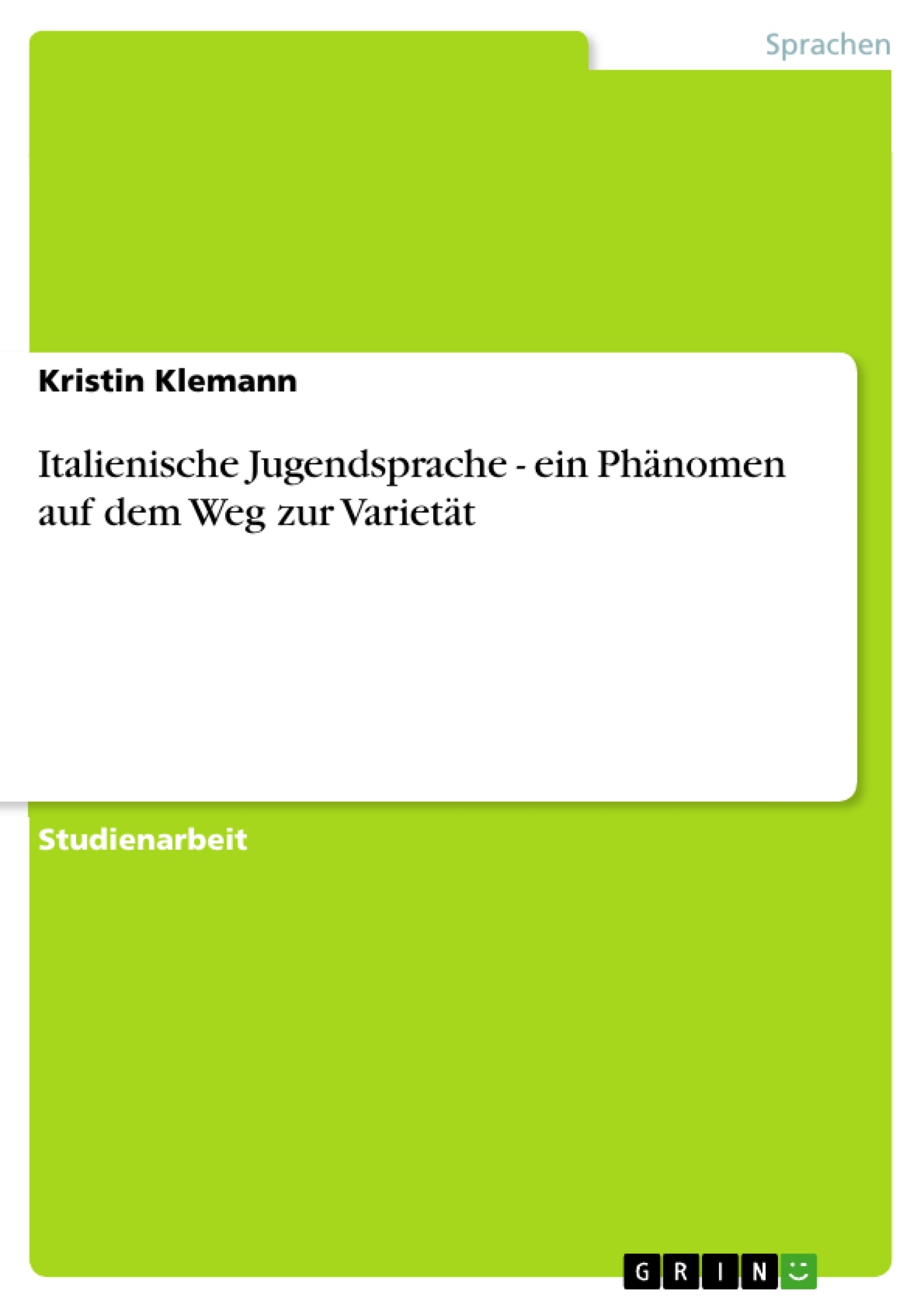Die italienische Sprache allgemein stellt keine Konstante dar. Sie weist ganz im Gegenteil ständige Veränderungen in Grammatik und Vokabular auf. Dies zeigt sich im Alltag zum Einen in Sprachen kleiner Gruppen, und zum Teil nur zu bestimmten Gegebenheiten, die wissenschaftlich gar nicht zu erfassen sind, zum Anderen aber in unzähligen Variationen, Dialekten und Jargons deren Merkmale und Vorkommen genau bezeichnet und somit auch erforscht werden können. Sie haben jedoch alle gemein, dass sie sich auf ganz spezifische Art und Weise von der italienischen Hochsprache unterscheiden.
Diese Hochsprache ist in der italienischen Realität als solche gar nicht wirklich existent, vielmehr dient sie nur als Basis in Zweifelsfällen und als Richtlinie für Lernende. Die Zahl derer, die tatsächlich Standard - Italienisch sprechen, ist, schon auf Grund der starken Verbreitung der zum Teil sehr alten Dialekte gering.
Das Vorhandensein einer einheitlichen Sprache für ganz Italien, derer sich auch alle bedienen, dagegen ist jung. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein, wurde in Italien zu Hause kein Italienisch, sondern ausschließlich Dialekt gesprochen. Das Italienische fungierte lediglich als Amtssprache. Mittlerweile nimmt der Dialekt immer weiter verbreitet den Platz der zweiten Sprache ein, und die Zahl derer, die nur Dialekt sprechen geht fast gegen Null.
Wie die Standardsprache Italienisch selbst, sind auch die sogenannten Substandards in ständiger Bewegung, in ständiger Veränderung.
Eine Untersuchung solcher Substandards bereitet häufig große Schwierigkeiten, da es keine offensichtlichen, und vor allem keine niedergeschriebenen Regeln gibt, an die sich die Sprecher halten. Dennoch müssen solche Regeln bestehen, damit eine funktionierende Kommunikation zwischen den Anwendern des jeweiligen Substandards gewährleistet ist.
Der Substandard Jugendsprache ist in diesem Zusammenhang besonders interessant, da seine Regeln sich in sehr kurzer Zeit zu verändern scheinen.
Die vorliegende Arbeit setzt sich vor allem mit der Definition der Jugendsprache als Varietät auseinander, mit den Schwierigkeiten die damit einhergehen. In diesem Kontext werden neben der Geschichte der Jugendsprache und ihrer Erforschung auch deren Verbreitung und deren Charakteristika ausgearbeitet. Konkret soll das Phänomen Jugendsprache abschließend am Beispiel von Pisa dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- 1. Teil Jugendsprache in der Geschichte
- A) Geschichte der Jugendsprache in Deutschland
- B) Geschichte der Jugendsprache in Italien
- 2. Teil Jugend und ihre Sprache
- A) Wer ist jugendlich, was ist Jugend?
- B) „Varietät?“ oder „Varietät!“
- 3. Teil Jugendsprache in der Praxis
- A) Einflüsse auf Jugendliche und ihre Sprache
- B) Verbreitung der Jugendsprache
- C) Charakteristika der Jugendsprache
- 4. Teil Jugendsprache im Raum Pisa
- Per un glossario del linguaggio giovanile in area pisana
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die italienische Jugendsprache und ihre Einstufung als Varietät. Sie beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Definition von Jugendsprache, analysiert ihre historische Entwicklung in Deutschland und Italien, und betrachtet ihre Verbreitung und Charakteristika. Die Untersuchung fokussiert auf die praktischen Aspekte der Jugendsprache und illustriert diese am Beispiel von Pisa.
- Definition von Jugendsprache als Varietät und damit verbundene Herausforderungen
- Historische Entwicklung der Jugendsprache in Deutschland und Italien
- Einflüsse auf die Jugendsprache und ihre Verbreitung
- Charakteristische Merkmale der italienischen Jugendsprache
- Fallstudie: Jugendsprache im Raum Pisa
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Arbeit untersucht die italienische Jugendsprache im Kontext der Varietätenlinguistik. Sie hebt die ständige Veränderung der italienischen Sprache hervor, die sich in verschiedenen Variationen, Dialekten und Jargons manifestiert, und betont die Schwierigkeit, diese wissenschaftlich zu erfassen. Die Arbeit konzentriert sich auf Jugendsprache als Substandard, deren Regeln sich schnell ändern und die sich von der italienischen Hochsprache unterscheidet. Die Hochsprache dient lediglich als Basis in Zweifelsfällen und als Richtlinie für Lernende, während Dialekte bis Mitte des 20. Jahrhunderts die vorherrschende Sprache im häuslichen Bereich waren. Die Arbeit untersucht die Definition von Jugendsprache als Varietät, die damit verbundenen Schwierigkeiten, ihre Geschichte, Verbreitung und Charakteristika, und stellt diese am Beispiel von Pisa dar.
1. Teil Jugendsprache in der Geschichte: Dieser Teil beleuchtet die historische Entwicklung der Jugendsprache, getrennt nach Deutschland und Italien. Er untersucht die Veränderungen im Sprachgebrauch Jugendlicher über die Zeit und den Einfluss gesellschaftlicher und kultureller Faktoren auf die Entwicklung spezifischer Sprachformen. Der Vergleich zwischen den beiden Ländern ermöglicht eine breitere Perspektive auf die historischen Muster und die Besonderheiten der jeweiligen Entwicklungen. Dieser Abschnitt legt die Grundlage für ein tieferes Verständnis der aktuellen Erscheinungsformen der italienischen Jugendsprache.
2. Teil Jugend und ihre Sprache: Dieser Teil beschäftigt sich mit der Definition von Jugend und Jugendsprache. Er analysiert die Schwierigkeiten, "Jugend" und "Jugendsprache" präzise zu definieren und die Grenzen dieser Begriffe zu bestimmen. Die Diskussion der "Varietät" als linguistisches Konzept im Kontext der Jugendsprache steht im Mittelpunkt und untersucht, inwiefern Jugendsprache die Kriterien einer Varietät erfüllt und welche Schwierigkeiten sich bei ihrer Klassifizierung ergeben. Der Abschnitt bildet eine Brücke zwischen der theoretischen Auseinandersetzung mit Jugend und der praktischen Analyse der Jugendsprache im 3. Teil.
3. Teil Jugendsprache in der Praxis: Dieser Teil befasst sich mit den praktischen Aspekten der italienischen Jugendsprache. Er analysiert die Einflüsse auf die Sprache Jugendlicher, ihre Verbreitung in der Gesellschaft und die typischen Merkmale dieser Sprachform. Es werden konkrete Beispiele für sprachliche Besonderheiten und deren soziolinguistische Bedeutung untersucht. Die Analyse bietet einen detaillierten Einblick in den aktuellen Zustand und die Dynamik der italienischen Jugendsprache.
4. Teil Jugendsprache im Raum Pisa: Dieser Teil präsentiert eine Fallstudie zur Jugendsprache in Pisa. Er untersucht die spezifischen sprachlichen Merkmale der Jugendsprache in dieser Region und vergleicht diese mit den in den vorherigen Kapiteln dargestellten allgemeinen Charakteristika. Die regionale Perspektive ermöglicht es, die Variabilität der italienischen Jugendsprache besser zu verstehen und die lokalen Einflüsse auf deren Entwicklung zu analysieren. Die Analyse dient als konkretes Beispiel für die Anwendung der zuvor entwickelten theoretischen Überlegungen.
Schlüsselwörter
Italienische Jugendsprache, Varietätenlinguistik, Sprachwandel, Jugendkultur, Soziolinguistik, Dialekte, Hochsprache, Pisa, Sprachvariation, Sprachdefinition.
Häufig gestellte Fragen zu: Italienische Jugendsprache
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die italienische Jugendsprache aus linguistischer Perspektive, insbesondere im Kontext der Varietätenlinguistik. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Jugendsprache in Deutschland und Italien, analysiert ihre Definition als Sprachvarietät, untersucht Einflussfaktoren, Verbreitung und charakteristische Merkmale und präsentiert eine Fallstudie zur Jugendsprache in Pisa. Der Text beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Definition von Jugendsprache als Varietät und die damit verbundenen Herausforderungen. Sie analysiert die historische Entwicklung in Deutschland und Italien, untersucht Einflüsse auf die Jugendsprache und ihre Verbreitung, beschreibt charakteristische Merkmale der italienischen Jugendsprache und präsentiert eine Fallstudie über die Jugendsprache in Pisa.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Teile: Teil 1 behandelt die historische Entwicklung der Jugendsprache in Deutschland und Italien. Teil 2 befasst sich mit der Definition von Jugend und Jugendsprache und analysiert die Jugendsprache als linguistische Varietät. Teil 3 analysiert die praktischen Aspekte der italienischen Jugendsprache, einschließlich Einflüsse, Verbreitung und Merkmale. Teil 4 präsentiert eine Fallstudie zur Jugendsprache in der Region Pisa.
Welche Schwierigkeiten werden bei der Definition von Jugendsprache angesprochen?
Die Arbeit hebt die Schwierigkeiten hervor, "Jugend" und "Jugendsprache" präzise zu definieren und die Grenzen dieser Begriffe zu bestimmen. Die Klassifizierung der Jugendsprache als linguistische Varietät wird diskutiert, da die Kriterien einer Varietät nicht immer eindeutig erfüllt werden.
Welche Rolle spielt der Vergleich zwischen Deutschland und Italien?
Der Vergleich der historischen Entwicklung der Jugendsprache in Deutschland und Italien dient dazu, historische Muster und Besonderheiten der jeweiligen Entwicklungen zu beleuchten und ein breiteres Verständnis der aktuellen Erscheinungsformen der italienischen Jugendsprache zu ermöglichen.
Was ist die Bedeutung der Fallstudie in Pisa?
Die Fallstudie in Pisa dient als konkretes Beispiel für die Anwendung der zuvor entwickelten theoretischen Überlegungen und ermöglicht es, die Variabilität der italienischen Jugendsprache besser zu verstehen und lokale Einflüsse auf deren Entwicklung zu analysieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt am besten?
Schlüsselwörter sind: Italienische Jugendsprache, Varietätenlinguistik, Sprachwandel, Jugendkultur, Soziolinguistik, Dialekte, Hochsprache, Pisa, Sprachvariation, Sprachdefinition.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Linguisten, Soziolinguisten, Sprachwissenschaftler und alle, die sich für Jugendsprache, Sprachwandel und Varietätenlinguistik interessieren. Sie ist auch für Studierende der Sprachwissenschaften hilfreich.
Welche Art von Daten werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf linguistischen Analysen und soziolinguistischen Beobachtungen, vermutlich auch auf korpuslinguistischen Daten (obwohl dies nicht explizit erwähnt wird). Die Fallstudie zu Pisa deutet auf empirische Forschung hin.
Wo kann ich mehr über die Arbeit erfahren?
Weitere Informationen wären im Volltext der Arbeit zu finden. Der hier dargestellte Auszug dient lediglich als Überblick.
- Quote paper
- Kristin Klemann (Author), 2006, Italienische Jugendsprache - ein Phänomen auf dem Weg zur Varietät, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/66829