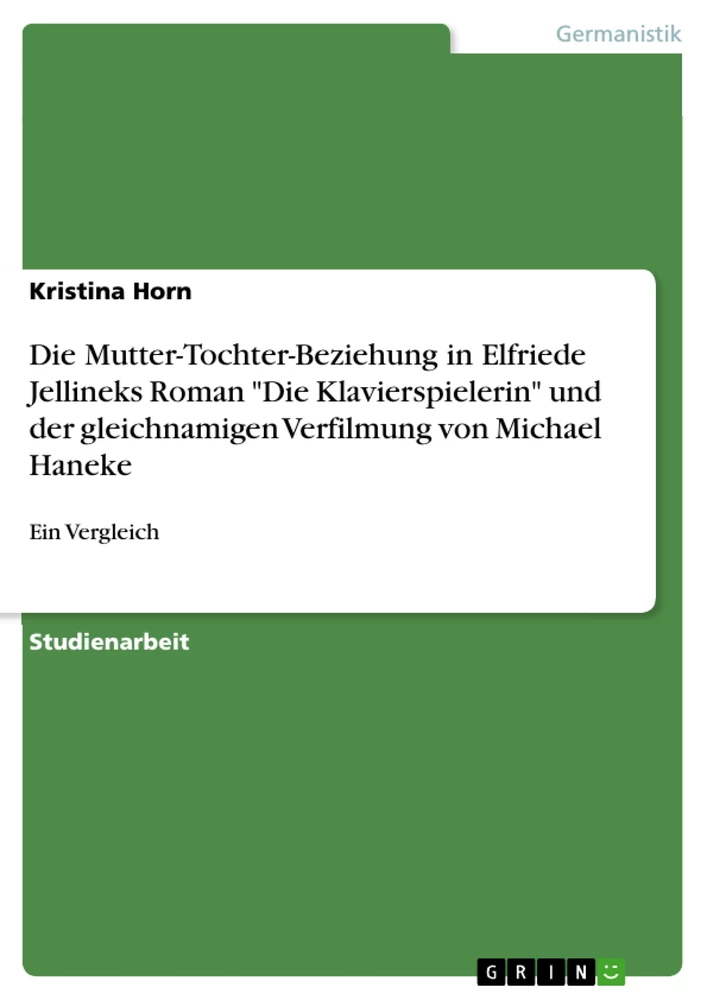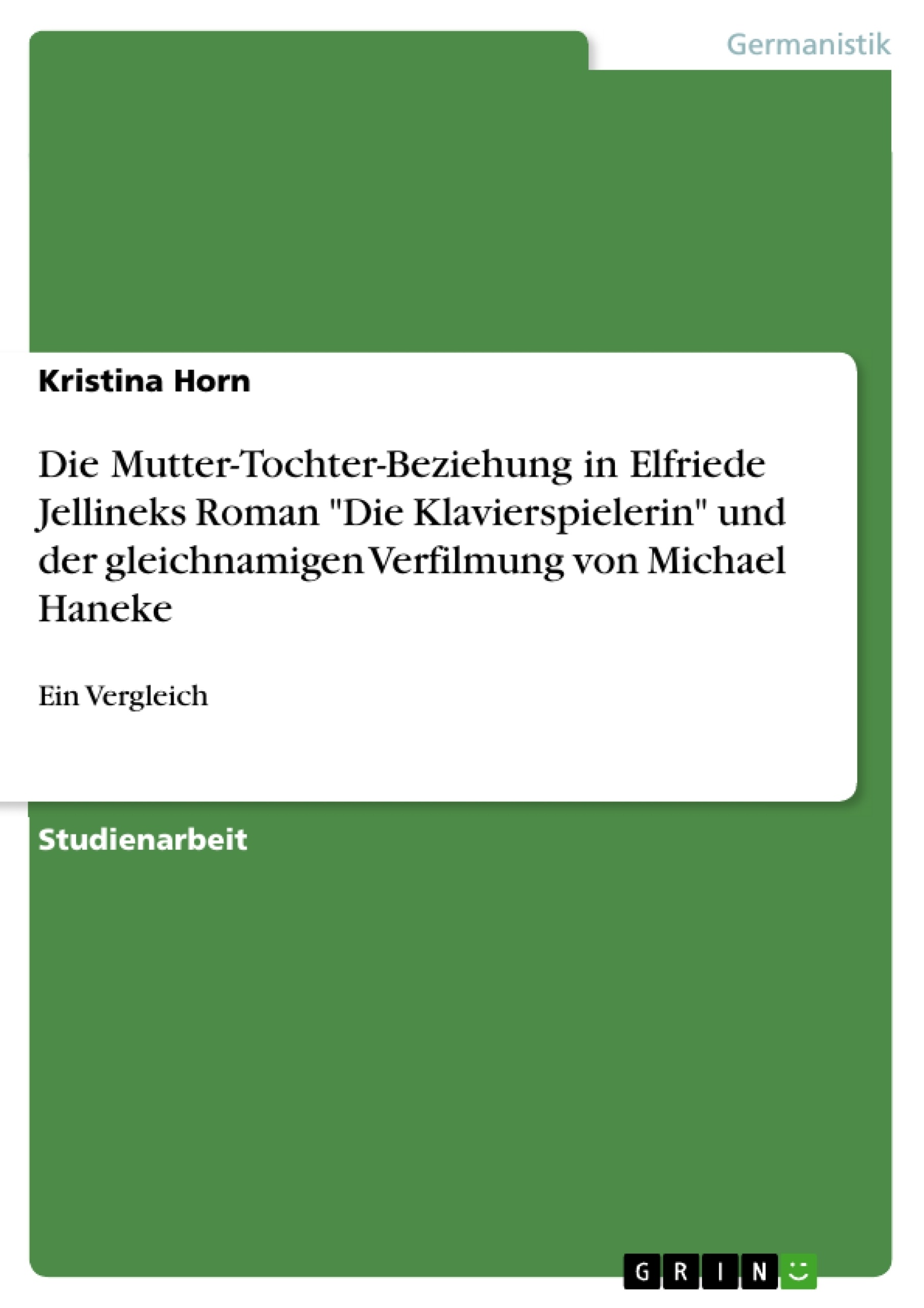1983 erschien der Roman Die Klavierspielerin von Elfriede Jelinek. Eine Geschichte, die das Leben und die seelischen Abgründe einer ungefähr dreißig Jahre alten Frau Namens Erika Kohut schildert.
Dieser literarischen Vorlage hat sich 2001 der österreichische Regisseur Michael Haneke angenommen und daraus einen Film gemacht. Besonders auffällig, einprägsam und grausam ist im Roman sowie im Film die durch Hassliebe geprägte Mutter-Tochter-Beziehung: „Das Kind ist der Abgott seiner Mutter, welche dem Kind dafür nur geringe Gebühr abverlangt: sein Leben.“(K/30)
Dieses Zitat spiegelt die Art und Weise der Beschreibung Elfriede Jelineks der Mutter und Tochter Beziehung wieder.
Die Frage, die sich im Folgenden stellt ist, welche Möglichkeiten haben und Nutzen der Roman und der Film, um den Eindruck eines solch ambivalenten Verhältnisses zwischen Mutter und Tochter zu vermitteln. Welche Mittel hat der Roman, welche Mittel hat der Film um das gewünschte Bild, den gewünschten Zustand, die gewünschte Emotion umzusetzen? Ergeben sich Differenzen in der Wirkung der Mutter-Tochter-Beziehung, wenn zum einen die Beschreibung im Roman und zum anderen die Inszenierung durch den Film betrachtet werden?
Diese Fragen nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden der ästhetischen Wirkung von Roman und Film sollen im Weiteren erörtert werden. Hierzu wird zunächst die Beschreibung der Beziehung von Mutter und Tochter im Roman betrachtet. In einem nächsten Schritt gilt es dann, die Inszenierung des Film zu untersuchen und diese gleichzeitig mit der zuvor dargestellten Schilderung des Romans zu vergleichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Mutter-Tochter-Beziehung in Die Klavierspielerin
- 2.1. Die Darstellung der Mutter-Tochter-Beziehung in Elfriede Jelineks Roman
- 2.2. Die Wirkung der Mutter-Tochter-Beziehung in Michael Hanekes Film. Eine Adaption von Elfriede Jelineks literarischer Vorlage?
- 3. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung und Wirkung der Mutter-Tochter-Beziehung in Elfriede Jelineks Roman "Die Klavierspielerin" und Michael Hanekes gleichnamiger Verfilmung. Ziel ist es, die unterschiedlichen ästhetischen Mittel beider Medien im Hinblick auf die Vermittlung eines ambivalenten Verhältnisses zwischen Mutter und Tochter zu vergleichen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede in ihrer Wirkung zu analysieren.
- Darstellung der Mutter-Tochter-Beziehung im Roman
- Ästhetische Mittel im Roman zur Vermittlung der Beziehung
- Vergleich der filmischen Adaption mit der literarischen Vorlage
- Unterschiede in der Wirkung von Roman und Film
- Analyse der ambivalenten Natur der Mutter-Tochter-Beziehung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Roman "Die Klavierspielerin" von Elfriede Jelinek und seine Verfilmung durch Michael Haneke vor. Sie hebt die grausame und von Hassliebe geprägte Mutter-Tochter-Beziehung als zentralen Aspekt hervor und formuliert die Forschungsfrage nach den Möglichkeiten und der Wirkung, die Roman und Film bei der Vermittlung dieses ambivalenten Verhältnisses nutzen. Die Arbeit kündigt den Vergleich der Darstellung im Roman und der Inszenierung im Film an, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der ästhetischen Wirkung zu untersuchen.
2. Die Mutter-Tochter-Beziehung in Die Klavierspielerin: Dieses Kapitel analysiert eingehend die komplexe und dysfunktionale Beziehung zwischen Erika und ihrer Mutter. Es beschreibt die ungewöhnlichen Lebensumstände – das gemeinsame Wohnen und Bett, die Abwesenheit des Vaters – und interpretiert diese als Ausdruck einer symbiotisch-neurotischen Abhängigkeit. Die Mutter wird als dominante Figur charakterisiert, die Erika kontrolliert und manipuliert, während Erika als passiv und abhängige Tochter dargestellt wird. Die Analyse beleuchtet die metaphorische Verwendung von Tierbildern zur Charakterisierung der Mutter (Habicht, Puma, Blutegel) und den Kontrast zu Erikas Beschreibung als kraftloser und unattraktiver „Kadaver“. Die Analyse betont die Ungleichgewichte im Machtverhältnis und die daraus resultierende, krankhafte Beziehung.
Schlüsselwörter
Die Klavierspielerin, Elfriede Jelinek, Michael Haneke, Mutter-Tochter-Beziehung, Literaturverfilmung, Romanadaption, ambivalentes Verhältnis, ästhetische Wirkung, Filmsprache, Erzähltechnik, Symbiose, Neurose, Machtverhältnis, Dominanz, Abhängigkeit.
Häufig gestellte Fragen zu "Die Klavierspielerin": Roman und Verfilmung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung und Wirkung der Mutter-Tochter-Beziehung in Elfriede Jelineks Roman "Die Klavierspielerin" und Michael Hanekes gleichnamiger Verfilmung. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der ästhetischen Mittel beider Medien und der Untersuchung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in ihrer Wirkung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Darstellung der Mutter-Tochter-Beziehung im Roman, die ästhetischen Mittel zur Vermittlung dieser Beziehung im Roman, einen Vergleich der filmischen Adaption mit der literarischen Vorlage, Unterschiede in der Wirkung von Roman und Film sowie eine Analyse der ambivalenten Natur der Mutter-Tochter-Beziehung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel, welches die Mutter-Tochter-Beziehung in Roman und Film analysiert, und einen Schluss. Die Einleitung stellt den Roman und den Film vor und formuliert die Forschungsfrage. Das Hauptkapitel analysiert die komplexe und dysfunktionale Beziehung zwischen Erika und ihrer Mutter, beschreibt die Lebensumstände und interpretiert sie als Ausdruck einer symbiotisch-neurotischen Abhängigkeit. Der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird die Mutter-Tochter-Beziehung im Roman dargestellt?
Die Mutter-Tochter-Beziehung wird als komplex und dysfunktional beschrieben. Die Mutter wird als dominante und manipulierende Figur dargestellt, während Erika als passiv und abhängige Tochter charakterisiert wird. Das gemeinsame Wohnen und Bett sowie die Abwesenheit des Vaters unterstreichen die symbiotisch-neurotische Abhängigkeit. Tiermetaphern (Habicht, Puma, Blutegel für die Mutter; „Kadaver“ für Erika) verdeutlichen das Machtgefälle und die krankhafte Beziehung.
Wie werden Roman und Film verglichen?
Die Arbeit vergleicht die ästhetischen Mittel, die im Roman und im Film zur Darstellung der ambivalenten Mutter-Tochter-Beziehung eingesetzt werden. Der Fokus liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten in der Wirkung beider Medien auf den Zuschauer bzw. Leser.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Die Klavierspielerin, Elfriede Jelinek, Michael Haneke, Mutter-Tochter-Beziehung, Literaturverfilmung, Romanadaption, ambivalentes Verhältnis, ästhetische Wirkung, Filmsprache, Erzähltechnik, Symbiose, Neurose, Machtverhältnis, Dominanz, Abhängigkeit.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die unterschiedlichen ästhetischen Mittel von Roman und Film im Hinblick auf die Vermittlung eines ambivalenten Verhältnisses zwischen Mutter und Tochter zu vergleichen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede in ihrer Wirkung zu analysieren.
- Quote paper
- Kristina Horn (Author), 2005, Die Mutter-Tochter-Beziehung in Elfriede Jellineks Roman "Die Klavierspielerin" und der gleichnamigen Verfilmung von Michael Haneke, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/66230