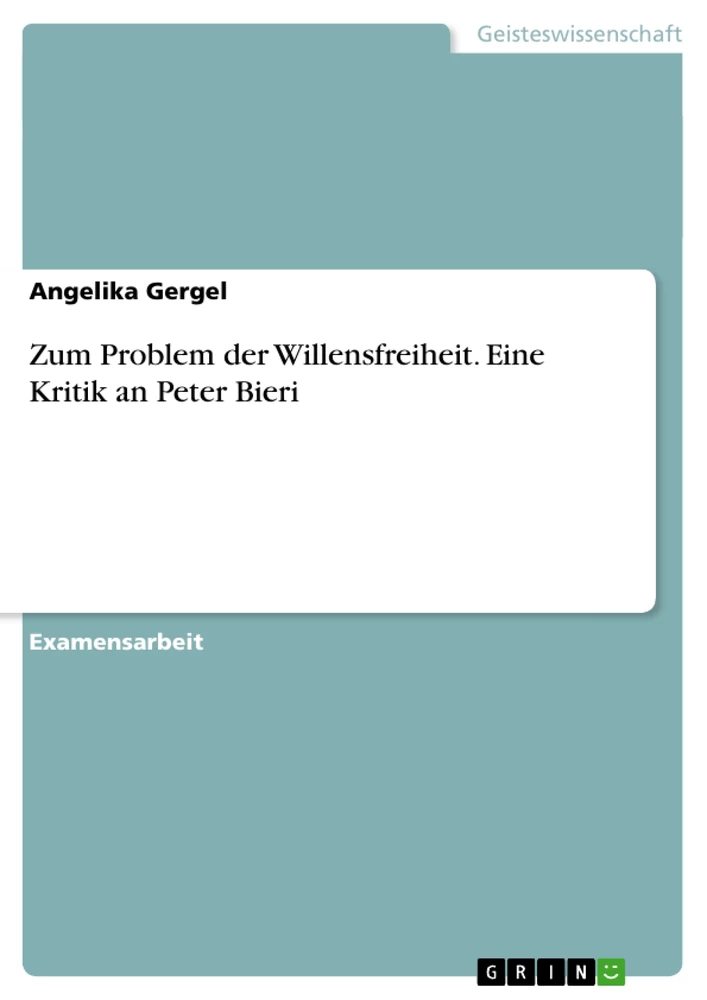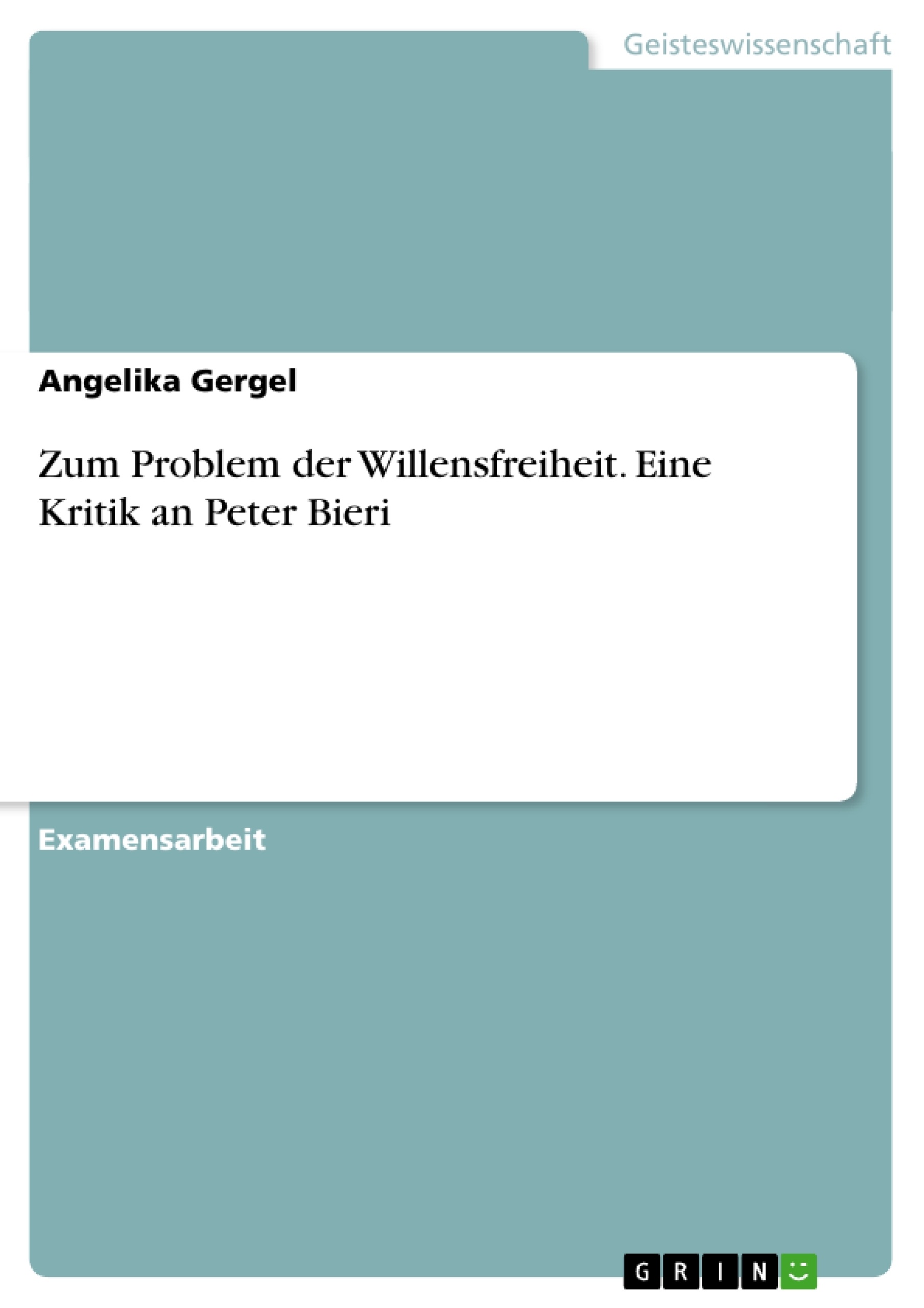„Es ist 6 Uhr Abends, die Tagesarbeit ist beendigt. Ich kann jetzt einen Spatziergang machen; oder ich kann in den Klub gehen; ich kann auch auf den Thurm steigen, die Sonne untergehn zu sehn; ich kann auch ins Theater gehen; ich kann auch diesen, oder aber jenen Freund besuchen; ja, ich kann auch zum Thor hinauslaufen, in die weite Welt, und nie wiederkommen. Das Alles steht allein bei mir, ich habe völlige Freiheit dazu; thue jedoch davon jetzt nichts, sondern gehe ebenso freiwillig nach Hause, zu meiner Frau.“ Woher kommt dieses Gefühl, dass uns Tag für Tag, Stunde um Stunde begleitet? Warum fühlen wir uns in Entscheidungsmomenten derart frei, mehrere Handlungsoptionen zu haben, wenn wir am Ende doch nur das eine tun? Man könnte soviel mit seinem Leben anfangen, bleibt in Wahrheit jedoch in Gewohnheiten und Pflichten verankert. Warum scheinen all diese Möglichkeiten nur in der Vorstellung zu existieren? Wenn es darum geht, sie in der Realität umzusetzen, stößt man sehr schnell an seine Grenzen. Im Rückblick auf vergangene Taten, erscheint es einem vielmehr so, als hätte es nur diesen einen Weg für einen gegeben. Doch niemand käme auf die Idee zu glauben, dass dies immer so ist. Jeder macht im Laufe seines Lebens die manchmal äußerst traumatisierende Erfahrung, von anderen Menschen enttäuscht oder betrogen zu werden. Immer wenn eine Person uns verletzt, fragen wir nach den Ursachen ihres Verhaltens. Wir versuchen verborgene Motive aufzudecken und uns ihre Handlungsweise zu erklären. Wir fragen aber auch, warum der Betreffende nicht anders gehandelt hat und es entstehen in uns Gefühle des Misstrauens, der Angst und des Vorwurfs. Vielleicht war die Person betrunken, konnte ihre Triebe nicht kontrollieren oder wusste es einfach nicht besser. Egal welcher Grund das Verhalten scheinbar erklärt, wir neigen dazu, den anderen auf seine unmoralische Handlungsweise aufmerksam zu machen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass eine moralische Belehrung in nicht allen Fällen eine Änderung des Verhaltens bewirken kann oder die Verinnerlichung der neuen Einsicht ein äußerst langfristiges Unternehmen darstellt. Aber wie kann das sein, wenn jeder „frei“ in seinen Entscheidungen ist? Auf der einen Seite ist das Gefühl der Freiheit eine Selbstverständlichkeit, auf der anderen Seite spüren wir jedoch auch instinktiv, dass irgendetwas diese Freiheit zu bedrohen scheint. Aber was? [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- 1. Problemstellung
- 2. Vorgehensweise
- 3. Begriffsklärung
- II. Interne Kritik
- 1. Der Irrgarten
- 2. Bedingte Freiheit
- 2.1 Handeln und Wollen
- 2.2 Freie Entscheidungen
- 2.3 Erfahrungen der Unfreiheit
- 2.4 Kritische Anmerkungen
- 3. Unbedingte Freiheit
- 3.1 Argumente für unbedingte Freiheit
- 3.2 Die falsche Fährte
- 3.3 Begriffliche Überprüfung
- 3.4 Freiheit von innen und von außen
- 3.5 Kritische Anmerkungen
- 4. Angeeignete Freiheit
- 4.1 Der artikulierte Wille
- 4.2 Der verstandene Wille
- 4.3 Der gebilligte Wille
- 4.4 Das Geheimnis der „Selbst“-Bestimmung
- 4.5 Kritische Anmerkungen
- 5. Abschlusskritik
- III. Externe Kritik
- 1. Nicht alle Wege führen nach Rom
- 1.1 Ein Problem der Methode?
- 1.2 Der andere Weg
- 2. Leib-Seele-Problem
- 2.1 Dualismus und Monismus
- 2.2 Argumente gegen den Interaktionismus
- 2.3 Argumente gegen die Identitätstheorie
- 2.4 Leib-Seele-Problem - gelöst?
- 2.5 Bieris Auflösungsvorschlag
- 2.6 Die Naturalisierung der Willensfreiheit
- 3. Der Geist fiel nicht vom Himmel
- 3.1 Der freie Wille - ein Evolutionsprodukt?
- 3.2 Das „halbdurchlässige“ Paradoxon
- 3.3 Kleine Evolution des „bewussten“ Gehirns
- 4. Der freie Wille auf dem Prüfstand
- 4.1 Die Illusion des „klaren Verstandes“
- 4.2 Warum Einsicht so schwer zu erkennen ist
- 4.3 Hängt alles von einer halben Sekunde ab?
- 4.4 Gründe vs. Ursachen
- 4.5 Das Gefühl der Urheberschaft
- 5. Zusammenfassung
- 1. Nicht alle Wege führen nach Rom
- IV. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich kritisch mit Peter Bieris Ausführungen zur Willensfreiheit. Ziel ist es, seine Argumentation zu analysieren und zu bewerten. Dabei werden verschiedene Aspekte der Willensfreiheit beleuchtet und die Grenzen des Konzepts diskutiert.
- Analyse von Bieris Konzepten der bedingten, unbedingten und angeeigneten Freiheit
- Kritik an Bieris methodischem Ansatz
- Untersuchung des Leib-Seele-Problems im Kontext der Willensfreiheit
- Diskussion der evolutionären Aspekte des freien Willens
- Bewertung des Gefühls der Urheberschaft im Entscheidungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung: Die Einführung stellt die Problemstellung dar, die sich aus dem Spannungsfeld zwischen dem subjektiven Gefühl der Willensfreiheit und der Frage nach den tatsächlichen Ursachen menschlichen Handelns ergibt. Sie skizziert die Vorgehensweise der Arbeit und klärt zentrale Begriffe. Das einleitende Zitat von Schopenhauer veranschaulicht das Paradox der scheinbar unendlich vielen Möglichkeiten im Gegensatz zur tatsächlich eingeschränkten Handlungsfreiheit.
II. Interne Kritik: Dieses Kapitel analysiert Bieris Konzepte der Willensfreiheit von innen heraus. Es werden seine unterschiedlichen Modelle der bedingten, unbedingten und angeeigneten Freiheit detailliert dargestellt und kritisch hinterfragt. Die jeweiligen Abschnitte untersuchen die Argumente für und gegen diese Konzepte und beleuchten deren Stärken und Schwächen. Der Fokus liegt auf der konzeptionellen Kohärenz und der empirischen Überprüfbarkeit der Theorien.
III. Externe Kritik: In diesem Kapitel wird Bieris Theorie aus einer externen Perspektive betrachtet. Es werden methodische Einwände erhoben und alternative Ansätze zur Erklärung der Willensfreiheit vorgestellt. Der Abschnitt zum Leib-Seele-Problem untersucht die Relevanz dieser Debatte für Bieris Theorie. Schließlich wird die Frage nach der Kompatibilität des Konzepts des freien Willens mit einer naturwissenschaftlichen Perspektive (Evolution) beleuchtet.
Schlüsselwörter
Willensfreiheit, Peter Bieri, Bedingte Freiheit, Unbedingte Freiheit, Angeeignete Freiheit, Leib-Seele-Problem, Determinismus, Kompatibilismus, Evolution, Bewusstsein, Handlungstheorie, Moral.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Willensfreiheitstheorie von Peter Bieri
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert und bewertet kritisch Peter Bieris Ausführungen zur Willensfreiheit. Sie untersucht verschiedene Aspekte der Willensfreiheit und diskutiert die Grenzen des Konzepts.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Analyse von Bieris Konzepten der bedingten, unbedingten und angeeigneten Freiheit; Kritik an Bieris methodischem Ansatz; Untersuchung des Leib-Seele-Problems im Kontext der Willensfreiheit; Diskussion der evolutionären Aspekte des freien Willens; Bewertung des Gefühls der Urheberschaft im Entscheidungsprozess.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in vier Teile: Eine Einführung, die die Problemstellung, die Vorgehensweise und wichtige Begriffe klärt; eine interne Kritik an Bieris Theorien, in der seine Konzepte der bedingten, unbedingten und angeeigneten Freiheit detailliert dargestellt und kritisch hinterfragt werden; eine externe Kritik, die methodische Einwände erhebt, alternative Ansätze vorstellt und das Leib-Seele-Problem sowie die evolutionären Aspekte der Willensfreiheit diskutiert; und einen Ausblick.
Welche Konzepte von Bieri werden analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert Bieris Konzepte der bedingten, unbedingten und angeeigneten Freiheit. Diese werden jeweils mit ihren Argumenten für und wider, Stärken und Schwächen untersucht.
Wie wird Bieris Theorie kritisch bewertet?
Bieris Theorie wird sowohl intern (durch Analyse der konzeptionellen Kohärenz und empirischen Überprüfbarkeit seiner Konzepte) als auch extern (durch methodische Einwände und die Gegenüberstellung alternativer Ansätze) kritisch bewertet. Die Kompatibilität mit einer naturwissenschaftlichen Perspektive, insbesondere der Evolution, wird ebenfalls beleuchtet.
Welches Problem spielt im Kontext der Willensfreiheit eine wichtige Rolle?
Das Leib-Seele-Problem spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit untersucht die Relevanz dieser Debatte für Bieris Theorie und diskutiert verschiedene Positionen (Dualismus, Monismus, Interaktionismus, Identitätstheorie).
Welche Rolle spielt die Evolution im Kontext der Willensfreiheit?
Die Arbeit diskutiert die Frage, ob der freie Wille als ein Evolutionsprodukt betrachtet werden kann, und beleuchtet das sogenannte „halbdurchlässige“ Paradoxon in diesem Zusammenhang.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Willensfreiheit, Peter Bieri, Bedingte Freiheit, Unbedingte Freiheit, Angeeignete Freiheit, Leib-Seele-Problem, Determinismus, Kompatibilismus, Evolution, Bewusstsein, Handlungstheorie, Moral.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, welche die jeweiligen Inhalte und Argumentationslinien kurz und prägnant darstellen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich wissenschaftlich mit der Philosophie des Geistes und insbesondere der Willensfreiheit auseinandersetzen möchten. Sie ist besonders relevant für Studierende der Philosophie und angrenzender Disziplinen.
- Quote paper
- Angelika Gergel (Author), 2006, Zum Problem der Willensfreiheit. Eine Kritik an Peter Bieri, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/66172