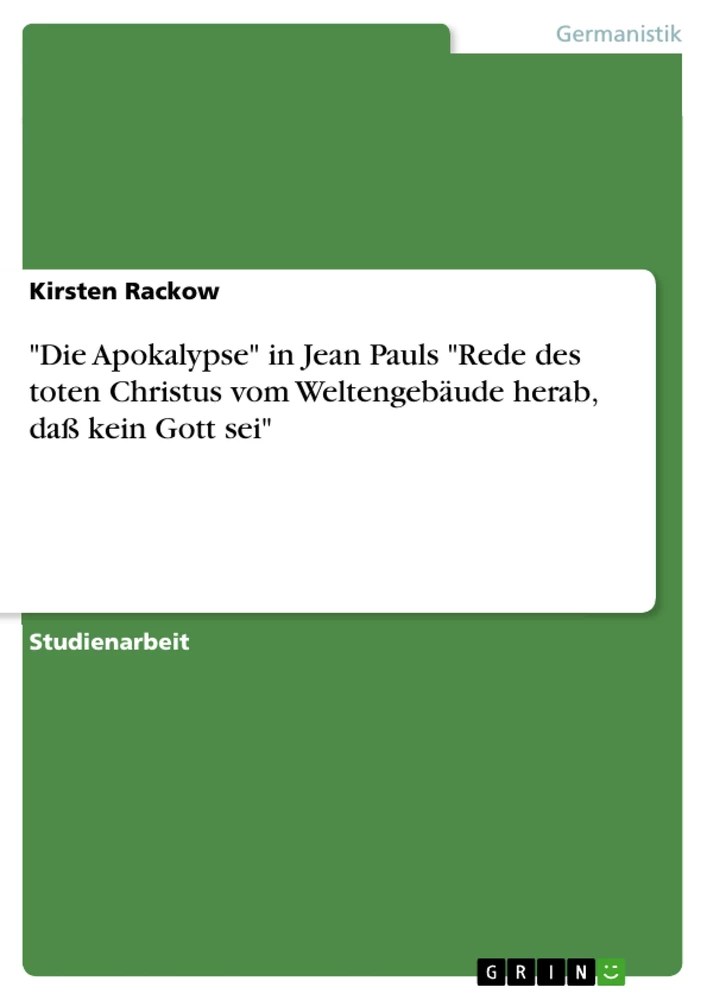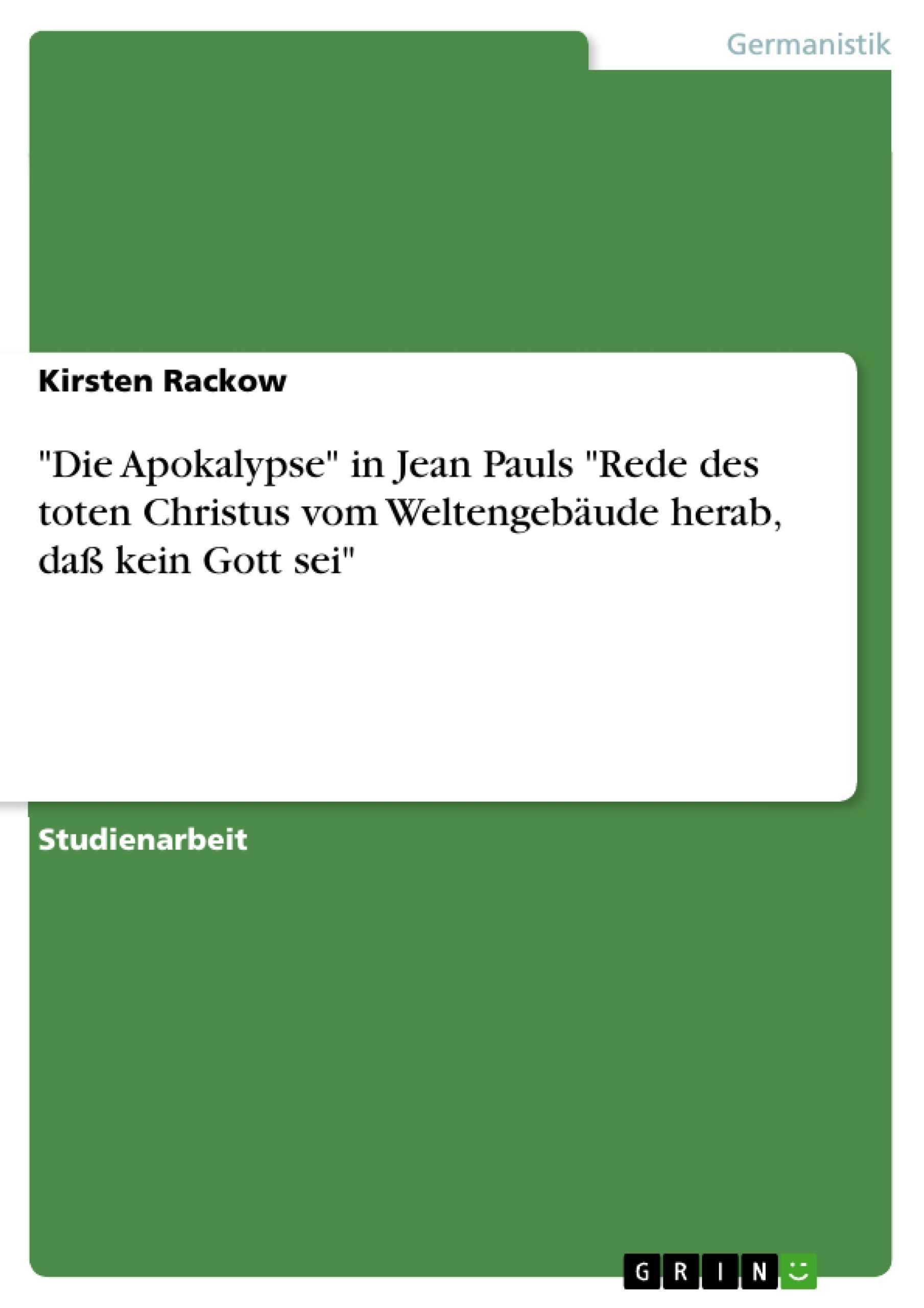Zunächst wird im zweiten Kapitel die Vorgeschichte zu Jean Pauls "Rede des toten Christus vom Weltengebäude herab, daß kein Gott sei" erläutert und die Struktur derselben wird betrachtet. Der kunstvolle Aufbau hat bei der Sinnentschlüsselung des Textes eine entscheidende Rolle inne. Johann Paul Friedrich Richter, der sich aus Bewunderung für Jean-Jacques Rousseau den Künstlernamen Jean Paul gab, hat im Hauptteil einen Untergang ausgemalt, der ähnliche Sprach und Bildkraft, wie die Offenbarung des Johannes aufweist. Es werden Parallelen untersucht und es wird zum Kapitel dritten Kapitel hingeleitet, welches die apokalyptische Darstellung ergründen wird. Neben den vielen Weltuntergängen, die von Literaten geschaffen wurden, nimmt der Untergang Jean Pauls eine Sonderstellung ein. Bei ihm geht bei nämlich nicht um die Zerstörung der sichtbaren Welt, sondern um den Zerfall von inneren Vorstellungen. Jean Paul negiert die Dogmen der christlichen Kirche und geht so weit, dass er auch noch Gott fehlen lässt.
Um die Frage, was der Autor mit seinem Text bezwecken wollte, ob das Ende, in dem der Erzähler wieder zu einem Gott findet, tatsächlich die Apokalypse zurücknimmt, wird es in Kapitel vier gehen. Es wird sich zeigen, dass die Intention der "Rede" nicht so eindeutig ist, wie es der vorangesetzte Vorbericht vorzugeben scheint.
Der Zusammenhang zwischen der "Rede" und dem Roman "Siebenkäs", in den der Autor sein erstes "Blumenstück" eingebettet hat, wird außer Acht gelassen, da die "Rede" einen Teil für sich bildet, der durchaus isoliert behandelt werden kann, was auch zumeist in der Sekundärliteratur geschehen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die "Rede des toten Christus vom Weltengebäude herab; daß kein Gott sei"
- Entstehungsgeschichte
- Aufbau
- Die apokalyptische Schilderung des Hauptteils
- Das göttliche Ende
- Die innere Apokalypse durch Nihilismus
- Negation von christlichen Vorstellungen
- Die Entschuldigung der Kühnheit
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Analyse der "Rede des toten Christus vom Weltengebäude herab; daß kein Gott sei" von Jean Paul. Der Fokus liegt auf der apokalyptischen Darstellung der Rede und der damit verbundenen inneren Apokalypse, die Jean Paul durch seine Negation christlicher Vorstellungen hervorruft. Die Arbeit beleuchtet die Entstehungsgeschichte, den kunstvollen Aufbau sowie die besondere Rolle der apokalyptischen Schilderung in der Rede.
- Die "Rede des toten Christus" als Ausdruck des Krisenbewußtseins der Umbruchszeit um 1800
- Die apokalyptische Darstellung in der Rede als Ausdruck des Nihilismus und der Negation christlicher Vorstellungen
- Der Bezug zu der Lokalsage aus dem Dorf Hof im Voigtland und die Verbindung von realer Welt und fiktiven Elementen
- Die Bedeutung der inneren Apokalypse für die Interpretation der Rede
- Die Frage nach der Intention des Autors und der möglichen Rücknahme der Apokalypse
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel beleuchtet die Vorgeschichte und die Struktur der Rede. Jean Pauls kunstvoller Aufbau spielt eine wichtige Rolle für die Sinnentschlüsselung des Textes. Der Hauptteil zeichnet einen Untergang, der in seiner sprachlichen und bildlichen Kraft an die Offenbarung des Johannes erinnert. Das dritte Kapitel untersucht die apokalyptische Darstellung in der Rede, die sich nicht auf die Zerstörung der sichtbaren Welt, sondern auf den Zerfall innerer Vorstellungen konzentriert.
Schlüsselwörter
Die "Rede des toten Christus", Jean Paul, Apokalypse, Nihilismus, christliche Vorstellungen, innere Apokalypse, Entstehungsgeschichte, Aufbau, Lokalsage, Hof im Voigtland, Krisenbewußtsein, Umbruchszeit um 1800.
- Arbeit zitieren
- Kirsten Rackow (Autor:in), 2006, "Die Apokalypse" in Jean Pauls "Rede des toten Christus vom Weltengebäude herab, daß kein Gott sei", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/65860