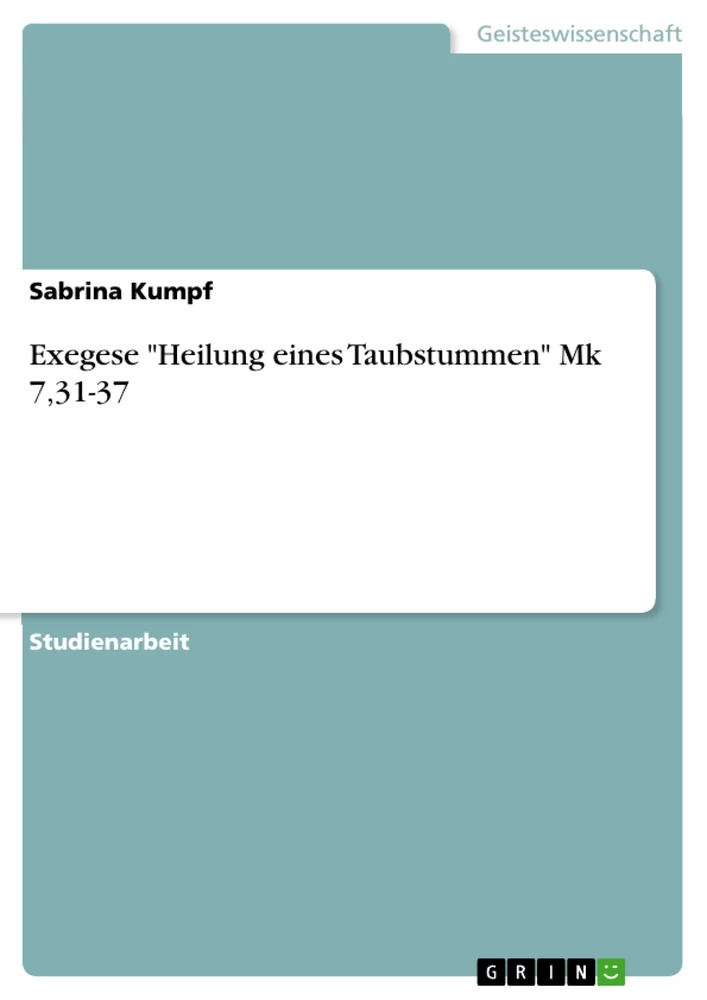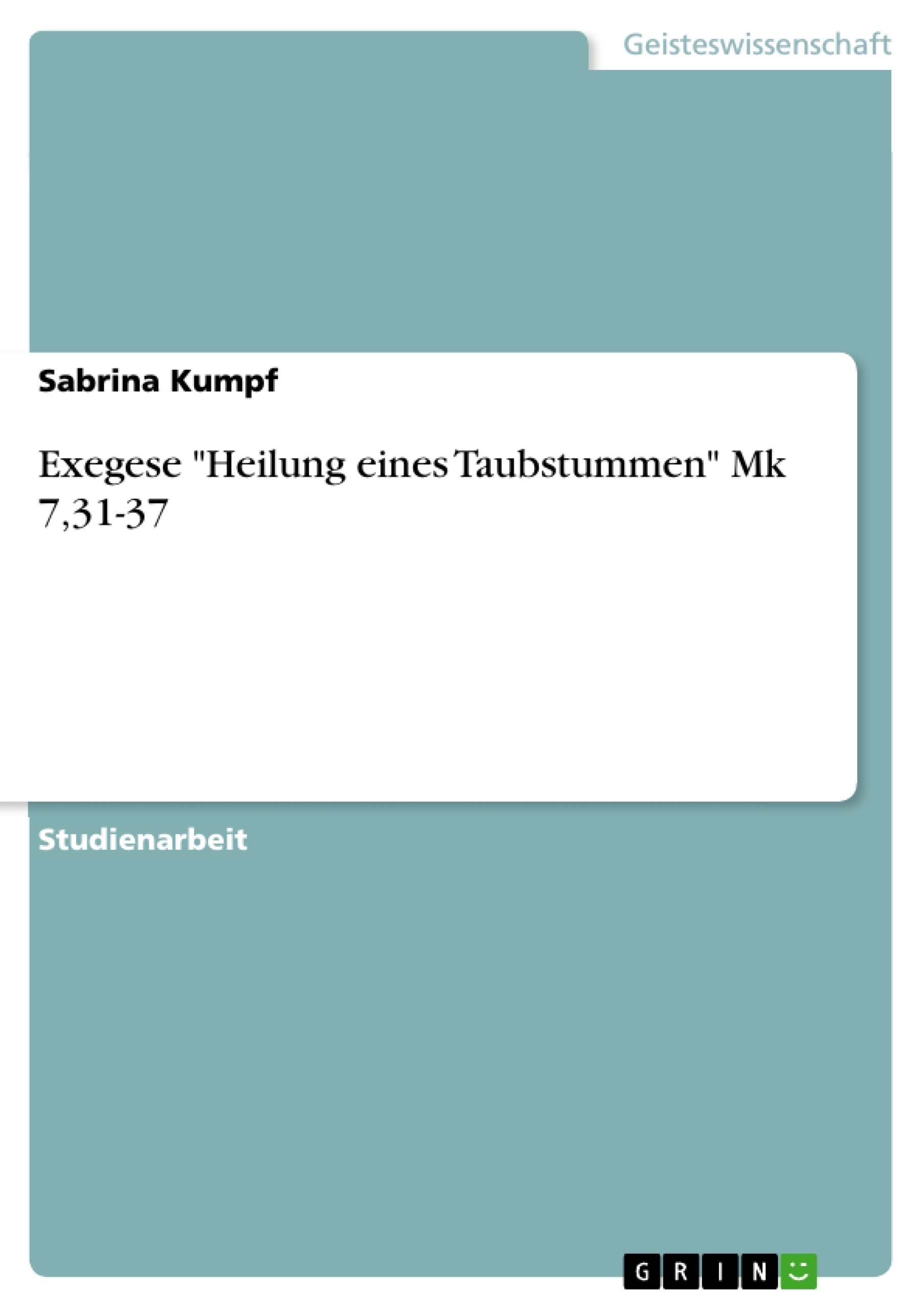1. Einleitung
Für meine erste exegetische Hausarbeit habe ich einen biblischen Teiltext aus dem Markusevangelium gewählt. „Markus war der Dolmetscher [...] des Petrus und schrieb sorgfältig auf, was er im Gedächtnis behalten hatte, jedoch nicht der Reihe nach,...“1. Er ist der Verfasser des ältesten Evangeliums und schrieb dieses für Griechisch sprechende Leser bzw. Hörer. Ich habe mich für einen Text dieses Evangelisten entschieden, weil das Markusevangelium „lange hinter den [...] Evangelien nach Matthäus, Lukas und Johannes“2 stand, obwohl es als erstes verfasst wurde. Der Evangelist Markus gehört zusammen mit Matthäus und Lukas zu den Synoptikern (Synopse = Zusammenschau). Diese drei Evangelisten „stimmen deswegen untereinander auf weiten Strecken überein, weil Matthäus und Lukas das Markusevangelium als Vorlage benutzt haben.“3 Wie Anfangs schon erwähnt, schrieb Markus nur aus dem Gedächtnis, bei Lukas und Matthäus kommen zusätzlich zum Markusevangelium als Quellen noch das jeweilige Sondergut und die Logienquelle Q hinzu. So ist es auch zu erklären, dass das Evangelium nach Markus als nicht so ausführlich gilt, obwohl der von mir auszulegende Teiltext bei Markus länger erzählt wird, als z.B. bei Matthäus.
Bei der Wahl einer Textstelle habe ich mich sofort dafür entschieden, nach einer Wundergeschichte zu suchen. Diese hatten schon immer eine besondere Wirkung auf mich, wenn ich sie z.B. in der Schule oder in der Kirche gehört habe.
Ich denke Wundergeschichten lösen allgemein bei den Zuhörern starke Reaktionen aus. Kinder sind fasziniert von dem „Zauberer“ Jesus. Viele Erwachsene ziehen solche Wundererzälungen ins Lächerliche und nehmen gerade solche Bibelgeschichten zum Anlass nicht zu glauben. Sie begründen ihren Nicht-Glauben dann damit, dass man an solchen Geschichten sähe, dass die Bibel lügt, weil natürlich keiner, auch nicht Jesus, zaubern kann. Ein Glaube, der sich auf solche „Lügengeschichten“ bezieht, könne, nach deren Meinung, nur „falsch“ sein. Andere Menschen werden durch solche Wundergeschichten dazu angeregt über die Bibel nachzudenken. Diese werden dann feststellen, dass man die Bibel sozusagen zwischen den Zeilen lesen muss, um die Botschaft des Reich Gottes zu verstehen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Übersetzungsvergleich
- Vorbereitende Schritte einer Textanalyse
- Sprachlich-syntaktisch-stilistische Analyse
- Textsemantische Analyse
- Textsortenbestimmung
- Wortsemantische Analyse
- Traditions- und Redaktionskritik
- Gesamtinterpretation
- Literaturliste
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Exegese des biblischen Textes „Heilung eines Taubstummen“ aus dem Markusevangelium (Mk 7, 31-37). Die Arbeit verfolgt das Ziel, den Text detailliert zu analysieren und seine Bedeutung im Kontext des Markusevangeliums zu erschließen.
- Untersuchung der sprachlichen Besonderheiten des Textes
- Analyse der Bedeutung des Wunders im Rahmen der Heilungswunder im Markusevangelium
- Erforschung der möglichen symbolischen Bedeutung des Taubstummen
- Einordnung des Textes in die Textsorte „Wundergeschichte“
- Vergleich verschiedener Übersetzungen und deren Einfluss auf die Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Text und die gewählte Methodik vor und erläutert die Relevanz der Untersuchung im Kontext des Neuen Testaments und der Theologie.
- Der Abschnitt „Übersetzungsvergleich“ analysiert die Unterschiede in der Übersetzung des Textes in verschiedenen Bibelübersetzungen und deren Einfluss auf die Interpretation.
- Die „Vorbereitende Schritte einer Textanalyse“ liefern einen Überblick über die wichtigsten Methoden der Textanalyse und deren Anwendung auf den ausgewählten Abschnitt.
- Die „Sprachlich-syntaktisch-stilistische Analyse“ untersucht die sprachlichen Besonderheiten des Textes, die Syntax und die stilistischen Elemente.
- Die „Textsemantische Analyse“ befasst sich mit der Bedeutung des Textes im Kontext seiner literarischen Umgebung.
- Die „Textsortenbestimmung“ untersucht die Genrezugehörigkeit des Textes und ordnet ihn in die Kategorie der Wundergeschichten ein.
- Die „Wortsemantische Analyse“ untersucht die Bedeutung einzelner Wörter und deren Bedeutung im Kontext des gesamten Textes.
- Der Abschnitt „Traditions- und Redaktionskritik“ analysiert die Entstehungsgeschichte des Textes und die möglichen Einflüsse auf seine Ausgestaltung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie Heilungswunder, Taubstummen, Symbolismus, Textanalyse, Übersetzungskritik, Textsortenbestimmung und traditionskritische Forschung. Sie beleuchtet die Bedeutung des Textes im Kontext des Markusevangeliums und dessen Bedeutung für die christliche Theologie.
- Quote paper
- Sabrina Kumpf (Author), 2003, Exegese "Heilung eines Taubstummen" Mk 7,31-37, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/65497