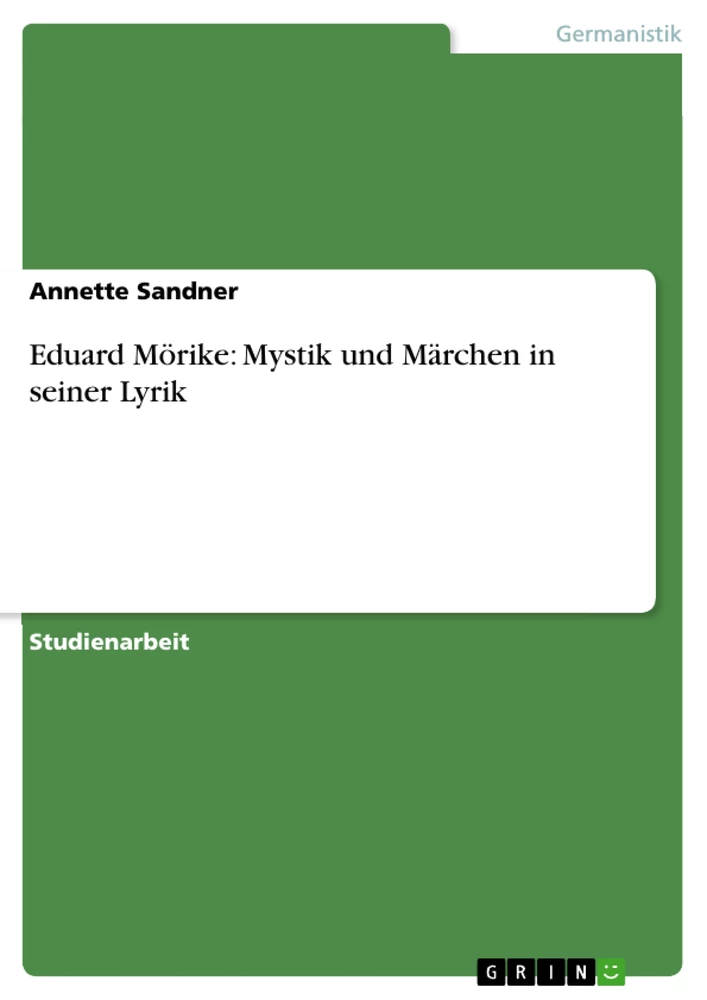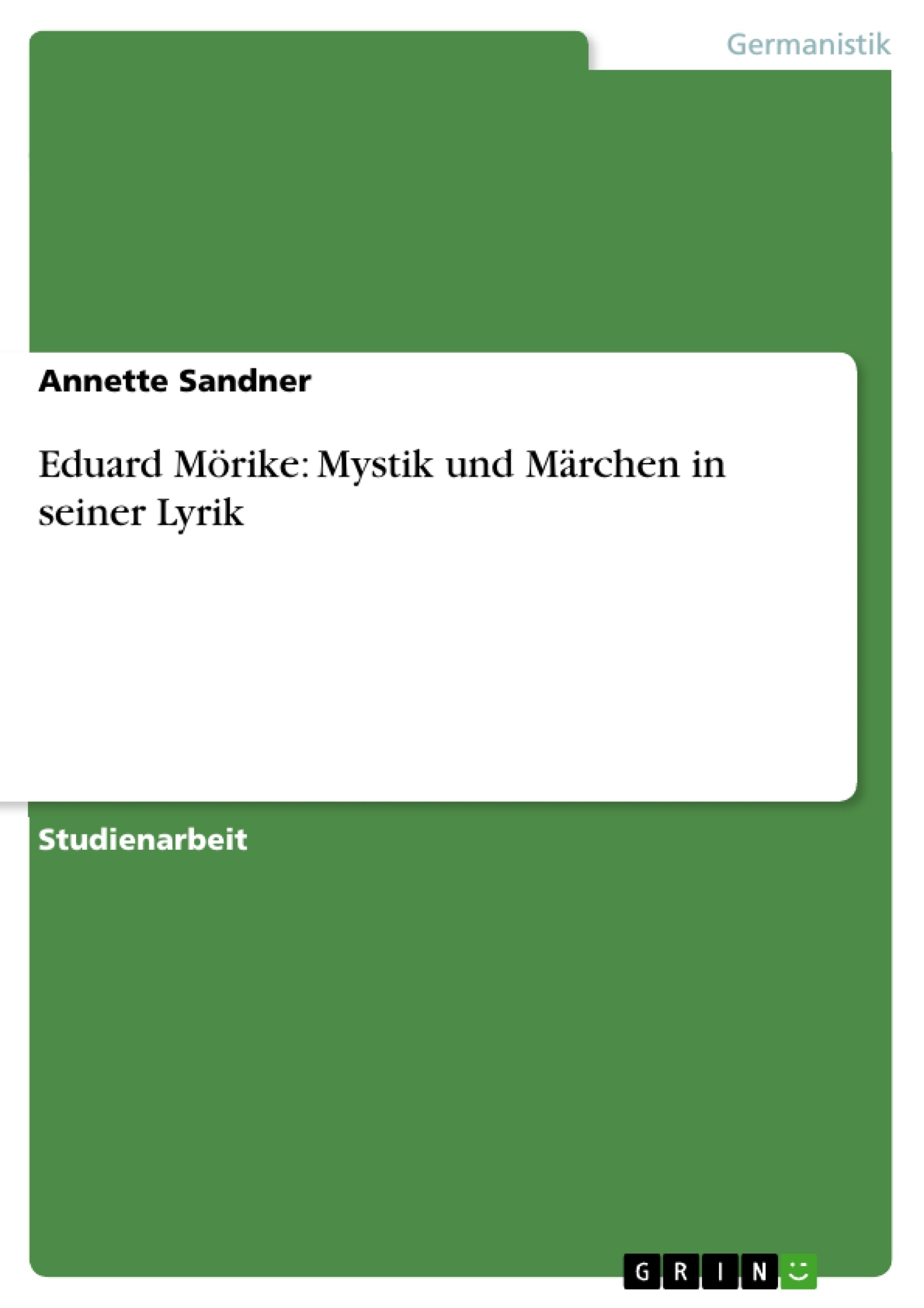In den letzten Jahrzehnten erfährt die Fiktionalität, Geschichten über Mystisches und Märchenhaftes, sozusagen eine Renaissance. Kobolde und Elfen, Fabelwesen und Phantastisches sind modern, kein Genre von Buch über Film oder Computerspielen ist nicht erfasst von Monstern, Geistern oder Traumwelten. Aber dieses Phänomen ist keine Erfindung der Neuzeit oder Hollywoods. Schon Jahrhunderte, sogar Jahrtausende halten sich Göttersagen, Mythen und anderes, ja früher bestimmten sie sogar das Leben der Menschen mehr als heutzutage, wo derartiges meist nur noch der Unterhaltung dient. Die klassischen Grimmmärchen haben ebenfalls bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts die gleichnamigen Brüder zusammengetragen, sie haben sie keinesfalls erst zu diesem Zeitpunkt erfunden 1. Eduard Mörike hatte persönlich, als auch als Dichter eine besondere Vorliebe für Märchen, zu seinen bekanntesten sind zum Beispiel „Das Stuttgarter Hutzelmännlein“ zu zählen, in dem die Geschenke eines Kobolds an den Schustergesellen Seppe eine wichtige Rolle spielen 2 , auch seine Märchennovelle „Der Schatz“ kann hier erwähnt werden. In seinem bekannten Roman „Maler Nolten“ führt Mörike eine ganze Welt phantastischer Wesen und Geschichten ein, die Trauminsel Orplid, die er gemeinsam mit seinem Freund Ludwig Amandus Bauer erdichtet hat, und die von Kobolden, Elfen und Göttern bevölkert ist (vgl. Müller S.11). Aber nicht nur im prosaischen Bereich, auch in der Lyrik taucht bei Mörike immer wieder das Motiv des Märchenhaften, Mystischen auf. „Die Geister am Mummelsee“, der „Gesang Weylas“ oder sein „Elfenlied“ seien hier nur als Beispiele zu nennen. Mörikes Vorliebe für Märchen, die er nicht mit vielen seiner Kollegen und Freunden teilte, brachte ihm von deren Seite jedoch nicht viel Lob entgegen. Man war der Meinung, Mörike solle sich ernsthafteren Stoffen widmen, Politisches aufgreifen. Auf dieses Problem und Mörikes Umgang mit ihm gegenüber geäußerten Vorwürfen soll in dieser Arbeit zunächst genauer eingegangen werden. Im speziellen werden dabei Briefwechsel zwischen ihm und seinen beiden Freunden David Friedrich Strauß und Friedrich Theodor Vischer als Grundlage dienen. Im weiteren Teil der Arbeit werden die mystischen Motive in Mörikes lyrischem Werk betrachtet. Dabei wird im Genaueren die Ballade „Schiffer- und Nixen-Märchen“ behandelt werden, aus der märchenhafte Motive und Bedeutung herauszuarbeiten sind, und ein Interpretationsversuch vorgestellt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Eduard Mörikes märchenhaftes Werk
- Märchenthematik in Mörikes Lyrik
- Exkurs: Mörike zwischen Märchenwelt und Dichterkritik
- Götter, Geister und Elfen in Mörikes Lyrik
- „Gesang Weylas“
- Die Geister am Mummelsee
- „Elfenlied“
- Das Schiffer- und Nixen-Märchen
- Das Element Wasser
- Rolle der Magie
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die märchenhaften Elemente in Eduard Mörikes Lyrik. Sie analysiert die Kritik, die Mörike für seine Verwendung dieser Motive erhielt, insbesondere von seinen Freunden David Friedrich Strauß und Friedrich Theodor Vischer. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Märchhaften für Mörikes Werk und stellt Interpretationsansätze für seine Ballade "Schiffer- und Nixen-Märchen" vor.
- Kritik an Mörikes Verwendung des Märchhaften durch Zeitgenossen
- Die Bedeutung des Märchhaften für Mörikes Werk
- Analyse der Ballade "Schiffer- und Nixen-Märchen"
- Interpretation des Märchhaften in Mörikes Lyrik
- Mörikes künstlerische Eigenständigkeit und seine Abgrenzung von traditionellen Erwartungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet Eduard Mörikes Vorliebe für Märchen und die Kritik, die er dafür erhielt. Es werden die Briefe von David Friedrich Strauß und Friedrich Theodor Vischer zitiert, die sich besorgt über Mörikes "krankhaften Hang zum Märchenhaften" zeigen. Das Kapitel zeigt, wie Mörike diese Kritik aufnahm und sie in seinen Gedichten thematisierte.
Das zweite Kapitel analysiert die Verwendung von märchenhaften Motiven in Mörikes Lyrik, wobei es sich insbesondere auf die Ballade "Schiffer- und Nixen-Märchen" konzentriert. Das Kapitel untersucht die Bedeutung des Elements Wasser, die Rolle der Magie und die Interpretation des Märchhaften in diesem Gedicht.
Schlüsselwörter
Eduard Mörike, Lyrik, Märchen, Mystik, Phantastik, Dichterkritik, David Friedrich Strauß, Friedrich Theodor Vischer, „Schiffer- und Nixen-Märchen“, „Gesang Weylas“, „Die Geister am Mummelsee“, „Elfenlied“, Nürnberger Ware, Interpretation.
- Quote paper
- Annette Sandner (Author), 2006, Eduard Mörike: Mystik und Märchen in seiner Lyrik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/65472