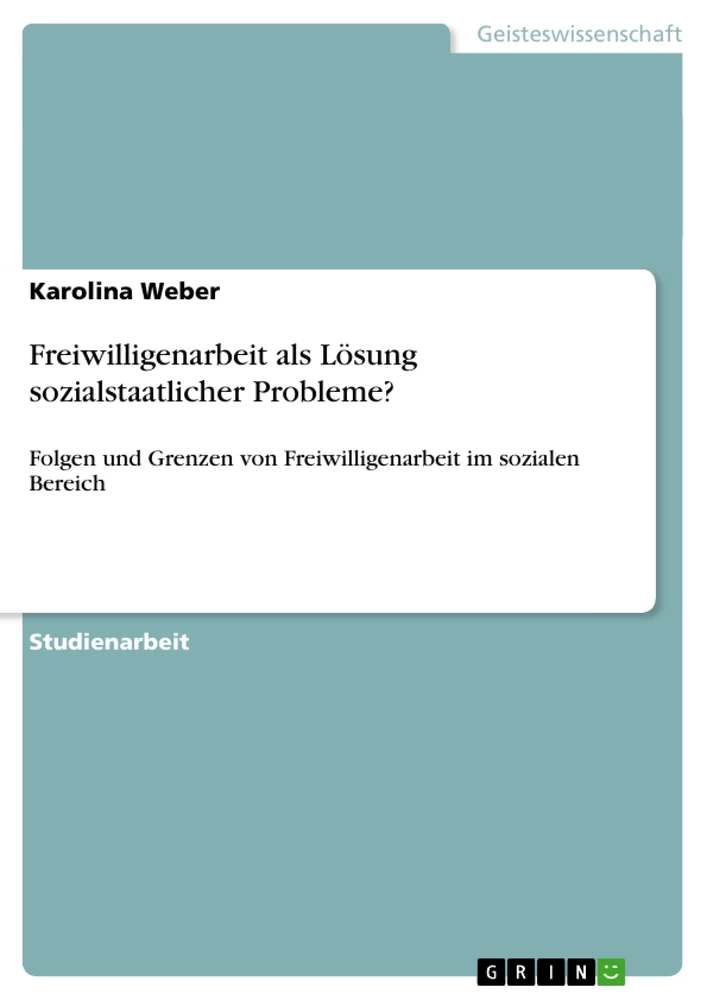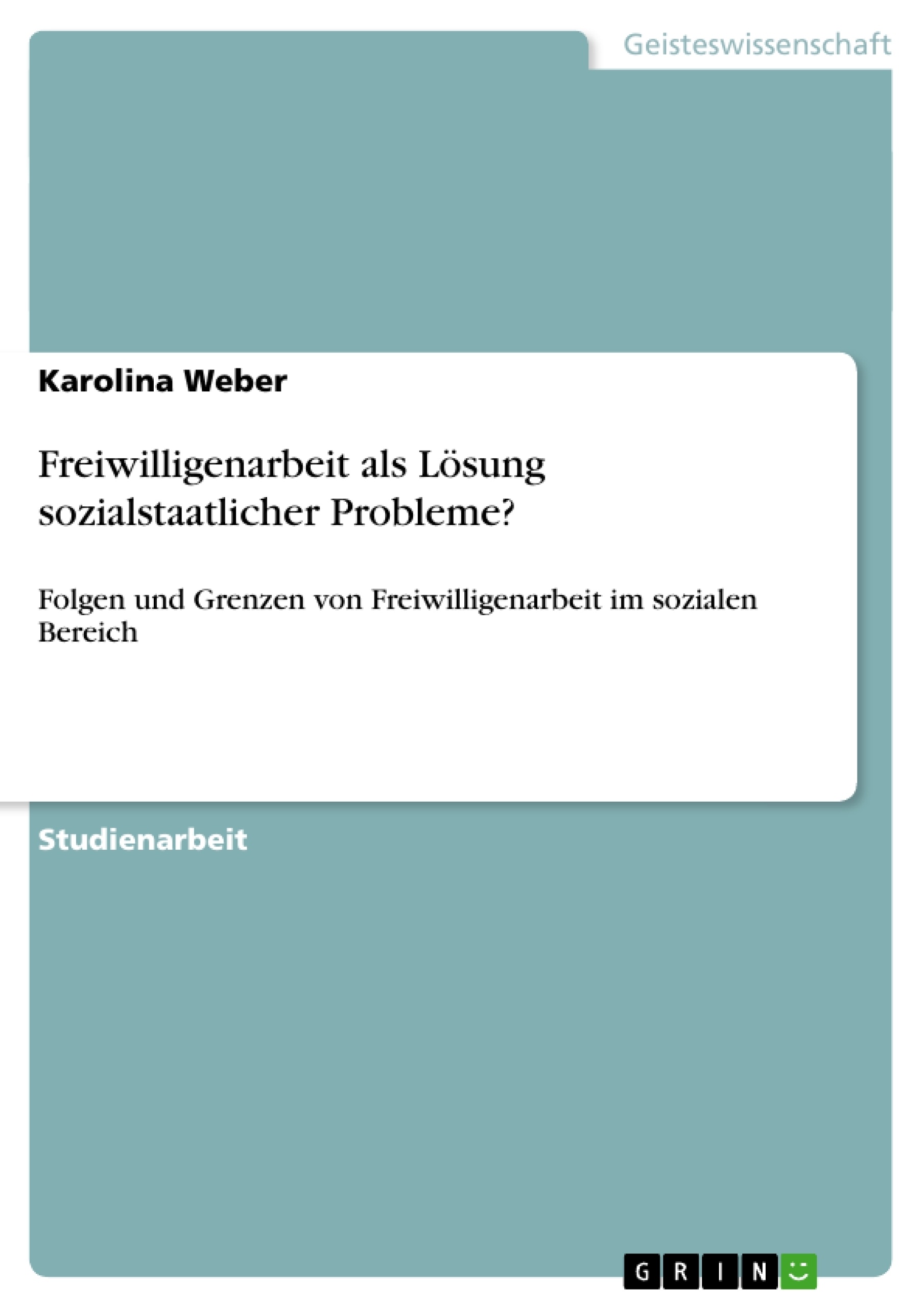Der Sozialstaat steht vor grossen Herausforderungen. Gesellschaftliche Entwicklungen wie der wachsende Anteil an älteren Menschen in der Bevölkerung, die steigende Zahl von Langzeitarbeitslosen und die zunehmenden Kosten für das Gesundheitssystem führen zu immer grösseren Ansprüchen gegenüber dem Sozialstaat. Gleichzeitig erodiert die Anzahl der Erwerbstätigen, die den Sozialstaat finanzieren sollen. Kann der Sozialstaat in Zukunft Unterstützungsbeiträge und Renten für Kranke, alte Menschen, Erwerbslose, Verarmte, Invalide usw. noch finanzieren, wenn deren Zahl stetig steigt?
Kritiker des Sozialstaates bemängeln, der Sozialstaat sei mit seinen Leistungen zu freigiebig, was ihn zunehmend überfordere; da wirksame Kontrollen fehlen, lasse sich nicht verhindern, dass von Sozialleistungen auch nicht anspruchsberechtigte Menschen profitieren; infolge der sich verschärfenden Weltmarktkonkurrenz müsse der Sozialstaat „entschlackt“ werden, wolle man die Konkurrenzfähigkeit und das erreichte Wohlstandsniveau halten. Der Sozialstaat gilt vor allem bei seinen neoliberalen Kritikern als von der ökonomisch-technologischen Entwicklung überholt, als Hemmschuh der Wirtschaft und als grosses Investitionshindernis.
Bürgerschaftliche Argumentationen sind in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts populär geworden, als das Vertrauen in die Integrationskraft des Sozialstaates nach zu lassen schien und neue Modelle der sozialen Sicherung jenseits sozialstaatlicher Regulation gesucht wurden. Eine Sozialstaatskritik ist, dass das sozialstaatliche Sicherungsmodell im Widerspruch zu den emanzipatorischen Ansprüchen des Individuums am Ende des 20 Jahrhunderts stehe und so den pluralisierten Lebensformen nicht mehr gerecht werde. Der Sozialstaat verstaatliche und kollektiviere die Verantwortung für den individuellen Lebenslauf und das Gemeinwohl. Es wird eine bürgernahe Öffnung des Sozialstaates gefordert, welcher sich als Dienstleistungsstaat für die individualisierten Menschen begreifen soll. Der Bürger könne das Gemeinwohl am effizientesten stärken, wenn er Verantwortung für sich selbst und andere übernehme. Ausserhalb des Staatswesens soll aus den bürgerlichen Individualkräften heraus ein neues Gemeinwohl entstehen, in dem die Bürger/innen selbst das aktive regulierende Element sind.
Inhaltsverzeichnis
- Freiwilligenarbeit als Lösung sozialstaatlicher Probleme?
- Einleitung
- Fragestellung
- Aufbau
- Abgrenzungen
- Freiwilligenarbeit
- Begriffsklärung
- Freiwilligenarbeit in der Schweiz
- Der Sozialstaat/Wohlfahrtsstaat
- Definition
- Zur Entwicklung des Sozialstaates
- Kommunitarismus nach Etzioni
- Die Kommunitaristische Bewegung
- Neudefinition des Wohlfahrtsstaates
- Folgen und Grenzen von Freiwilligenarbeit im sozialen Bereich
- Beziehung zwischen `Helfer` und `Hilfeempfänger`
- Freiwilligenarbeit und Geschlecht
- Wandel der Freiwilligenarbeit
- Rekrutierung von Freiwilligen
- Förderung freiwilliger Arbeit
- Schweizerischer Sozialzeitausweis
- Steuerabzug
- AHV-Bonus
- Corporate Volunteering
- Obligatorische Sozialzeit
- Freiwilligenarbeit als Substitut für professionelle Arbeit
- `Protoprofessionalisierung` freiwilliger Arbeit
- Deprofessionalisierung sozialer Berufe
- Community
- Die wachsende Bedeutung der Freiwilligenarbeit im Sozialstaat
- Die Beziehung zwischen staatlicher und zivilgesellschaftlicher Verantwortung
- Die Auswirkungen von Freiwilligenarbeit auf professionelle Arbeit im sozialen Bereich
- Die Grenzen und Risiken von Freiwilligenarbeit
- Die Rolle des Kommunitarismus im Kontext der Sozialstaatskritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Freiwilligenarbeit im Kontext der Herausforderungen des Sozialstaates. Die Autorin hinterfragt die Frage, ob Freiwilligenarbeit eine Lösung für die wachsenden Probleme des Sozialstaates darstellen kann und beleuchtet die Folgen und Grenzen dieser Form des Engagements im sozialen Bereich.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Problematik des Sozialstaates ein und beleuchtet die Kritik an dessen Funktionalität. Die Fragestellung der Arbeit wird definiert und der Aufbau der Arbeit erläutert. Kapitel 2 erklärt den Begriff Freiwilligenarbeit und beschreibt die Situation in der Schweiz. Kapitel 3 definiert den Sozialstaat/Wohlfahrtsstaat und beschreibt seine Entwicklung. Das vierte Kapitel widmet sich der kommunitaristischen Bewegung und Etzioni's Vorstellung eines kommunitaristischen Sozialstaates. Kapitel 5 diskutiert die Folgen und Grenzen von Freiwilligenarbeit im sozialen Bereich, darunter die Beziehung zwischen „Helfern" und „Hilfeempfängern", die Rolle des Geschlechts, der Wandel der Freiwilligenarbeit, Rekrutierung und Förderung sowie die Frage der Substituierung professioneller Arbeit durch Freiwilligenarbeit.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Freiwilligenarbeit, Sozialstaat, Wohlfahrtsstaat, Kommunitarismus, Etzioni, soziale Verantwortung, Folgen, Grenzen, Professionalisierung, Zivilgesellschaft, Substituierung, gesellschaftliche Entwicklungen, Kritik.
- Quote paper
- Karolina Weber (Author), 2005, Freiwilligenarbeit als Lösung sozialstaatlicher Probleme?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/65320