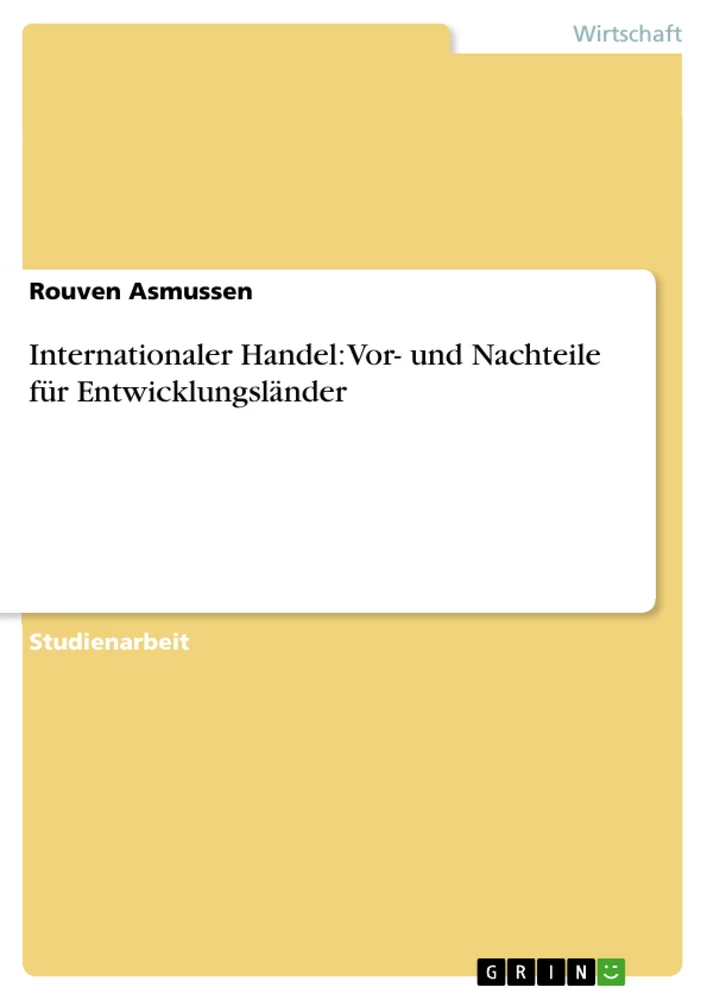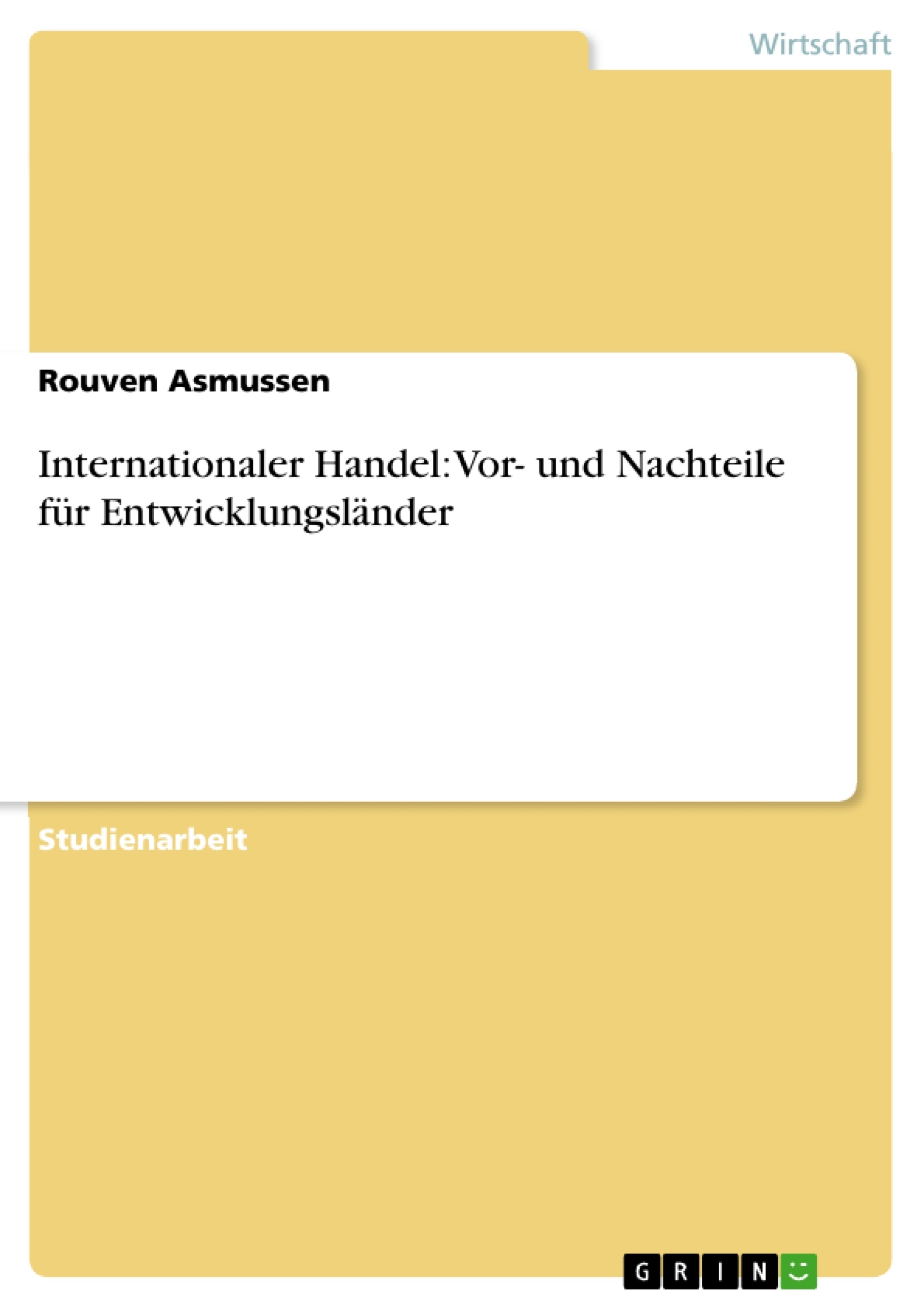Einleitung
Die Frage wie ein Entwicklungsland seinen Status quo verlieren kann, wird schon seit langer Zeit in der Literatur diskutiert. Zum einen gibt es die Handelsoptimisten, die eine Öffnung des jeweiligen Landes für den internationalen Handel fordern. Diese Strategie wird als Exportförderung oder auch als Politik der Handelsliberalisierung bezeichnet und geht mit dem Abbau von Handelshemmnissen (Zölle, Kontingente) einher. Der Exportsektor soll bei dieser Sichtweise als „Entwicklungsmotor“ dienen.
Zum anderen gibt es noch die Handelspessimisten, die diese Sichtweise nicht teilen und stattdessen den Schutz der jeweiligen Wirtschaft durch Handelshemmnisse fordern. Sie sind der Auffassung, dass eine konkurrenzfähige Wirtschaft nur aufgebaut werden kann, wenn diese zumindest temporär geschützt wird. Außerdem behaupten sie, dass Entwicklungsländer überwiegend Nachteile durch den internationalen Handel erfahren. Sie setzten sich daher für eine am Binnenmarkt orientierte Entwicklung ein, die in der Literatur als Importsubstitutionspolitik bezeichnet wird (Vgl. Edwards 1993).
In dieser Arbeit sollen nun die wichtigsten Argumente für und wider einer Handelsliberalisierung aufgeführt und erläutert werden. Dabei bezieht sich die Argumentation auf den Gütermarkt. Die Wirkungen, die von den Kapitalmärkten ausgehen, können im Rahmen dieser Hausarbeit nicht berücksichtigt werden.
Als erstes erfolgt eine Einordnung des Begriffs „Entwicklungsland“, um von einer einheitlichen Grundlage ausgehen zu können. Danach werden verschiedene Vorteile des internationalen Handels für Entwicklungsländer angeführt. Schwerpunkt bildet dabei die Theorie der komparativen Kostenvorteile, die bereits aus der klassischen Handelstheorie bekannt ist. Darüber hinaus wird auf die Exportförderung und die wohlfahrttheoretischen Wirkungen von Handelshemmnissen eingegangen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Klassifizierungsansätze des Begriffs „Entwicklungsland“
- Internationaler Handel
- Vorteile für Entwicklungsländer
- Nutzung komparativer Kostenvorteile
- Exportförderung als „Engine of Growth“
- Handelshemmnisse und Wohlfahrtswirkung
- Nachteile für Entwicklungsländer
- Infant Industry Argument
- Prebisch-Singer-These
- Verelendungswachstum
- Ungleicher Tausch
- Instabilität der Exportpreise
- Ungleiche Machtverteilungen
- Kontereffekte
- Auswirkungen auf die Beschäftigung
- Fallstudie Südkorea
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Auswirkungen der internationale Handel auf die wirtschaftliche Entwicklung von Ländern hat, die als „Entwicklungsländer“ bezeichnet werden. Die Arbeit analysiert sowohl die Vorteile als auch die Nachteile des internationalen Handels für Entwicklungsländer und betrachtet verschiedene Theorien und Argumente, die diese Positionen vertreten.
- Vorteile des internationalen Handels für Entwicklungsländer
- Nachteile des internationalen Handels für Entwicklungsländer
- Theoretische Modelle und Konzepte des internationalen Handels
- Die Rolle von Exportförderung und Importsubstitution
- Die Fallstudie Südkoreas als Beispiel für die Entwicklung eines Entwicklungslandes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des internationalen Handels für Entwicklungsländer vor und führt die beiden gegensätzlichen Positionen, die Handelsoptimisten und die Handelspessimisten, ein. Kapitel 2 bietet eine Definition des Begriffs „Entwicklungsland“ und analysiert verschiedene Klassifizierungsansätze. Kapitel 3 untersucht die Vorteile des internationalen Handels für Entwicklungsländer, insbesondere die Theorie der komparativen Kostenvorteile, die Rolle der Exportförderung und die Auswirkungen von Handelshemmnissen. In Kapitel 4 werden die wichtigsten Argumente gegen den internationalen Handel aus Sicht der Entwicklungsländer dargestellt, darunter das Infant Industry Argument, die Prebisch-Singer-These und das Konzept des Verelendungswachstums. Kapitel 5 analysiert die Beschäftigungswirkung des internationalen Handels, während Kapitel 6 die Fallstudie Südkorea präsentiert und untersucht, wie eine Kombination aus Importsubstitution und Exportförderung zum Wirtschaftswachstum Südkoreas beigetragen hat.
Schlüsselwörter
Entwicklungsländer, internationaler Handel, Handelsliberalisierung, Exportförderung, Importsubstitution, komparative Kostenvorteile, Infant Industry Argument, Prebisch-Singer-These, Verelendungswachstum, Ungleicher Tausch, Machtverteilung, Kontereffekte, Beschäftigung, Fallstudie Südkorea.
- Quote paper
- Rouven Asmussen (Author), 2002, Internationaler Handel: Vor- und Nachteile für Entwicklungsländer, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/649