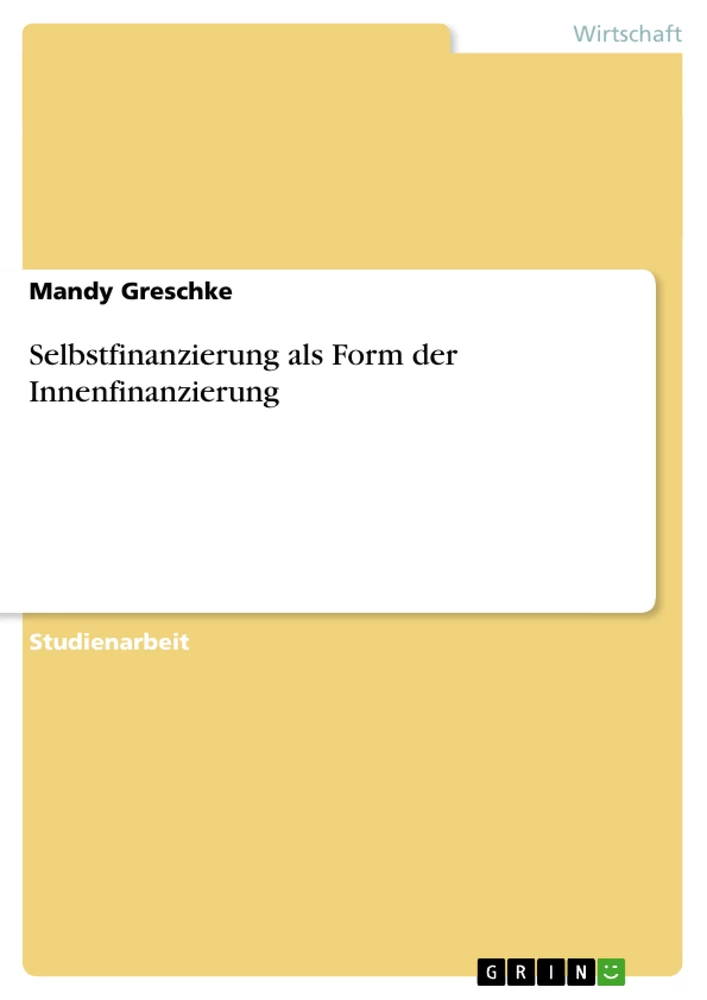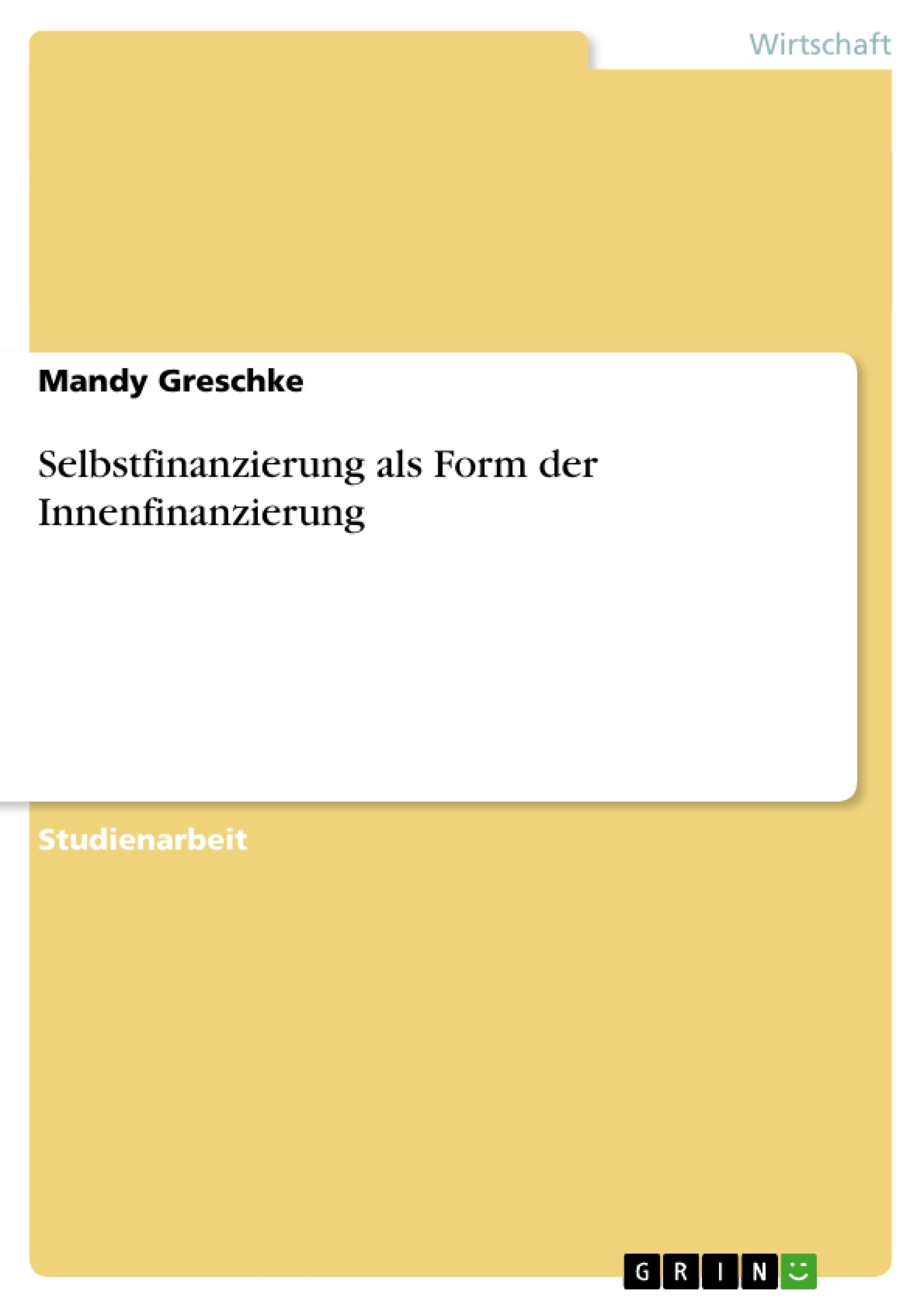Der Begriff Finanzierung hat sich im Laufe der Zeit von einem relativ eng gefassten, bis zu einem sehr umfassenden Finanzierungsbegriff, wie er heute in der neueren Literatur und in der Praxis Anwendung findet, weiterentwickelt. Zunächst verstand man unter Finanzierung im engsten Sinne die Kapitalbeschaffung durch Ausgabe von Wertpapie-ren. Schließlich erweiterte sich der Finanzierungsbegriff auf Kapital-rückzahlung (Zins- und Dividendenzahlungen) und Kapitalumschichtung (Kapitalstruktur = Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital).
Heute bedeutet Finanzierung, die Gestaltung aktueller und potentieller Zahlungsströme zur Deckung des Kapitalbedarfs der Unternehmung. Sie umfasst somit alle Maßnahmen, die der Versorgung eines Unter-nehmens mit Kapital sowie dessen optimaler Strukturierung dienen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Innenfinanzierung
- Selbstfinanzierung
- Voraussetzungen der Selbstfinanzierung
- Formen der Selbstfinanzierung
- Die offene Selbstfinanzierung
- Die stille Selbstfinanzierung
- Selbstfinanzierung und Besteuerung bei der AG
- Möglichkeiten der offenen Selbstfinanzierung
- Gewerbeertragssteuer
- Gewinnthesaurierung
- Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln
- Dividendenkapitalerhöhung
- Kritischer Grenz-Einkommensteuersatz
- Vor- und Nachteile der Selbstfinanzierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Selbstfinanzierung als eine Form der Innenfinanzierung. Ziel ist es, die verschiedenen Aspekte der Selbstfinanzierung, ihre Voraussetzungen, Formen und Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung zu beleuchten. Dabei werden sowohl die Vorteile als auch die Nachteile dieser Finanzierungsmethode betrachtet.
- Definition und Abgrenzung der Selbstfinanzierung
- Formen der Selbstfinanzierung (offene und stille Selbstfinanzierung)
- Steuerliche Auswirkungen der Selbstfinanzierung
- Vorteile und Nachteile der Selbstfinanzierung im Vergleich zu anderen Finanzierungsformen
- Bedeutung der Selbstfinanzierung für die Unternehmensstabilität und -entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Finanzierung ein und erläutert die Entwicklung des Finanzierungsbegriffs von einer engen bis hin zu einer umfassenden Definition. Sie beschreibt Finanzierung als die Gestaltung aktueller und potentieller Zahlungsströme zur Deckung des Kapitalbedarfs eines Unternehmens und umfasst alle Maßnahmen zur optimalen Kapitalversorgung und -strukturierung.
Innenfinanzierung: Dieses Kapitel definiert Innenfinanzierung als die Verwendung von Gewinn-, Abschreibungs- und Rückstellungsgegenwerten zur Umwandlung gebundenen Kapitals in liquide Mittel für Investitionen, ohne externe Kapitalzufuhr. Es werden zwei notwendige Bedingungen genannt: ein Zufluss liquider Mittel und das Fehlen auszahlungswirksamer Aufwendungen in der gleichen Periode. Die Kapitel beschreibt auch verschiedene Formen und Ziele der Innenfinanzierung, die eine optimale Kombination von Maßnahmen zum Ausschöpfen des Innenfinanzierungspotentials und zur Steigerung der Unternehmensrentabilität anstreben.
Selbstfinanzierung: Das Kapitel beschreibt Selbstfinanzierung als die Finanzierung aus einbehaltenen Gewinnen. Die Eigenkapitalgeber verzichten auf die Entnahme oder Ausschüttung des Gewinns, der stattdessen zur Bildung von Rücklagen verwendet wird und das Eigenkapital erhöht. Es werden offene und stille Formen der Selbstfinanzierung unterschieden. Die Diskussion der Selbstfinanzierung im Kontext der Aktiengesellschaft (AG) beinhaltet unterschiedliche Methoden der offenen Selbstfinanzierung, wie beispielsweise Gewinnthesaurierung und Kapitalerhöhungen, und deren steuerliche Implikationen, einschließlich Gewerbeertragssteuer und kritischer Grenzsteuersätze. Die Vor- und Nachteile der Selbstfinanzierung werden gegeneinander abgewogen, um deren Bedeutung für die Unternehmensfinanzierung darzulegen.
Schlüsselwörter
Selbstfinanzierung, Innenfinanzierung, Gewinnthesaurierung, Kapitalerhöhung, Eigenkapital, Steuerbelastung, Unternehmensfinanzierung, Investitionen, Liquidität, Rentabilität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Selbstfinanzierung als Form der Innenfinanzierung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der Selbstfinanzierung als eine spezifische Methode der Innenfinanzierung. Sie analysiert verschiedene Aspekte der Selbstfinanzierung, einschließlich ihrer Voraussetzungen, Formen und Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Dabei werden sowohl Vorteile als auch Nachteile dieser Finanzierungsform im Detail untersucht.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Definition und Abgrenzung der Selbstfinanzierung; Formen der Selbstfinanzierung (offene und stille Selbstfinanzierung); Steuerliche Implikationen der Selbstfinanzierung; Vergleich der Vor- und Nachteile der Selbstfinanzierung mit anderen Finanzierungsformen; Bedeutung der Selbstfinanzierung für die Unternehmensstabilität und -entwicklung.
Was versteht man unter Innenfinanzierung?
Innenfinanzierung wird definiert als die Verwendung von internen Ressourcen wie Gewinnen, Abschreibungen und Rückstellungen zur Umwandlung gebundenen Kapitals in liquide Mittel für Investitionen, ohne dass zusätzliche externe Kapitalzufuhr erforderlich ist. Zwei wesentliche Bedingungen sind ein Zufluss liquider Mittel und das Fehlen auszahlungswirksamer Aufwendungen im selben Zeitraum.
Wie wird Selbstfinanzierung definiert?
Selbstfinanzierung wird als die Finanzierung aus einbehaltenen Gewinnen beschrieben. Die Eigenkapitalgeber verzichten auf die Auszahlung des Gewinns, der stattdessen zur Bildung von Rücklagen verwendet und somit das Eigenkapital erhöht wird. Es werden offene und stille Formen der Selbstfinanzierung unterschieden.
Welche Formen der Selbstfinanzierung werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen offener und stiller Selbstfinanzierung. Die offene Selbstfinanzierung ist deutlich erkennbar, während die stille Selbstfinanzierung weniger transparent ist. Im Kontext von Aktiengesellschaften (AG) werden spezifische Methoden der offenen Selbstfinanzierung wie Gewinnthesaurierung und Kapitalerhöhungen behandelt.
Welche steuerlichen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die steuerlichen Implikationen der Selbstfinanzierung, insbesondere für Aktiengesellschaften. Hierzu gehören die Gewerbeertragssteuer, die Auswirkungen der Gewinnthesaurierung und der kritische Grenz-Einkommensteuersatz im Zusammenhang mit Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln und Dividendenkapitalerhöhungen.
Welche Vor- und Nachteile der Selbstfinanzierung werden diskutiert?
Die Arbeit analysiert sowohl die Vorteile (z.B. Stärkung der Eigenkapitalbasis, Unabhängigkeit von externen Kapitalgebern) als auch die Nachteile (z.B. begrenzte Finanzierungskapazität, potenziell geringere Wachstumsgeschwindigkeit) der Selbstfinanzierung im Detail und setzt diese in Relation zu anderen Finanzierungsmethoden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Selbstfinanzierung, Innenfinanzierung, Gewinnthesaurierung, Kapitalerhöhung, Eigenkapital, Steuerbelastung, Unternehmensfinanzierung, Investitionen, Liquidität und Rentabilität.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Innenfinanzierung und Selbstfinanzierung (mit Unterkapiteln zu den verschiedenen Aspekten der Selbstfinanzierung) und ein Fazit. Sie enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Auflistung der Schlüsselwörter.
- Quote paper
- Mandy Greschke (Author), 2004, Selbstfinanzierung als Form der Innenfinanzierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/64653