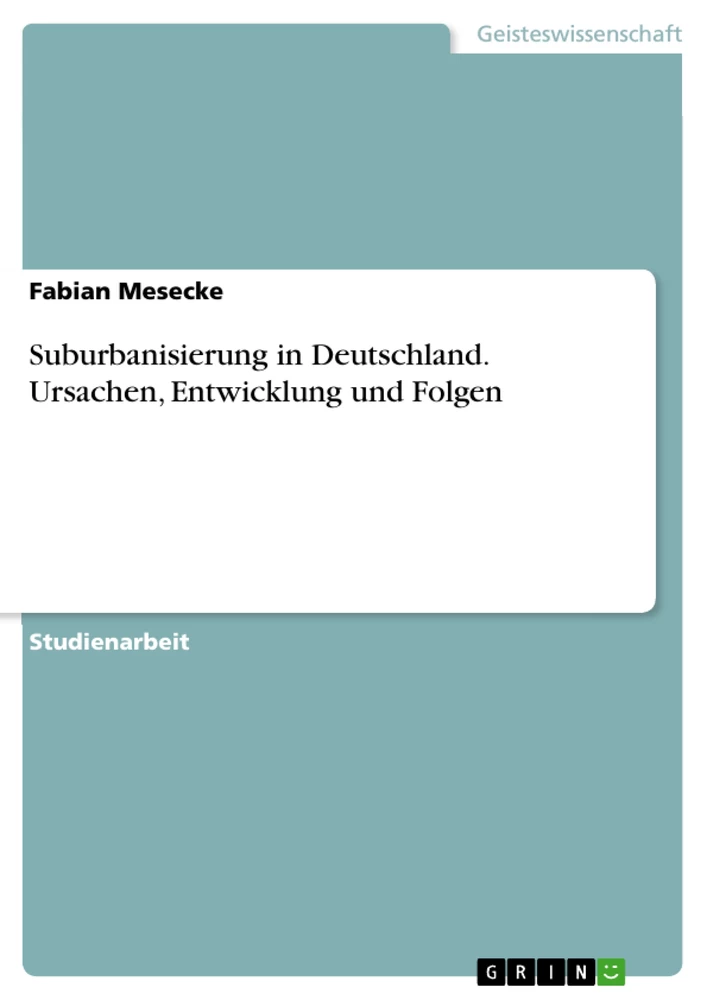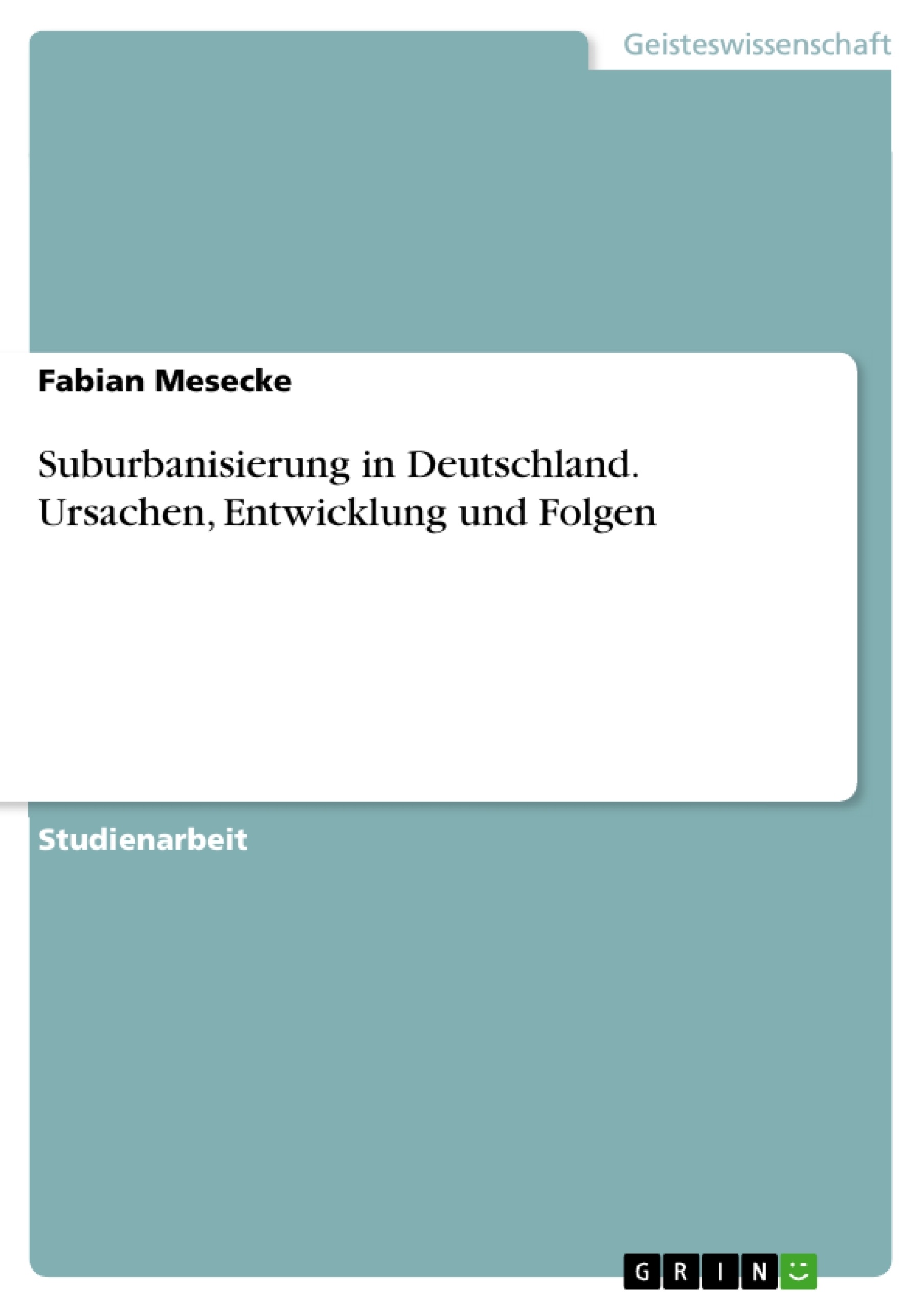Am 14. Juli dieses Jahres beschloss die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf, durch den die Eigenheimzulage für Neuverträge vom kommenden Jahr an komplett gestrichen werden soll. Dies löste den zu erwartenden Protest der Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter des Baugewerbes aus, die negative wirtschaftliche Folgen für den Bausektor befürchten. Umweltverbände begrüßten die Streichung dieser Subvention hingegen, da diese ohnehin nur die zunehmende Flächenversiegelung und Zersiedelung der ländlichen Gebiete fördere. Der Eigenheimzulage wird also eine Wirkung unterstellt, deren Folgen unterschiedlich bewertet werden. So soll sie die Entstehung von Eigenheimen fördern, womit eine Ausdehnung der Siedlungen im Umland der Ballungszentren verbunden ist. Doch ob diese Einzelsubvention wirklich zusätzliche Bautätigkeit erzeugt und somit einen Effekt auf die Siedlungsexpansion hat, ist offen. Im Folgenden sollen nicht die Wirkungen dieser Einzelsubvention evaluiert werden. Vielmehr geht es um die Frage, ob der Prozess der Stadt-Umland-Wanderung überhaupt steuerbar ist. Dies erfordert zunächst eine Begriffsbestimmung und die Betrachtung des Prozesses der Suburbanisierung. Im dritten Kapitel werden dann die Ursachen der Stadt-Umland-Wanderung dargestellt. Anschließend wird die Entwicklung in Deutschland aufgezeigt. Diese beginnt mit der Industrialisierung Preußens im 19. Jahrhundert und endet im heutigen wiedervereinigten Deutschland. Im fünften Kapitel werden die ökonomischen, soziostrukturellen und ökologischen Folgen des Suburbanisierungsprozesses thematisiert. Die daraus resultierenden Probleme erfordern Gegenmaßnahmen. Eine Auswahl von sinnvollen Möglichkeiten der Gegensteuerung wird abschließend präsentiert und im Einzelnen erläutert. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zum Begriff der Suburbanisierung
- 2.1 Formen der Suburbanisierung
- 2.2 Sonderformen der Suburbanisierung
- 3. Die Ursachen der Suburbanisierung
- 4. Die Entwicklung der Suburbanisierung in Deutschland
- 4.1 Von der Industrialisierung bis zur Nachkriegszeit
- 4.2 Die 60er und 70er Jahre
- 4.3 Die 80er und 90er Jahre
- 4.4 Die Entwicklung in Ostdeutschland
- 5. Die Folgen und Probleme des Suburbanisierungsprozesses
- 5.1. Die ökonomischen Folgen
- 5.2 Die soziostrukturellen Folgen
- 5.3 Die ökologischen Folgen
- 6. Gegensteuerungsmöglichkeiten
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Suburbanisierung in Deutschland. Sie untersucht die Ursachen, die Entwicklung und die Folgen dieses Prozesses, der durch die Verlagerung von Bevölkerung und Nutzungen aus den Städten in das Umland gekennzeichnet ist.
- Begriffsdefinition und Formen der Suburbanisierung
- Ursachen der Suburbanisierung
- Entwicklung der Suburbanisierung in Deutschland
- Ökonomische, soziostrukturelle und ökologische Folgen
- Möglichkeiten der Gegensteuerung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den aktuellen politischen Kontext der Suburbanisierung beleuchtet und die Frage nach der Steuerbarkeit des Prozesses aufwirft. Das zweite Kapitel definiert den Begriff der Suburbanisierung und unterscheidet verschiedene Formen und Sonderformen des Prozesses. Im dritten Kapitel werden die Ursachen der Suburbanisierung erläutert, während Kapitel vier die Entwicklung der Suburbanisierung in Deutschland von der Industrialisierung bis in die Gegenwart betrachtet. Kapitel fünf beleuchtet die ökonomischen, soziostrukturellen und ökologischen Folgen des Suburbanisierungsprozesses. Abschließend werden in Kapitel sechs Möglichkeiten der Gegensteuerung aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Suburbanisierung, Stadt-Umland-Wanderung, Stadtentwicklung, Stadtregion, Industrialisierung, Bevölkerung, Nutzungen, ökonomische Folgen, soziostrukturelle Folgen, ökologische Folgen, Gegensteuerung.
- Quote paper
- Fabian Mesecke (Author), 2004, Suburbanisierung in Deutschland. Ursachen, Entwicklung und Folgen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/64380