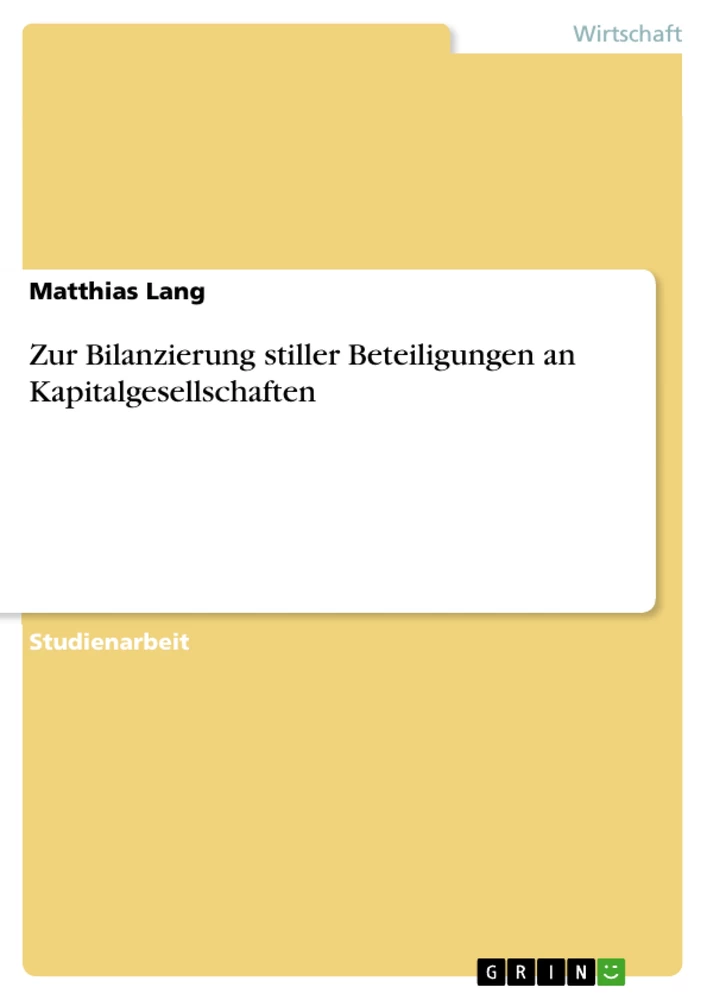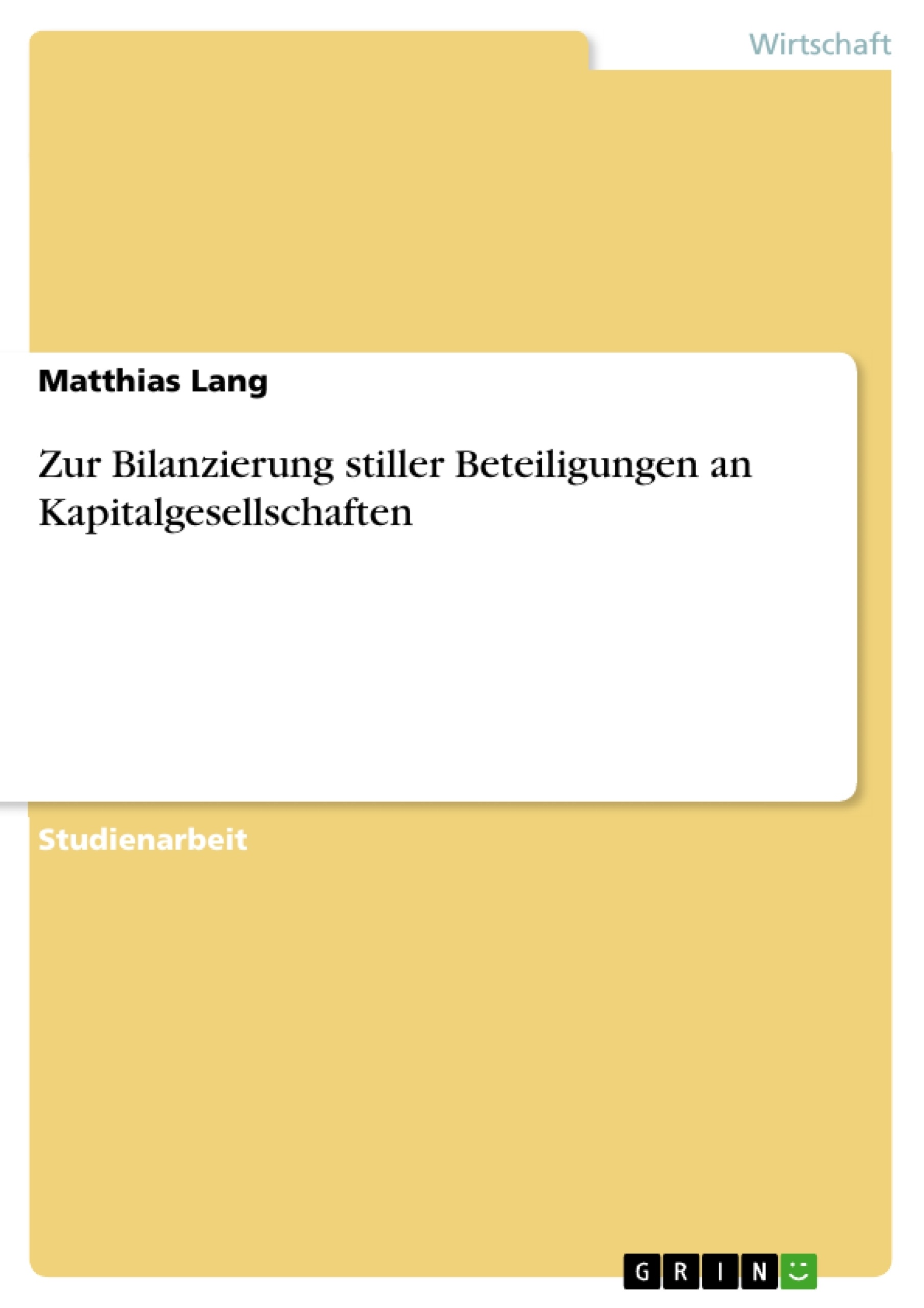Infolge der in Deutschland im internationalen Vergleich geringen Eigenkapitalquote und den daraus resultierenden Schwierigkeiten bei der Kreditvergabe, hervorgerufen durch die „Basel II“ Kriterien, gewinnen alternative Finanzinstrumente an Bedeutung. Hierzu zählt auch die stille Beteiligung, welche aufgrund ihres Wesens als Misch-form von Eigen- und Fremdkapital zu den Mezzanine Finanzinstrumenten. Diese Instrumente sind teilweise auch als hybride Finanzinstrumente bekannt.
Die stille Beteiligung wirft aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu den hybriden Finanzinstrumente einige Fragen bezüglich der Bilanzierung als Eigen- oder Fremdkapital auf. Im folgenden wird auf dieses Problem eingegangen, wobei die Bilanzierung nach nationalen und internationalen Rechnungslegungsvorschriften Betrachtung finden wird. Nicht Teil dieser Arbeit ist die Erörterung der Bewertung der Einlage sowie die Vergütungsansprüche des stillen Gesellschafters, da dies nicht im Rahmen dieser Arbeit abschliessend behandelt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Begriffsdefinition und Problemstellung der Arbeit
- 1.1 Begriff der stillen Gesellschaft
- 1.2 Begriff der Kapitalgesellschaft
- 1.3 Abgrenzung der stillen Beteiligung zu ähnlichen Finanzierungsinstrumenten
- 2. Zur Bilanzierung stiller Beteiligungen an Kapitalgesellschaften
- 2.1 Bilanzierung nach HGB
- 2.1.1 Abgrenzung von Eigenkapital und Fremdkapital nach HGB
- 2.1.2 Ausweis der stillen Beteiligung nach HGB
- 2.2 Bilanzierung nach IFRS (IAS)
- 2.2.1 Abgrenzung von Eigenkapital und Fremdkapital nach IFRS (IAS)
- 2.2.2 Ausweis der stillen Beteiligung nach IFRS (IAS)
- 2.3 Bilanzierung nach US-GAAP
- 2.3.1 Abgrenzung von Eigenkapital und Fremdkapital nach US-GAAP
- 2.3.2 Ausweis der stillen Beteiligung nach US-GAAP
- 3. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Bilanzierung stiller Beteiligungen an Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung nationaler (HGB) und internationaler Rechnungslegungsstandards (IFRS und US-GAAP). Ziel ist es, die verschiedenen Behandlungsweisen im Hinblick auf die Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapital und den Ausweis in der Bilanz zu beleuchten.
- Begriff der stillen Gesellschaft und deren Abgrenzung zu anderen Finanzierungsinstrumenten
- Bilanzierung stiller Beteiligungen nach HGB
- Bilanzierung stiller Beteiligungen nach IFRS (IAS)
- Bilanzierung stiller Beteiligungen nach US-GAAP
- Vergleich der Bilanzierungsmethoden nach HGB, IFRS und US-GAAP
Zusammenfassung der Kapitel
1. Begriffsdefinition und Problemstellung der Arbeit: Diese Einleitung führt in das Thema der stillen Beteiligung ein und begründet deren Bedeutung im Kontext der geringen Eigenkapitalquote in Deutschland und der „Basel II“ Kriterien. Sie stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit dar: die Bilanzierung stiller Beteiligungen als Eigen- oder Fremdkapital nach unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards. Die Arbeit konzentriert sich auf die Bilanzierung und schließt die detaillierte Erörterung der Bewertung der Einlage und Vergütungsansprüche des stillen Gesellschafters aus.
Schlüsselwörter
Stille Beteiligung, Kapitalgesellschaft, Bilanzierung, HGB, IFRS, US-GAAP, Eigenkapital, Fremdkapital, Mezzanine-Finanzierung, hybride Finanzinstrumente, Rechnungslegung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Bilanzierung stiller Beteiligungen an Kapitalgesellschaften
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit der Bilanzierung stiller Beteiligungen an Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung der Rechnungslegungsstandards HGB, IFRS und US-GAAP. Im Fokus steht die Behandlung stiller Beteiligungen als Eigen- oder Fremdkapital und deren Ausweis in der Bilanz.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Begriffsdefinition der stillen Gesellschaft und deren Abgrenzung zu anderen Finanzierungsinstrumenten. Sie untersucht die Bilanzierung stiller Beteiligungen nach HGB, IFRS und US-GAAP und vergleicht die jeweiligen Methoden. Die Einleitung begründet die Bedeutung des Themas im Kontext geringer Eigenkapitalquoten in Deutschland und der „Basel II“ Kriterien.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Begriffsdefinition und Problemstellung, zur Bilanzierung nach HGB, IFRS und US-GAAP (inkl. Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapital für jeden Standard) und zu einer abschließenden Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Abschnitte.
Welche Rechnungslegungsstandards werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die drei wichtigen Rechnungslegungsstandards: HGB (Handelsgesetzbuch), IFRS (International Financial Reporting Standards) und US-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).
Welche zentrale Fragestellung wird untersucht?
Die zentrale Frage ist, wie stille Beteiligungen unter den verschiedenen Rechnungslegungsstandards (HGB, IFRS, US-GAAP) bilanziert werden – als Eigen- oder Fremdkapital.
Was wird in der Zusammenfassung der Kapitel beschrieben?
Die Zusammenfassung der Kapitel fasst die einzelnen Abschnitte zusammen. Das erste Kapitel erläutert die stille Beteiligung und die Problematik ihrer Bilanzierung. Die Arbeit konzentriert sich auf die Bilanzierung und schließt die detaillierte Erörterung der Bewertung der Einlage und Vergütungsansprüche aus.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Stille Beteiligung, Kapitalgesellschaft, Bilanzierung, HGB, IFRS, US-GAAP, Eigenkapital, Fremdkapital, Mezzanine-Finanzierung, hybride Finanzinstrumente, Rechnungslegung.
- Quote paper
- Dipl.-Betriebswirt (FH) Matthias Lang (Author), 2004, Zur Bilanzierung stiller Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/64266