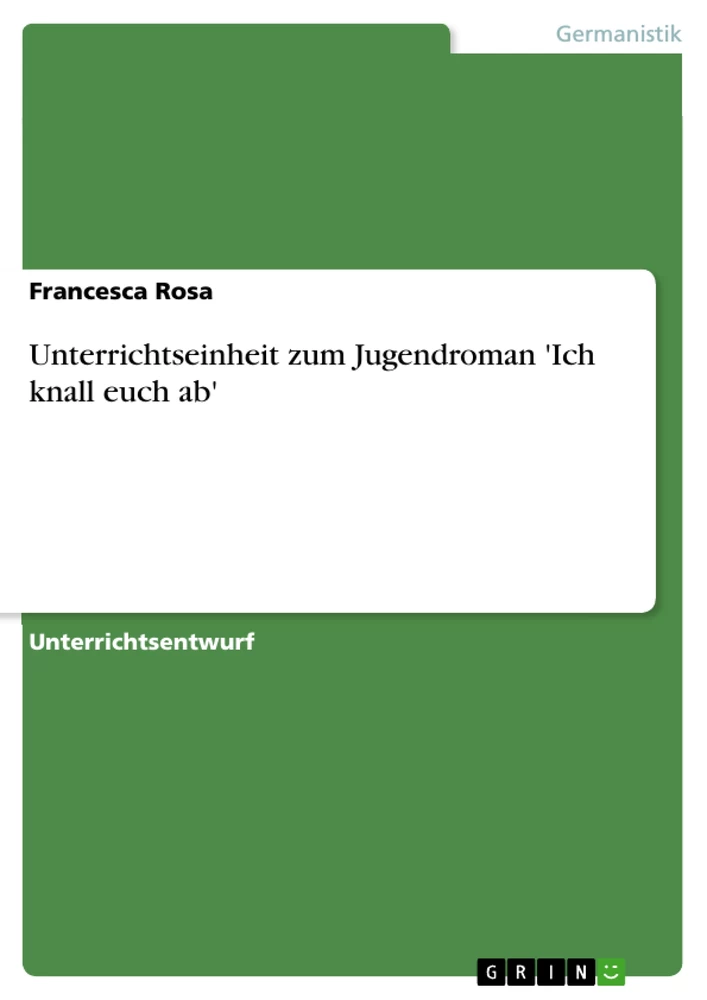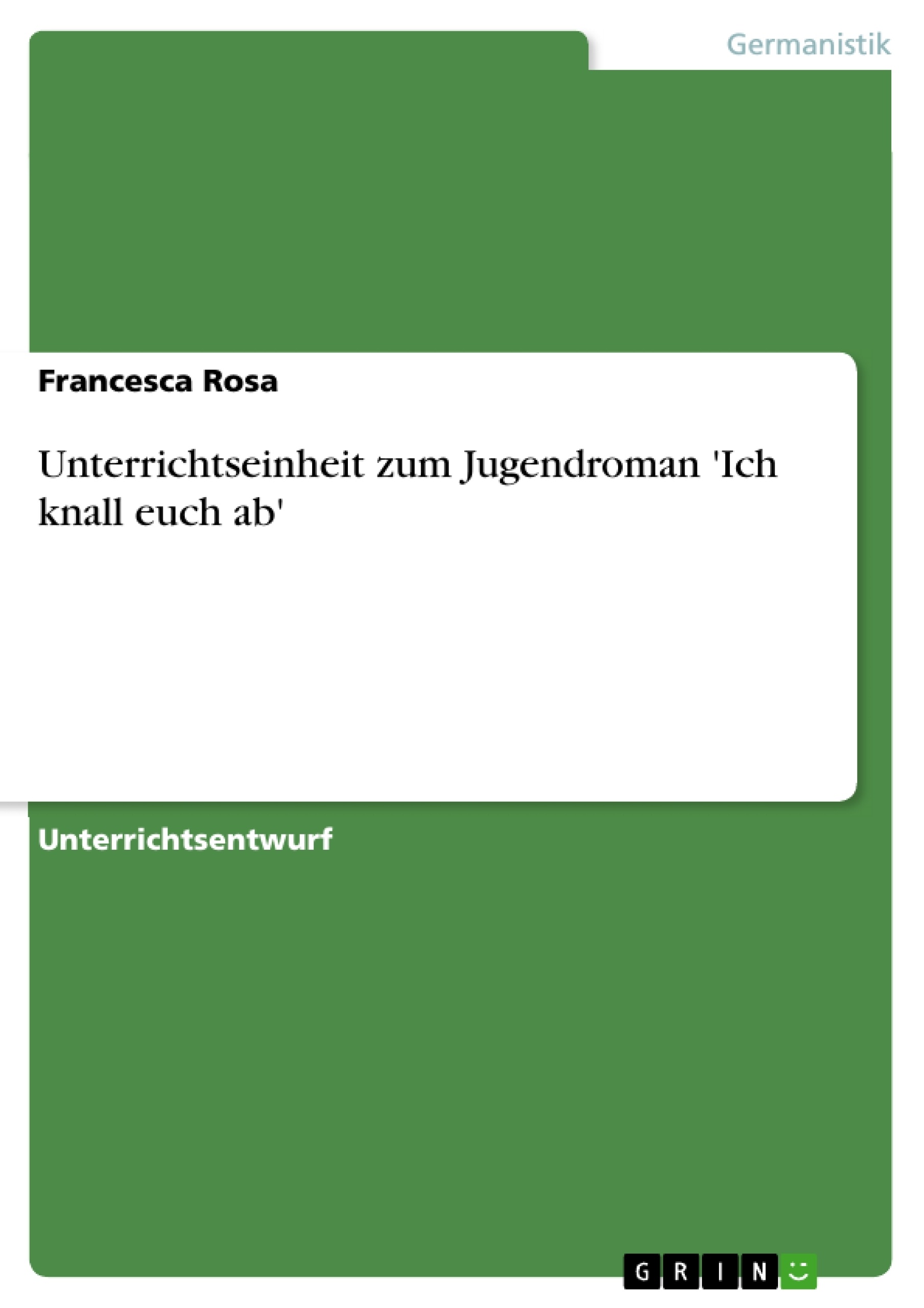Der Umgang mit Texten setzt an die Schülerinnen und Schüler folgendes voraus:
Sie müssen sich die Romanwelt selbstständig erschließen können und diese mit eigenen Erfahrungen verknüpfen. Sie müssen den Inhalt zusammenfassen und ihn wiedergeben. Die herausgearbeiteten Informationen reflektieren, bewerten und diese für sich auch nutzen.
Die wichtigsten Informationen im Text unterstreichen und farbig markieren. Im Anschluss die heraus selektierten Informationen in eigenen Worten wiedergeben und gliedern. Die Schülerinnen und Schüler müssen im Stande sein sich mit fiktionalen oder sachbezogenen Jugendbücher auseinanderzusetzen. Hilfreich ist hier das Recherchieren in verschiedenen Informationsquellen wie Bibliothek, Nachschlagewerk oder Internet. Die Informationen aus dem Internet sollten aber mit Vorsicht zu genießen sein.
Inhaltsverzeichnis
1. Analyse der Lehr- und Lernvoraussetzungen
1.1 Rahmenbedingungen
1.1.1 Lokale Rahmenbedingungen
1.1.2 Anthropologische Rahmenbedingungen
1.1.3 Temporale Rahmenbedingungen
1.2 Lernvoraussetzung
1.2.1 Interesse am Thema
1.2.2 Gruppenklima
1.2.3 Sozialformen
2. Sachanalyse
2.1 Einordnung des Themas in einen fachwissenschaftlichen Zusammenhang
3.1 Bezug zum Bildungsplan
4. Lernzielanalyse
4.1 Grobziele
4.2 Feinziele
5. Methodische Analyse
5.1 Geplante Methodenkonzeption
5.2.1 Einstiegsphase
5.2.2 Erarbeitungsphase II
5.2.3 Auswertung/ Ergebnissicherung
5.2.4 Anwendung
6. Unterrichtsskizze
7. Literaturverzeichnis
8. Anlagen
1. Analyse der Lehr- und Lernvoraussetzungen
1.1 Rahmenbedingungen
1.1.1 Lokale Rahmenbedingungen
Die Oscar-Paret-Schule liegt direkt in der Stadtmitte Freibergs am Neckar. Von der S-Bahnstation sind es etwa 10 Minuten Fußweg. Ein Schulbus fährt direkt bis an die Schule. Die Schulbushaltestelle befindet sich direkt an der Schule. Nur der Schulbus ist befugt bis an die Schule zu fahren. Somit ist die Schule an öffentliche Verkehrsmittel angebunden und für Schülerinnen und Schüler gut erreichbar. Dennoch bevorzugen viele Schülerinnen und Schüler das Fahrrad als Fortbewegungsmittel um ihre Schule zu erreichen. Das Schulgebäude befindet sich in einem verkehrsberuhigten Bereich und grenzt unmittelbar an einem Sportplatz an. Es wirkt freundlich, lebendig und innovativ. Der Pausenhof hingegen ist eher klein und wirkt auf Grund der geringen Anzahl an Bänken und Bäumen etwas kahl.
Die Realschule ist Teil des Schulverbundes aus Hauptschule und Gymnasium. Die Räumlichkeiten sind nicht klar getrennt und es gibt Berührungspunkte. Die Gesamtschule wird von drei Abteilungsleiter der jeweiligen Schulart vertreten. Der Direktor des Gymnasiums vertritt die Oscar-Paret-Schule nach außen.
Die 600 Schülerinnen und Schüler verteilen sich auf 21 Klassen, die von 40 Lehrkräften unterrichtet werden.
Seit dem Schuljahr 2003/2004 sind die Unterrichtsstunden neu gegliedert. Das Unterrichten findet verstärkt in Doppelstunden ab, hierbei fallen die kleinen Pausen zugunsten von zwei großen Pausen weg. ¹1
Die erste Schulstunde findet von 8.05 bis 9.35 Uhr mit einer anschließenden zwanzigminütigen Pause statt. Die zweite Stunde geht von 9.55 bis 11.25 Uhr mit wiederum einer zwanzigminütigen Pause. Die dritte Stunde geht von 11.45 bis 13.15 Uhr und danach ist die Mittagspause. Falls die Schülerinnen und Schüler Mittagsschule haben, geht diese von 14.00 bis 15.30 Uhr bzw. von 15.30 bis 17.00 Uhr. Durch die Doppelstunden soll ein effektiveres Lernen gewährleistet sein. Des weiteren soll Projektarbeit gefördert werden und die Unruhen, welche durch die kleinen Pausen im Schulhaus entstehen, verhindert werden. ²
Das Innenleben der Schule ist sehr farbenfroh gestaltet, überall stehen Vitrinen mit selbst kreierten Projektarbeiten der Schülerinnen und Schüler, aber auch Pinnwände mit Plakaten und Collagen der verschiedenen Klassen, die Einblicke in die Unterrichtsarbeit der Klassen geben.2
Das Klassenzimmer der 9c befindet sich im ersten Stock, der zweistöckigen Schule. Die Klassenzimmer sind meist sehr nüchtern gehalten. Im Klassenzimmer steht ein Overheadprojektor. Die Projektionswand für den Overheadprojektor ist gleichzeitig die Tafel und verhindert dadurch das gleichzeitige Arbeiten mit beiden Medien. Außer einem Overheadprojektor und der Wandtafel sind keine weiteren Medien vorhanden.
An einer Seiten- und der Hinterwand ist ein Regal angebracht, in denen Duden stehen, die bei Bedarf ausgeteilt werden können. Die andere Seitenwand besteht aus einer großen Fensterfront, von der man aber nicht auf den Pausenhof blicken kann, weil die Fenster mit farbiger Fensterfolie zugeklebt sind. Das Klassenzimmer ist mit großen Fenstern versehen, aber weil diese beklebt sind, kommt kein ausreichendes Licht hinein und dies vermindert die Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler. Das Klassenzimmer ist groß, aber dennoch lässt die hohe Anzahl an Schülerinnen und Schüler nur selten Gruppenarbeit zu. Viel zu viele Schülerinnen und Schüler sind in der Klasse.
Nicht allen Schülerinnen und Schüler wird eine gute Sicht auf Tafel und Tageslichtprojektor ermöglicht. Die Entfernung von der Tafel bis in die letzte Reihe ist sehr groß. Insgesamt könnte das Klassenzimmer schülergerechter gestaltet werden. Die leeren Wände bieten viel Platz für Plakate oder sonstige Eigenkreationen der Schüler, auch des Lehrers.
1.1.2 Anthropologische Rahmenbedingungen
Die Klasse 9 c der Oscar-Paret-Realschule besteht aus 31 Schülern. Davon sind fünfzehn weiblich und sechzehn männlich.
Die Schülerinnen und Schüler können ihre Sitzordnung selber gestalten, daher ist sie etwas unstrukturiert und chaotisch. Die Klassenräume sind standardmäßig mit einem Tageslichtprojektor und einer Tafel ausgestattet.
Neben den deutschen Schülern sind Schüler mit Migrationshintergrund, wie zum Beispiel zwei Türken, eine Kroatin, ein russischer Spätaussiedler und ein Halbitaliener vertreten. Der Ausländeranteil ist somit gering. Die Klassengemeinschaft lässt zu Wünschen übrig. Die letzen Schuljahre waren immer wieder von Mobbingübergriffen gekennzeichnet. Es gibt Schüler in der Klasse, die sich so gut wie nie am Unterrichtsgeschehen beteiligen, wiederum andere verhalten sich sehr auffällig.
A.K, ein russischer Spätaussiedler wird nicht nur aufgrund seines Namens gemobbt, sondern auch weil seine Eltern finanziell schwach sind und ihm nicht die Konsumgüter bieten, die in der Klasse von Bedeutung sind. (z.B. teure Klamotten, high-tech Handy, mp3-Player, PC usw.)
Julia ist eine auffällig dominante Persönlichkeit. Sie nimmt jede Gelegenheit, die sich ihr anbietet, um zu provozieren und andere mit sich zu ziehen. Sie muss während des Unterrichts öfters mal ermahnt werden, weil sie den Unterricht stört und andere daran hindert am Unterricht teilzuhaben.
Meiner Meinung nach sollte sie mehr gefordert werden und sie sollte versuchen ihre Launen besser im Griff zu bekommen. Ihre Beiträge, die sich auf den Unterrichtsgegenstand beziehen, sind meist sehr gut und tragen zum weiteren Verlauf der Stunde bei. Der Rest der Klasse lässt sich durch die störenden Kommentare viel zu sehr beeindrucken bzw. ablenken.
Ein weiteres Problem ist, dass unterschiedlich begabte Schülerinnen und Schüler in der 9c aufeinander treffen. Die Altersspanne der 9c erstreckt sich von 14-17 Jahren.
Es gibt Wiederholer und Schüler, die vom Gymnasium kommen. Dann gibt es noch schwache Schüler, die eigentlich an die Hauptschule gehören. Diese sind sehr zielstrebig und bemühen sich die mittlere Reife zu erwerben. Ein Schüler hat einen überdurchschnittlichen IQ. Er weiß von seiner Fähigkeit, kann sie allerdings noch nicht konstruktiv umsetzen. Ihm fällt es schwer dem Unterrichtsgeschehen zu folgen, weil er nicht von klein auf von den Eltern gefördert worden konnte. Der Leistungsstand der Klasse ist als durchschnittlich einzuschätzen. Das arbeiten in Gruppen wurde schon mehrmals durchgeführt, so dass man die Gruppenarbeit in dieser Klasse jederzeit mühelos anwenden kann. Der Lärmpegel ist in der Erarbeitungsphase hoch, deshalb muss für die Auswertungs- und Kontrollphase nach der Erarbeitung in Gruppen mehr Zeit einkalkuliert werden.
1.1.3 Temporale Rahmenbedingungen
Deutsch findet Freitags in der Doppelstunde statt. Die Stunde beginnt um 8.05 Uhr und endet um 9.35 Uhr. Das ist von Vorteil, denn die Schüler sind in diesen Stunden noch nicht erschöpft, so dass sie noch relativ konzentriert und aufmerksam mitarbeiten können. Sie sind zu dem Zeitpunkt noch nicht aufs Wochenende eingestellt, weil sie bis zur Sechsten Stunde Schule haben.
1.2 Lernvoraussetzung
Der Umgang mit Texten setzt an die Schülerinnen und Schüler folgendes voraus:
Sie müssen sich die Romanwelt selbstständig erschließen können und diese mit eigenen Erfahrungen verknüpfen. Sie müssen den Inhalt zusammenfassen und ihn wiedergeben. Die herausgearbeiteten Informationen reflektieren, bewerten und diese für sich auch nutzen.
Die wichtigsten Informationen im Text unterstreichen und farbig markieren. Im Anschluss die heraus selektierten Informationen in eigenen Worten wiedergeben und gliedern. Die Schülerinnen und Schüler müssen im Stande sein sich mit fiktionalen oder sachbezogenen Jugendbücher auseinanderzusetzen. Hilfreich ist hier das Recherchieren in verschiedenen Informationsquellen wie Bibliothek, Nachschlagewerk oder Internet. Die Informationen aus dem Internet sollten aber mit Vorsicht zu genießen sein.3
1.2.1 Interesse am Thema
Die Klasse zeigt große Lernbereitschaft und Interesse am Thema „Gewalt unter Jugendlichen“. Mobbing und aggressives Verhalten treten immer mehr verstärkt im Schulalltag auf. Die Schülerinnen und Schüler können aus eigenen Erfahrungen berichten. Alltagserfahrungen zu diesem Thema treten nicht nur in der Schule auf, sondern auch im Freundeskreis, in der Familie und in den Medien. Die Schüler können mitreden. Die Klasse 9c war schon einmal gezwungen sich mit dem Thema Mobbing auseinanderzusetzen, vor allem als die Mobbinübergriffe in der Klasse zu eskalieren schienen. Gerade in dieser Klasse herrscht Aufklärungsbedarf.
„Der Inhalt spricht die 14- bis 16-jährigen sehr an und ist hoch aktuell, vor allem nach dem erschreckenden Amoklauf vom 26.April 2002 im Erfurter Gutenberg-Gymnasium. Gewalt und aggressive Umgangsformen gehören zu den Alltagserfahrungen vieler Schülerinnen und Schüler. Diese Erfahrungen finden sich in Morton Rhues Buch wieder. Es Roman regt deshalb zur Auseinandersetzung mit der eigenen Situation, aber auch mit den Geschehnissen von Erfurt und vergleichbaren Fällen an.“
1.2.2 Gruppenklima
Die Klassengröße wurde durch das Hinzukommen von Wiederholern erweitert. Der Zusammenhalt der Klasse ist nicht gut. Manche Schüler sträuben sich mit bestimmten Mitschülern zusammenzuarbeiten. Es ist eine sehr lebhafte Klasse, die offensichtlich auch gefordert werden will. Dies wird besonders bei Julia deutlich, die sich meiner Meinung nach unterfordert fühlt und um Aufmerksamkeit zu bekommen, dementsprechend ohne sich zu melden, auf Fragen des Lehrers antwortet.
Die Klassenlehrerin hat ihre Klasse sehr gut unter Kontrolle. Sofort nach der Aufforderung ruhig zu sein klingt Stille ein.
Leider ist es oft so, dass bei der Gruppenarbeit die stärkeren und motivierten SchülerInnen dominieren und die Schwächeren nur dabei sitzen und zusehen, aber das ist in den Schulen keine Seltenheit.
1.2.3 Sozialformen
Die Schüler sind mit allen Sozialformen vertraut. Die Diskussionsrunde bereitet der Klasse keine Schwierigkeiten, gerade die Dominanten der Klasse melden sich oft und bringen es auf den Punkt. Andere wissen nicht so recht zu welchem Zeitpunkt man sich zu Wort melden darf. Manche SchülerInnen zeigen sich noch etwas unsicher. Die Partnerarbeit wird von allen positiv aufgenommen. Die von der Lehrperson gestellten Aufgaben werden weitestgehend erfolgreich umgesetzt und schnell bearbeitet.
2. Sachanalyse
2.1 Einordnung des Themas in einen fachwissenschaftlichen Zusammenhang
Morton Rhues Jugendroman „Ich knall euch ab“ mit dem englischen Titel „Give a Boy a Gun“, ist 2002 im Ravensburger Buchverlag herausgekommen. Der fiktive Roman basiert auf den Amoklauf, der sich vor drei Jahren abgespielt hat.
Bis zum 26.04.2002 galt Littleton/USA als Synonym für den Schrecken des so genannten school shootings, also für Amokläufe Jugendlicher an Schulen. Damals kostete es 15 Tote in der Columbine Highschool: 12 Mitschüler, ein Lehrer und die beiden Attentäter selber. Fast auf den Tag genau drei Jahre später führten die Ereignisse in Erfurt zu einem neuen traurigen Rekord: Im Gebäude des Johannes-Gutenberg-Gymnasiums starben innerhalb kurzer Zeit 17 Menschen, unter ihnen der jugendliche Amokläufer. Bis dahin glaubte man, dass es sich um spezifisches Problem der USA handle. Die Schuld gab man der dortigen freizügigen Waffenkultur. Inzwischen hält dieses Phänomen auch in Deutschland Einzug. Die Täter beschäftigen sich einige Zeit mit dem bevorstehenden Amok-Lauf. Eine mehrtägige Planung geht dem Amok-Lauf voraus. Die Opfer werden bewusst ausgewählt und oftmals existieren sogar Todeslisten. Das zeigt, dass die Vorbereitungsphase einige Tage dauert. Dies gilt auch für den Erfurter Amoklauf, bei dem bewusst Lehrer ausgesucht wurden. In Littleton waren es vor allem sozial und sportlich erfolgreiche Mitschüler, von denen sich die beiden Täter verspottet, verachtet und verhöhnt fühlten. Die jugendlichen Täter fühlen sich ausgegrenzt und rächen sich an einer sie zurückweisenden Welt durch eine Art blutiges Finale, in dem sie dann auch selber untergehen. In Erfurt musste der 19-jährige Täter aufgrund mangelhafter Leistung nicht nur auf sein Abitur verzichten, sondern war dann plötzlich auch ohne Real- und Hauptschulabschluss. Deshalb versuchte er persönlich über das Schulamt und in Kontakt mit anderen Gymnasien seine Schulausbildung doch noch fortzuführen – vergebens. Vor Eltern und Freuden behauptete er auf eine andere Schule zu gehen, drückte sich aber während dieser Zeit in der Innenstadt herum. Als sein Lügengebäude zusammenstürzen musste, spätestens zum Zeitpunkt des Abiturs, an dem er nicht mehr beteiligt war, griff er zur Waffe. Die Eltern glaubten an diesem Tag, er gehe zur Abitursprüfung in Mathematik. Die Aussage dass Jugendliche Amokläufer grundsätzlich aus „kaputten Elternhäusern“ kommen oder „immer isolierte Einzelgänger“ sind, ist falsch. Hierbei handelt es sich um ein psychologisches Puzzle, bei denen zahlreiche Faktoren zusammenspielen können. Außerdem bleibt immer ein Rest Unerklärliches zurück.
Die beiden amerikanischen Schüler Brendan und Gary kommen in der neuen Schule nicht zurecht. Gary zieht mit seiner Mutter in die Kleinstadt Middletown, nachdem sich seine Eltern scheiden lassen haben. Brendan, der an seiner alten Schule ein beliebter Sportler war kann sich nicht in die neue Klasse integrieren und zieht sich deshalb immer mehr zurück. Beide Schüler werden während der drei Jahre, vom 7. bis 10. Schuljahr, immer wieder von den anderen verstoßen und ignoriert. Als Außenseiter finden beide zueinander und eine enge Freundschaft entsteht. Sie versuchen ihre aufgestaute Aggression mit gewaltverherrlichenden Computerspielen vergeblich zu kompensieren. Die Resignation treibt beide in den Tod während eines Attentats auf dem Schulabschlussballes in der Turnhalle. Schwer bewaffnet mit selbst gebastelten Bomben stürmen sie das Fest. Gezielt wird auf Sam geschossen, der die Beiden jahrelang gedemütigt hat. Sie fassen den Entschluss sich an ihren Peinigern zu rächen.
Die Leidensgeschichte der beiden Schüler wird chronologisch erzählt, die die Tatmotive zum Ausdruck bringen. Vor allem die Abschiedsbriefe der beiden Amokläufer geben Auskunft über das, was sie zu diesem Schreckensszenario geführt hat.4
3.1 Bezug zum Bildungsplan
„Im Fach Deutsch ist die deutsche Sprache Unterrichtsgegenstand und Unterrichtsprinzip. So erfahren und erleben die Schülerinnen und Schüler die deutsche Sprache in dreifacher Hinsicht: erstens als Mittel der Welterfassung, zweitens als Mittel der zwischenmenschlichen Verständigung, drittens als Mittel, sich Welten auszumalen und vorzustellen. [...]
Der Deutschunterricht bietet Möglichkeiten zur Identitätsbildung der Mädchen und Jungen und baut die personalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler weiter aus. [...]
Sie üben Gesprächs- und Argumentationsformen ein und entwickeln Konfliktlösungsstrategien. [...]
Beim Lesen von Texten erschließen sich die Schüler und Schülerinnen andere Welten, erweitern ihren Erfahrungshorizont, entfalten Vorstellungen und entwickeln ästhetisches Bewusstsein. In Jugendbüchern finden sie ihre eigenen Probleme und Wünsche wieder, können sich lesend mit sich selbst beschäftigen und Distanz zu sich beziehen und erfahren so Hilfe bei der eigenen Entwicklung der eigenen Identität. [...]“5
4. Lernzielanalyse
4.1 Grobziele
Die Schülerinnen lernen zwei unterschiedlich fiktive Charaktere, die jahrelang gemobbt wurden, sich blind in Gewaltausbrüche stürzen und in „School Schooting“ (Schul-Amok) ausartet..
Amok ist ein überaus seltenes Ereignis, aber völlig ausgeschlossen ist ein so unfassbares Geschehen nirgends und zu keiner Zeit, auch nicht bei uns, wie neuere Blutbäder in der Schweiz und bei uns beweisen.
4.2 Feinziele
Die Schülerinnen und Schüler sollen:
- die Entwicklung der Protagonisten Gary und Brendan herausarbeiten.
- die Motive für den Amok-Lauf reflektieren und beurteilen. Die psychologischen Hintergründe werden analysiert und diskutiert.
- sich überlegen, wie man so etwas hätte verhindern können.
5. Methodische Analyse
5.1 Geplante Methodenkonzeption
Morton Rhues Jugendroman wird sowohl in der Klasse as auch in Einzelarbeit erarbeitet. Voraussetzung dafür ist, dass der Roman von allen Schülerinnen und Schüler bis zum Ende gelesen wurde und sich die Schülerinnen und Schüler damit intensiv zu Hause auseinandergesetzt haben. Den Methodenwechsel zwischen Unterrichtsgespräch und Einzelarbeit halte ich für äußerst vorteilhaft. Die Schüler werden auf unterschiedlichster Weise gefordert und bekommen somit nicht das Gefühl die Stunde wäre Lehrerzentriert, d.h die Lehrperson stünde im Mittelpunkt des Geschehens Sie sind überwiegend auf sich selbst gestellt. Langweilig kann den Schülerinnen und Schülern nicht werden, weil sie permanent beschäftigt sind.
5.2.1 Einstiegsphase
Nach der Begrüßung von Lehrer und Schüler wird als erstes erklärt, wie der weitere Verlauf der Doppelstunde sein wird. Die erste Stunde der Doppelstunde übernehme ich und die zweite Stunde wird von der Lehrperson Herr Lehmann gehalten. So ist die Klasse auf eine einzige Lehrperson konzentriert und wird nicht von einem Lehrpersonwechsel überrascht.
In der vorangegangenen Deutschstunde wurde die Entwicklung, die Gary und Brendan während ihrer gemeinsamen dreijährigen Schulzeit gemacht haben, analysiert. Am Ende der Schulstunde wurde der Klasse aufgegeben sich damit zuhause noch mal auseinanderzusetzen und festzuhalten. In der Vorbesprechung der Stunde wurde mir geraten die Hausaufgaben der letzten Stunde zu besprechen.
Folgende Aufgabe soll von den Schülerinnen und Schüler erarbeitet werden:
Gary und Brendan waren nicht immer so, erst im Laufe der Jahre wurden sie von ihrer Umwelt geprägt. Wie sieht die Entwicklung der beiden aus? . Die SchülerInnen, die die Hausaufgaben gemacht haben, werden diese Aufgabe schnell lösen können.
Die Wiederholung der letzten Unterrichtsstunde dient zur Festigung des vorangegangenen gelernten Wissens.
5.2.2 Erarbeitungsphase II
Die Abschiedsbriefe Brendans und Gary sollen an Hand der Fragen verglichen werden. Die Aufgaben werden auf Folie mit Hilfe des Overheadprojektors an die Tafel projiziert. Bevor die Klasse, die von mir gestellten Aufgaben in Einzelarbeit erarbeitet, werden die Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert die Fragen ins Heft zu übertragen. Das Abschreiben von der Folie dient einmal zur Konzentration und einmal zur Vorbereitung der Einzelarbeit. Der Lärmpegel wird nach unten gesteuert und langsam tritt Stille ein. Jetzt kann jeder Schüler für sich und allein, ohne von den Mitschülern abgelenkt bzw. gestört werden, die Fragen mit Hilfe des Romans beantworten. An der Tafel stehen die Seitenzahlen der beiden Abschiedsbriefe. So weiß jeder wo diese zu finden sind und man muss sich nicht unnötig lang durch das Buch blättern.
5.2.3 Auswertung/ Ergebnissicherung
Die Abschiedsbriefe werden in der Klasse zusammen gelesen. Dafür brauche ich zwei Schülerinnen bzw. Schüler, die sich freiwillig melden.
Die Ergebnissicherung findet dann im Unterrichtsgespräch statt und werden gleichzeitig an der Tafel festgehalten, sodass die Schüler mitschreiben können.
Abschnittsweise wird dann aus dem Buch gelesen.
Hier erfolgt dann die Überleitung zur Anwendung des Gelernten in der heutigen Unterrichtsstunde.
5.2.4 Anwendung
Anhand der gelesenen Auszüge soll überlegt werden, wie man den Amok hätte verhindern können. Unterschiedliche Positionen werden angeschnitten. (Klassenkameraden, Eltern, Lehrer und die Gesellschaft. Eine Diskussion kommt zu Stande.
So wird indirekt an die Schülerinnen und Schüler appelliert das Mobbing in der Klasse bleiben zu lassen.
6. Unterrichtsskizze
01.07.2005
Ziele: Schüler/innen sollen die Entwicklung der Hauptfiguren herausarbeiten. Schüler/innen lernen die Motive für den Amok-Lauf kennen. Sie sollen sich überlegen, wie man so etwas hätte verhindern können.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
7. Literaturverzeichnis
Meyer, Hilbert: Unterrichtsmethoden II.Praxisband, Frankfurt a.M.: Cornelsen Scriptor
Ministerium für Kultus und Sport: Der Bildungsplan für die Realschule, Baden-Würrtemberg, Stuttgart 2004
Morton Rhue: Ich knall euch ab, Ravensburger Buchverlag 2002
Materialien zur Unterrichtspraxis (2)
www.ops-freiberg.de
8. Anlagen
Aufgabe: Vergleiche die Abschiedsbriefe Brendans und Garys
Tafelbild
Internetseite
Vergleiche die Abschiedsbriefe Brendans und Garys
Aufgaben:
1. An wen sind die Abschiedsbriefe gerichtet?
2. Warum wurden die Abschiedsbriefe geschrieben? Was steht darin?
3. Schau dir die Anrede an. Wer wird angeredet? Warum wurde gerade diese Anrede vom Verfasser gewählt?
4. Warum haben sich die beiden Schüler für den Amok-Lauf entschieden? Zähle ihre Motive auf.
5. Wer hat Schuld am Amok-Lauf?
Tafelbild
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.
erleben Ungerechtigkeit in Schule und Gesellschaft
werden ausgegrenzt
mobbing
wollen es den anderen heimzahlen
eine Botschaft überbringen und ihnen die Augen aufmachen
5.
Gesellschaft
Lehrer
Klassenkameraden
Eltern
Schulsystem
[...]
1 Vgl. www.ops-freiberg.de/realschule/realschule.php
2 Vgl. www.ops-freiberg.de/allgemein/allgemein_unterrichtszeiten.php
3 Materialien zur Unterrichtspraxis „Ich knall euch ab!“ von Morton Rhue, herausgegeben von Brigitta Reddig-Korn, erarbeitet von Andrea S. Maier, Sekundarstufe, 9./10. Klasse, Ravensburger Verlag
4 Materialien zur Unterrichtspraxis „Ich knall euch ab!“ von Morton Rhue, herausgegeben von Brigitta Reddig-Korn, erarbeitet von Andrea S. Maier, Sekundarstufe, 9./10. Klasse, Ravensburger Verlag
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele, Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es dient zur Analyse von Lehr- und Lernvoraussetzungen.
Was sind die Rahmenbedingungen, die in der Analyse der Lehr- und Lernvoraussetzungen berücksichtigt werden?
Die Rahmenbedingungen umfassen lokale, anthropologische und temporale Aspekte. Lokale Rahmenbedingungen beziehen sich auf den Standort der Schule, die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und die Gestaltung des Schulgebäudes. Anthropologische Rahmenbedingungen umfassen die Zusammensetzung der Klasse, soziale Dynamiken und individuelle Eigenschaften der Schüler. Temporale Rahmenbedingungen beschreiben die zeitliche Organisation des Unterrichts, wie z.B. Doppelstunden und Pausenzeiten.
Welche Lernvoraussetzungen werden bei der Analyse berücksichtigt?
Zu den Lernvoraussetzungen gehören das Interesse am Thema, das Gruppenklima und die verwendeten Sozialformen. Das Interesse am Thema "Gewalt unter Jugendlichen" wird als hoch eingeschätzt, da die Schülerinnen und Schüler eigene Erfahrungen in diesem Bereich haben. Das Gruppenklima wird als verbesserungswürdig beschrieben, da es in der Vergangenheit zu Mobbingübergriffen gekommen ist. Die Sozialformen, wie z.B. Diskussionsrunden und Partnerarbeit, sind den Schülern vertraut.
Was ist das Ziel der Sachanalyse?
Die Sachanalyse beinhaltet die Einordnung des Themas in einen fachwissenschaftlichen Zusammenhang. In diesem Fall wird der Jugendroman "Ich knall euch ab" von Morton Rhue analysiert und in Bezug zu Amokläufen an Schulen gesetzt.
Welchen Bezug hat der Unterricht zum Bildungsplan?
Der Unterricht bezieht sich auf den Bildungsplan, indem er die deutsche Sprache als Unterrichtsgegenstand und -prinzip behandelt. Der Deutschunterricht soll zur Identitätsbildung der Schülerinnen und Schüler beitragen und ihre personalen Kompetenzen ausbauen. Beim Lesen von Texten sollen die Schülerinnen und Schüler andere Welten erschließen, ihren Erfahrungshorizont erweitern und ein ästhetisches Bewusstsein entwickeln.
Was sind die Grob- und Feinziele des Unterrichts?
Die Grobziele sind, dass die Schülerinnen und Schüler zwei unterschiedlich fiktive Charaktere kennenlernen, die jahrelang gemobbt wurden und sich in Gewaltausbrüche stürzen, die in einem "School Shooting" enden. Die Feinziele sind, die Entwicklung der Protagonisten Gary und Brendan herauszuarbeiten, die Motive für den Amoklauf zu reflektieren und zu beurteilen und sich zu überlegen, wie man so etwas hätte verhindern können.
Welche methodische Analyse wird durchgeführt?
Die methodische Analyse umfasst die geplante Methodenkonzeption, die Einstiegsphase, die Erarbeitungsphase, die Auswertung/Ergebnissicherung und die Anwendung. Der Jugendroman wird sowohl in der Klasse als auch in Einzelarbeit erarbeitet. Es wird ein Methodenwechsel zwischen Unterrichtsgespräch und Einzelarbeit angestrebt.
Welche Literatur wird im Literaturverzeichnis aufgeführt?
Das Literaturverzeichnis enthält folgende Werke: Unterrichtsmethoden II.Praxisband von Hilbert Meyer, Der Bildungsplan für die Realschule, Baden-Würrtemberg vom Ministerium für Kultus und Sport, Ich knall euch ab von Morton Rhue und Materialien zur Unterrichtspraxis sowie die Webseite www.ops-freiberg.de.
Welche Anlagen sind enthalten?
Die Anlagen umfassen eine Aufgabe zum Vergleich der Abschiedsbriefe von Brendan und Gary, ein Tafelbild und eine Internetseite.
- Quote paper
- Francesca Rosa (Author), 2005, Unterrichtseinheit zum Jugendroman 'Ich knall euch ab', Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/63988