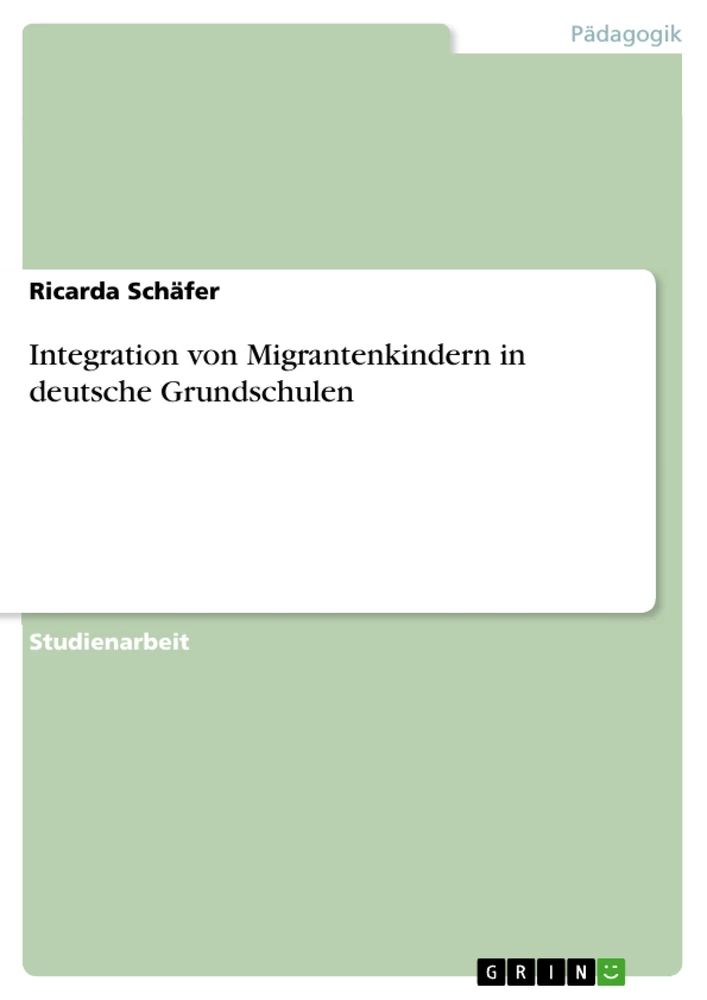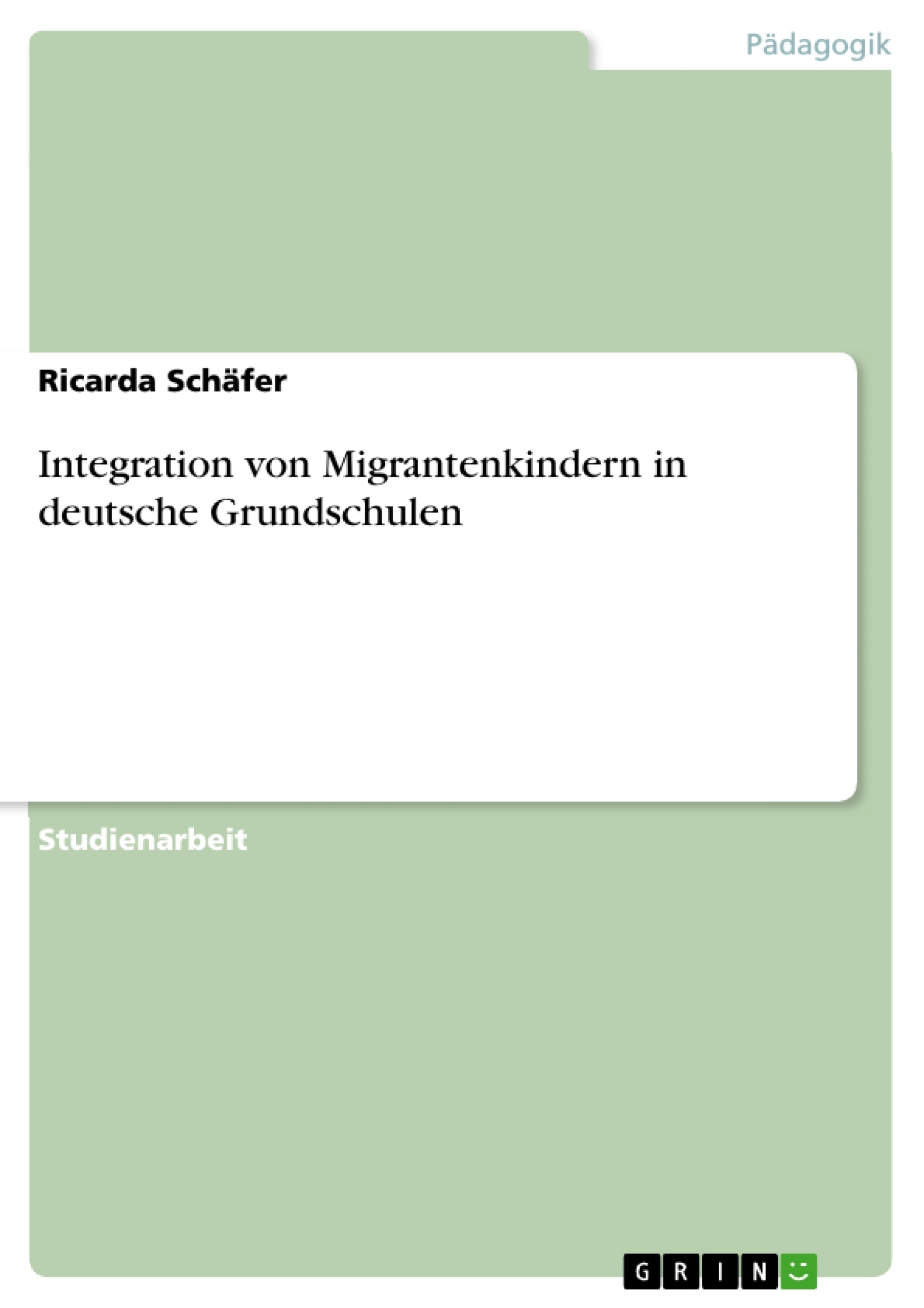In meiner Hausarbeit habe ich mich mit der Frage befasst, inwieweit die Integration von Migrantenkindern in die deutschen Grundschulen bisher gelungen ist. Unter dem Begriff Migrantenkinder möchte ich alle ausländischen Kinder, die aus den verschiedensten Gründen nach Deutschland kamen, zusammenfassen. Hierzu gehören unter anderem die Kinder von Arbeitsmigranten, Asylbewerbern, Flüchtlingen und Aussiedlern aus Osteuropa (vgl. Diehm/ Radtke, 1999, S.116). Den Begriff der Integration möchte ich zudem nicht als Synonym für Assimilation verstanden wissen, wie es oft der Fall ist. Mir geht es nicht darum herauszufinden, ob sich die Migranten an unser Unterrichtssystem angepasst haben und wie Deutsche geworden sind (vgl. Hinz, 1993, S.186-188). Ich möchte vielmehr untersuchen, inwieweit es funktioniert, Migranten in unser Schulsystem so zu integrieren, dass ihre eigene Persönlichkeit dabei erhalten bleibt.
Die Frage nach der Integration von Migrantenkindern gewinnt in den letzten Jahren mehr und mehr an Bedeutung. Ganz besonders betroffen sind hierbei die Grundschulen. Während im Schuljahr 1965/66 nur 3.767 ausländische SchülerInnen die deutschen Grund- und Hauptschulen besuchten, so waren es im Schuljahr 1970/71 bereits 15.550. Diese Zahlen stiegen stetig an und so besuchten im Schuljahr 2000/01 bereits 62.179 ausländische SchülerInnen die Grund- und Hauptschulen (vgl. http://www.kultusministerium. hessen.de/downloads/statistiken2001/ 6.5.Auslaendische Schueler.pdf Rev. 11.6.02). Allein in der Stadt Frankfurt am Main waren in diesem Schuljahr von den 21.088 Grundschülern 7.829 ausländischer Herkunft (vgl. http://kultusministerium.hessen.de/downloads/statistiken2001/6u6.1_Deutsche_u Auslaender.pdf Rev. 11.6.02). Diese Zahlen zeigen, dass es höchste Zeit ist, sich ernsthaft mit diesem Thema auseinanderzusetzen, da es sich nicht mehr um eine zu vernachlässigende Minderheit handelt, sondern um eine echte Herausforderung. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entstehung der „Problematik“
- Rechtliche Grundlagen zur Integration von Migrantenkindern
- Phasen der Bewältigung von kultureller Heterogenität in der Vergangenheit
- Erste Phase
- Das Rotationskonzept
- Das Integrationskonzept
- Das Optionskonzept
- Zweite Phase
- Dritte Phase
- Erste Phase
- Neuere Ansätze der Bewältigung von kultureller Heterogenität
- Der Krefelder Modellversuch
- Der Mainzer Modellversuch
- Das Modell der Egerstorff-Schule in Hannover-Linden
- Das Essener Handlungsprogramm zur Sprachförderung
- Die Frankfurter Vorlaufkurse
- Zweites Gesetz zur Qualitätssicherung in hessischen Schulen
- Stellungnahme zu den Texten
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Integration von Migrantenkindern in deutsche Grundschulen und untersucht, inwieweit diese Integration bisher gelungen ist. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung der „Problematik“, die rechtlichen Grundlagen der Integration, verschiedene Ansätze zur Bewältigung von kultureller Heterogenität sowie neuere Modelle und Maßnahmen zur Integration von Migrantenkindern.
- Historische Entwicklung der „Problematik“
- Rechtliche Grundlagen der Integration von Migrantenkindern
- Verschiedene Ansätze zur Bewältigung von kultureller Heterogenität
- Neuere Modelle und Maßnahmen zur Integration von Migrantenkindern
- Stellungnahme zu den Texten und Schlussbetrachtung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in die Thematik der Integration von Migrantenkindern in deutsche Grundschulen ein und definiert den Begriff der Integration im Kontext der Arbeit. Sie stellt die Relevanz des Themas dar und benennt die Ziele der Hausarbeit.
- Das Kapitel „Die Entstehung der „Problematik““ beleuchtet den historischen Hintergrund der Integration von Migrantenkindern in Deutschland, beginnend mit dem Anwerben von Gastarbeitern in den 1960er Jahren. Es beschreibt die Entwicklung von einer anfänglichen Fokussierung auf die Sprachschwierigkeiten der Kinder hin zu einer Anerkennung der wachsenden multikulturellen Gesellschaft.
- Das Kapitel „Rechtliche Grundlagen zur Integration von Migrantenkindern“ erläutert die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Integration von Migrantenkindern in Deutschland.
- Das Kapitel „Phasen der Bewältigung von kultureller Heterogenität in der Vergangenheit“ stellt verschiedene Ansätze zur Integration von Migrantenkindern in drei Phasen dar. Die Phasen beschreiben die Entwicklung vom Rotationskonzept, über das Integrationskonzept bis hin zum Optionskonzept und gehen auf die Herausforderungen und Erfolge der jeweiligen Phase ein.
- Das Kapitel „Neuere Ansätze der Bewältigung von kultureller Heterogenität“ stellt verschiedene aktuelle Modelle und Maßnahmen zur Integration von Migrantenkindern vor, darunter der Krefelder Modellversuch, der Mainzer Modellversuch, das Modell der Egerstorff-Schule in Hannover-Linden, das Essener Handlungsprogramm zur Sprachförderung, die Frankfurter Vorlaufkurse und das Zweite Gesetz zur Qualitätssicherung in hessischen Schulen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Integration, Migrantenkinder, deutsche Grundschulen, kulturelle Heterogenität, Sprachförderung, Modellversuche, rechtliche Grundlagen und Bildungsgerechtigkeit.
- Quote paper
- Ricarda Schäfer (Author), 2002, Integration von Migrantenkindern in deutsche Grundschulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/63900