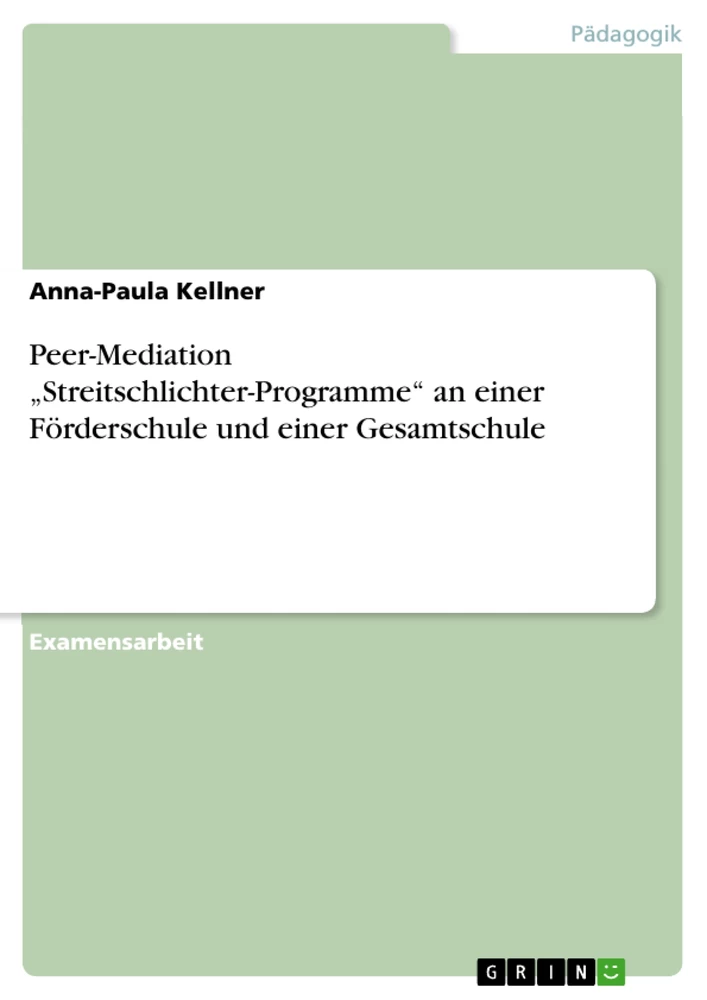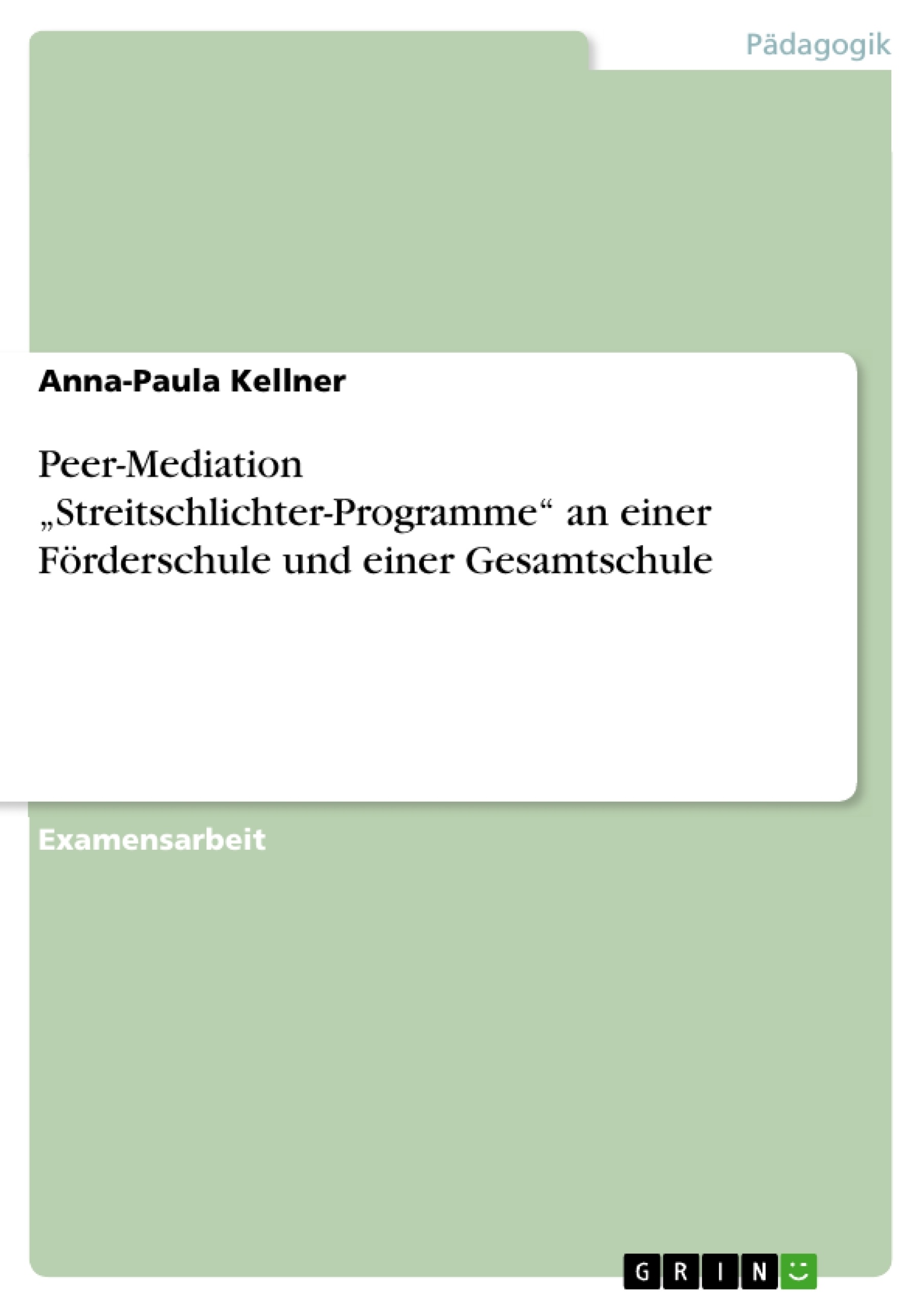„Hildesheimer Schüler gequält: Polizei führt Klasse ab.“ So lautete die Überschrift zu einem Bericht über Vorfälle and der Werner-von-Siemensschule der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung am 03.02.2004.
Das Konfliktpotential an deutschen Schulen ist groß/hoch.
Während Vorfälle wie dieser fürchterliche Einzelfälle darstellen, sind alltägliche Konflikte wie Beschimpfungen, Prügeleien oder Lästereien im Schulleben an der Tagesordnung.
In den letzten Jahren hat an vielen deutschen Schulen ein Verfahren Einzug gehalten, mit dem berechtigte Hoffnungen auf Möglichkeiten einer konstruktiven Konfliktbewältigung an Schulen verbunden sind:
Die Peer-Mediation.
So sind an Schulen im gesamten Bundesgebiet sogenannte „Streitschlichter-Programme“ entstanden.
Der Einsatz von Peer-Mediation an Schulen ist eine Thematik, die mich schon während meines gesamten Studiums begleitet und interessiert.
Bereits in meinen Schulpraktischen Studien an der Orientierungsstufe Himmelsthür habe ich im Rahmen von Hospitationen bei einer Streitschlichterausbildung erste Eindrücke und Erfahrungen in diesem Bereich sammeln können.
Im Wintersemester 2003/2004 besuchte ich ein Seminar zur „Mediation“ bei Christiane Temme und Karen Gragert, die Lehrerinnen an der Robert-Bosch-Gesamtschule sind und dort Schüler zu Streitschlichtern ausbilden. Im Rahmen dieses Seminars habe ich das Konzept der Mediation kennengelernt und in Rollenspielen eigene Erfahrungen zur Rolle des Mediator machen können.
Mein Interesse an der Mediation wuchs zunehmend, so dass im darauffolgenden Sommersemester ein Referat zur „Konfliktlösung und Mediation“ in einem Seminar zum „Fordern und Fördern“ übernommen habe.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konflikte
- Konflikte - Definitionen und Typologien
- Das Eisberg-Modell
- Stufen der Eskalation von Konflikten
- Umgang mit Konflikten
- Mediation als Verfahren zur konstruktiven Konfliktlösung
- Definition, Idee und Ziele der Mediation
- Historische und kulturelle Wurzeln des Mediationsgedankens
- Verbreitung aus den USA nach Deutschland
- Methodik der Mediation
- Zentrale Techniken
- Die Phasen der Mediation
- Einteilung der Phasen
- Ablauf der Phasen
- Verschiedene Lösungsmöglichkeiten
- Kommunikationsrichtungen während eines Mediationsgesprächs
- Die Rolle des Mediators
- Einsatz von Peer-Mediation an Schulen
- Konflikte in der Schule
- Traditioneller Umgang mit schulischen Konflikten
- Peer-Education
- Peer-Mediation
- Idee und Ziele der Peer-Mediation
- Ursprung und Verbreitung von Peer-Mediation an Schulen
- Ausbildung von Schülern zu Streitschlichtern
- Notwendige Rahmenbedingungen
- Peer-Mediation an Förderschulen
- Chancen und Grenzen der Peer-Mediation an Schulen
- Chancen der Peer-Mediation
- Grenzen der Peer-Mediation
- Streitschlichtung an der Anne-Frank-Schule in Hildesheim
- Pilotprojekt „Streitschlichtung durch SchülerInnen“
- Ausbildung der Streitschlichter 2002/2003
- Ausbildung der Streitschlichter 2004/2005
- Durchführung von Streitschlichtungen
- Hospitation bei einer Schlichtung
- Interview mit den Streitschlichtern Alexander und Manal
- Streitschlichtung an der Robert-Bosch-Gesamtschule in Hildesheim
- Gesamtkonzept zur Förderung des sozialen Lernens
- Von der Idee zur Vorbereitung eines Streitschlichterprogrammes an der RBG
- Durchführung der Streitschlichter-AG der 7. Jahrgangsstufe
- Durchführung der Streitschlichtungen
- Rahmenbedingungen
- Ergebnisse der Streitschlichtungen: Interview mit zwei Streitschlichterinnen
- Seminar „Streitschlichtung an der RBG“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Effektivität von Peer-Mediation als Verfahren zur konstruktiven Konfliktlösung an Schulen. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen der Peer-Mediation und beleuchtet den praktischen Einsatz an einer Förderschule und einer Gesamtschule in Hildesheim.
- Konflikte an Schulen und deren traditionelle Bewältigung
- Theoretische Grundlagen und Methodik der Mediation und Peer-Mediation
- Der praktische Einsatz von Peer-Mediation an verschiedenen Schulformen
- Chancen und Grenzen der Peer-Mediation
- Notwendige Rahmenbedingungen für den erfolgreichen Einsatz von Peer-Mediation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Anlass der Arbeit, ausgehend von einem Zeitungsbericht über Schulmobbing. Sie erläutert das wachsende Interesse der Autorin an Mediation, ihre bisherigen Erfahrungen und die Zielsetzung der Arbeit: die Untersuchung der Effektivität von Peer-Mediation an Schulen anhand von Fallstudien an einer Förderschule und einer Gesamtschule. Die Arbeit wird die theoretischen Grundlagen erläutern und den praktischen Einsatz an den beiden Schulen darstellen, beginnend mit einer Erörterung von Konflikten und deren Umgang.
Konflikte: Dieses Kapitel liefert Definitionen und Typologien von Konflikten, erläutert das Eisberg-Modell zur Veranschaulichung der sichtbaren und verdeckten Konfliktanteile, beschreibt Stufen der Konflikteskalation und verschiedene Strategien des Umgangs mit Konflikten. Es bildet die Grundlage für das Verständnis des folgenden Kapitels über Mediation als konstruktive Konfliktlösung.
Mediation als Verfahren zur konstruktiven Konfliktlösung: Dieses Kapitel definiert Mediation, beschreibt ihre Ziele und beleuchtet ihre historischen und kulturellen Wurzeln sowie ihre Verbreitung aus den USA nach Deutschland. Es liefert einen umfassenden Überblick über die Methodik der Mediation, einschließlich zentraler Techniken, der Phasen der Mediation (Einteilung und Ablauf), verschiedener Lösungsmöglichkeiten und der Rolle des Mediators. Die verschiedenen Aspekte der Mediation werden detailliert dargestellt, um das Verständnis der späteren Anwendung in der Peer-Mediation zu fördern.
Einsatz von Peer-Mediation an Schulen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Einsatz von Peer-Mediation in schulischen Kontexten. Es beschreibt zunächst die Besonderheiten schulischer Konflikte und den traditionellen Umgang damit. Anschließend wird Peer-Education als Vorläufer von Peer-Mediation eingeführt. Der Hauptteil des Kapitels behandelt die Idee, Ziele und Verbreitung von Peer-Mediation an Schulen, die Ausbildung von Schülern zu Streitschlichtern und die notwendigen Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Einsatz. Der Abschnitt über Peer-Mediation an Förderschulen betont die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten in diesem Kontext.
Chancen und Grenzen der Peer-Mediation an Schulen: Dieses Kapitel bewertet die Chancen und Grenzen von Peer-Mediation an Schulen. Es wird eine differenzierte Analyse der Stärken und Schwächen des Verfahrens vorgenommen, wobei sowohl die positiven Effekte (z.B. verbesserte Konfliktlösungskompetenzen, Stärkung des sozialen Lernens) als auch die potenziellen Risiken und Einschränkungen (z.B. mangelnde Kompetenz der Streitschlichter, ungünstige Schulkontexte) erörtert werden. Diese Diskussion liefert wichtige Erkenntnisse für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema.
Streitschlichtung an der Anne-Frank-Schule in Hildesheim: Dieses Kapitel präsentiert eine Fallstudie über die Implementierung und Durchführung eines Peer-Mediationsprogramms an der Anne-Frank-Schule, einer Förderschule für Lernhilfe. Es beschreibt das Pilotprojekt, die Ausbildung der Streitschlichter, die Durchführung von Streitschlichtungen, eine Hospitation der Autorin bei einer Schlichtung und ein Interview mit zwei Streitschlichtern. Der Fokus liegt auf der konkreten Umsetzung und den Erfahrungen an dieser speziellen Schule.
Streitschlichtung an der Robert-Bosch-Gesamtschule in Hildesheim: Dieses Kapitel bietet eine zweite Fallstudie, diesmal an der Robert-Bosch-Gesamtschule. Es beschreibt das Gesamtkonzept zur Förderung des sozialen Lernens, die Entwicklung des Streitschlichterprogramms, die Durchführung der Streitschlichter-AG, die Durchführung von Streitschlichtungen (inkl. Rahmenbedingungen und Interview mit Streitschlichterinnen) und ein Seminar zum Thema Streitschlichtung an der Schule. Der Vergleich mit der Anne-Frank-Schule ermöglicht eine breitere Perspektive auf den Einsatz von Peer-Mediation an verschiedenen Schulformen.
Schlüsselwörter
Peer-Mediation, Konfliktlösung, Schule, Förderschule, Gesamtschule, Mediation, Streitschlichtung, Schüler, soziale Kompetenz, Konfliktmanagement, Rahmenbedingungen, Chancen, Grenzen, Fallstudie, Hildesheim.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Peer-Mediation an Schulen
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Effektivität von Peer-Mediation als Verfahren zur konstruktiven Konfliktlösung an Schulen. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen und beleuchtet den praktischen Einsatz an einer Förderschule und einer Gesamtschule in Hildesheim.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Konflikte an Schulen und deren traditionelle Bewältigung, die theoretischen Grundlagen und Methodik der Mediation und Peer-Mediation, den praktischen Einsatz von Peer-Mediation an verschiedenen Schulformen, Chancen und Grenzen der Peer-Mediation sowie die notwendigen Rahmenbedingungen für deren erfolgreichen Einsatz.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit beinhaltet Kapitel zu Einleitung, Konflikten (Definitionen, Typologien, Eskalation), Mediation (Definition, Methodik, historische Wurzeln), Einsatz von Peer-Mediation an Schulen (inkl. Peer-Education und Förderschulen), Chancen und Grenzen der Peer-Mediation, sowie Fallstudien zur Streitschlichtung an der Anne-Frank-Schule und der Robert-Bosch-Gesamtschule in Hildesheim.
Wie wird die Mediation in der Hausarbeit dargestellt?
Die Hausarbeit beschreibt Mediation umfassend: Definition, Ziele, historische Wurzeln, Methodik (Techniken, Phasen, Lösungsansätze, Rolle des Mediators). Dies dient als Grundlage für das Verständnis der Peer-Mediation.
Wie wird die Peer-Mediation in der Hausarbeit dargestellt?
Die Peer-Mediation wird im Kontext schulischer Konflikte und im Vergleich zum traditionellen Umgang damit behandelt. Die Arbeit beschreibt die Idee, Ziele, Verbreitung, Ausbildung der Schüler und notwendige Rahmenbedingungen. Besondere Aufmerksamkeit erhält der Einsatz an Förderschulen.
Welche Fallstudien werden in der Hausarbeit präsentiert?
Die Hausarbeit präsentiert Fallstudien zur Implementierung und Durchführung von Peer-Mediationsprogrammen an der Anne-Frank-Schule (Förderschule) und der Robert-Bosch-Gesamtschule in Hildesheim. Die Fallstudien beschreiben die Ausbildung der Streitschlichter, Durchführung von Streitschlichtungen und Interviews mit beteiligten Schülern.
Welche Chancen und Grenzen der Peer-Mediation werden diskutiert?
Die Hausarbeit analysiert differenziert die Chancen (z.B. verbesserte Konfliktlösungskompetenzen, Stärkung des sozialen Lernens) und Grenzen (z.B. mangelnde Kompetenz der Streitschlichter, ungünstige Schulkontexte) der Peer-Mediation.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Peer-Mediation, Konfliktlösung, Schule, Förderschule, Gesamtschule, Mediation, Streitschlichtung, Schüler, soziale Kompetenz, Konfliktmanagement, Rahmenbedingungen, Chancen, Grenzen, Fallstudie, Hildesheim.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Effektivität von Peer-Mediation an Schulen anhand von Fallstudien und beleuchtet die theoretischen Grundlagen sowie den praktischen Einsatz an verschiedenen Schulformen.
- Arbeit zitieren
- Anna-Paula Kellner (Autor:in), 2005, Peer-Mediation „Streitschlichter-Programme“ an einer Förderschule und einer Gesamtschule, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/63565