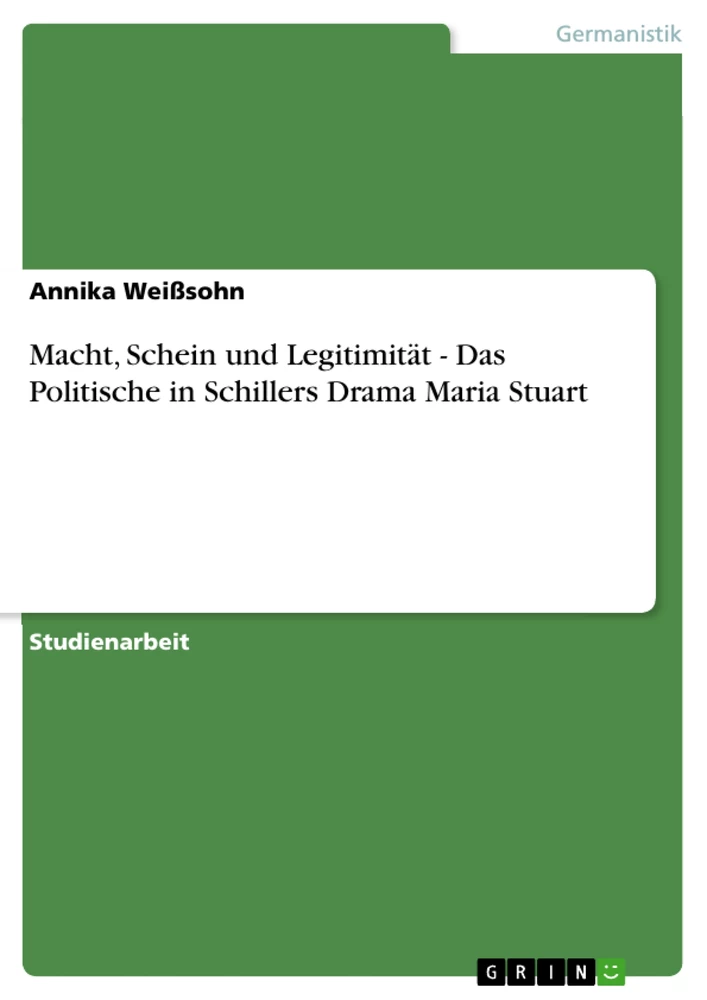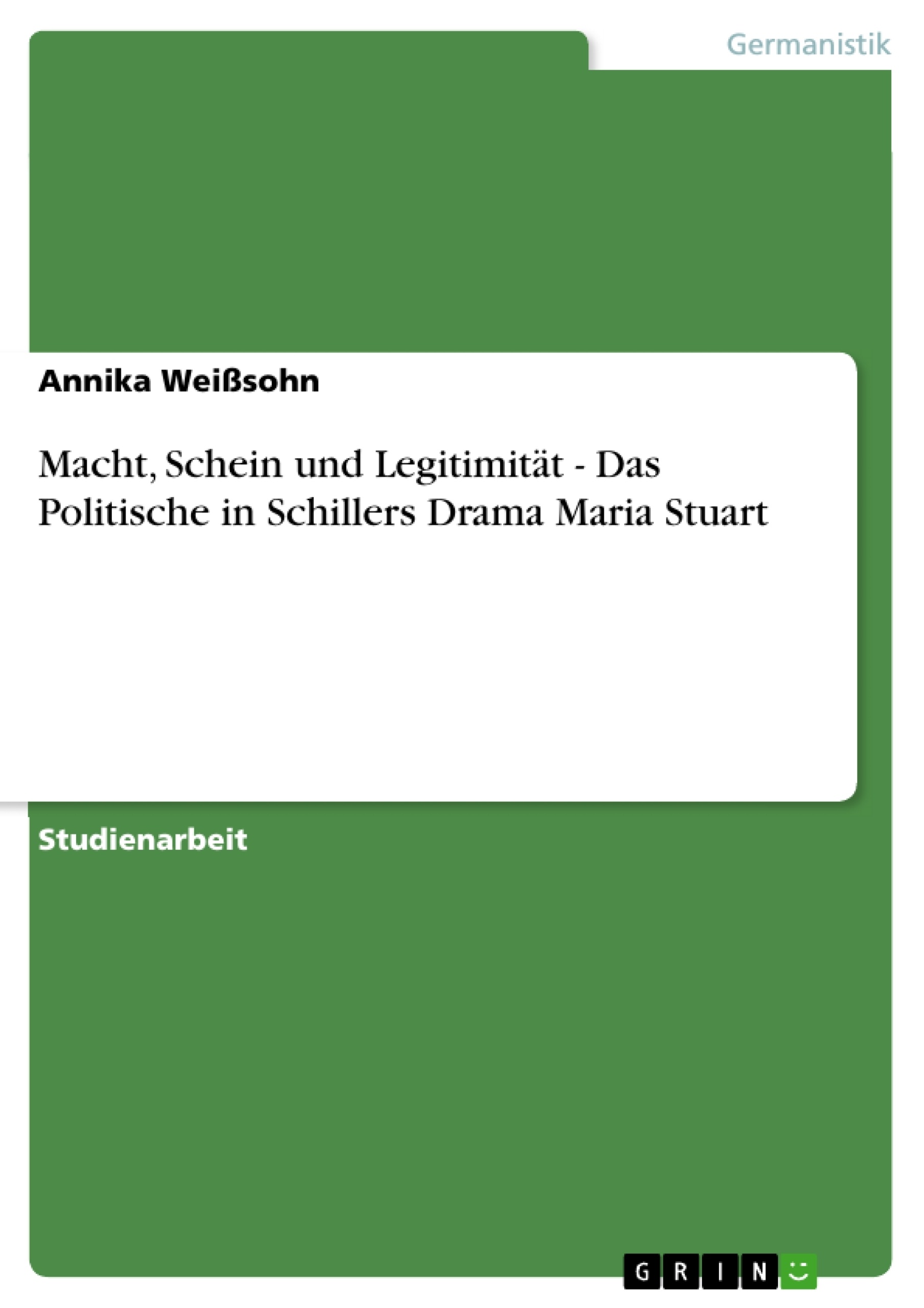Das Drama Maria Stuart hat in der Geschichte seines Bestehens schon viele Deutungen erfahren. Es wird der religiöse Horizont hervorgehoben, die Historizität des Stoffes, oder der Fokus wird auf den Aspekt der Frauenrolle gerichtet. Oft dient das Drama als Charakterstudie, viel zitiert wird Marias Übergang zur „erhabenen, schönen Seele“.
Viele Deutungen des Dramas schieben den politischen Gesichtspunkt beiseite oder erwähnen ihn nur am Rande. Doch das Politische ist in Maria Stuart auf jeder Seite zugegen. Die Handlung des Dramas findet in einer politisch hochbrisanten Zeit statt, nämlich der Elisabethanischen Ära. Die agierenden Persönlichkeiten sind Königinnen und Staatsmänner; außen- und innenpolitische Themen, Fragen nach der Legitimität und Konfessionsstreitigkeiten bestimmen ihre Handlungen. Diese Aspekte in einer Deutung hervorzuheben, ist daher legitim.
Schiller hat für sein Drama die Geschichte Englands genau studiert. Sein Interesse für das Schicksal der schottischen Königin war schon lange vor der Entstehung des Stückes geweckt. Bereits im März 1783 schreibt er in einem Brief an Wilhelm Friedrich Hermann Reinwald: „Ich hab ihm [dem Leipziger Verleger Weyland] die Prosaische Erzählung abgesagt, dafür aber meine Maria Stuart versprochen. [...] Zu meiner Maria Stuart liebster Freund schiken Sie mir doch auch jezt Geschichten.“ Seine Quellen sind u. a. William Camdens Annales rerum anglicarum et hibernicarum regnante Elisabehta und Robertsons Geschichte von Schottland. Die politischen Zustände der Zeit waren ihm also vertraut und er hat sie im Drama auf explizite Weise wiedergegeben.
Doch tritt hinter der reinen Genauigkeit, der unmittelbaren Darstellung der Gegebenheiten oftmals eine Kritik hervor, die sich durchaus auf das 18. Jahrhundert übertragen lassen kann. Je genauer man das Drama auf den politischen Aspekt hin untersucht, desto mehr stellt sich die Frage, inwieweit Schiller diesen zur (versteckten) Kritik an seinem Zeitalter werden lässt. Augenscheinlich wird bei der Bearbeitung auch, dass der Dichter in seinem Drama seine ästhetisch- theoretischen Schriften verarbeitet. Die Auffassung, dass nur derjenige moralisch gut ist, der selbstbestimmt handelt und zu seinen Taten mit allen Konsequenzen steht, wird überdeutlich.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schein und Sein am königlichen Hofe
- Leicester
- Elisabeth
- Politik in Maria Stuart
- Justiz- und Rechtskritik
- Staatsräson contra Privatinteresse
- Die Legitimitätsfrage
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den politischen Aspekt in Schillers Drama Maria Stuart, der oft vernachlässigt wird. Sie beleuchtet, wie Schiller die politischen Verhältnisse der Elisabethanischen Ära darstellt und gleichzeitig eine Kritik an den Verhältnissen seines eigenen Zeitalters übt. Die Arbeit analysiert Schillers Verarbeitung seiner ästhetisch-theoretischen Schriften im Drama.
- Kritik am höfischen Leben, Schein und Intrige
- Schillers Justiz- und Rechtskritik
- Konflikt zwischen Staatsräson und Privatinteresse
- Die Frage nach der Legitimität
- Verarbeitung ästhetisch-theoretischer Schriften Schillers
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt fest, dass Maria Stuart vielfältig interpretiert wurde, oft unter Vernachlässigung des politischen Aspekts. Sie argumentiert jedoch für die Relevanz der politischen Dimension, da das Drama in einer politisch brisanten Zeit spielt und von Königinnen und Staatsmännern bevölkert wird, deren Handlungen von innen- und außenpolitischen Themen, Legitimitätsfragen und Konfessionsstreitigkeiten bestimmt sind. Schiller, der die Geschichte Englands genau studiert hatte, verarbeitete dieses Wissen in seinem Drama und verknüpfte es mit einer impliziten Kritik am 18. Jahrhundert. Die Arbeit kündigt die Analyse des höfischen Scheins und dreier zentraler politischer Themen an: Justiz- und Rechtskritik, den Konflikt zwischen Staatsräson und Privatinteresse sowie die Legitimitätsfrage.
Schein und Sein am königlichen Hofe: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung des höfischen Lebens als von Misstrauen, Verstellung und Intrigen geprägt. Der Dialog zwischen Mortimer und Leicester veranschaulicht die herrschende Atmosphäre des Misstrauens und der geheimen Absprachen. Die Figuren agieren vorsichtig, da sie sich in einer Welt voller falscher Bilder und Doppelbödigkeit befinden. Paulets Warnung vor der "Gefährlichkeit der höfischen Sphäre" unterstreicht die allgegenwärtige Gefahr von Intrigen und Verrat. Das Kapitel zeigt, wie der Schein am Hofe die wahre Natur der Beziehungen und Handlungen verdeckt und ein Klima des Misstrauens schafft.
Schlüsselwörter
Maria Stuart, Schiller, Politik, Hofintrigen, Schein und Sein, Legitimität, Justizkritik, Staatsräson, Privatinteresse, Elisabethanische Ära, historisches Drama, ästhetisch-theoretische Schriften.
Häufig gestellte Fragen zu Schillers "Maria Stuart" - Eine Politische Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den oft vernachlässigten politischen Aspekt in Schillers Drama "Maria Stuart". Sie untersucht, wie Schiller die politischen Verhältnisse der Elisabethanischen Ära darstellt und gleichzeitig eine Kritik an den Verhältnissen seines eigenen Zeitalters übt. Ein Schwerpunkt liegt auf Schillers Verarbeitung seiner ästhetisch-theoretischen Schriften im Drama.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: Kritik am höfischen Leben und den Intrigen, Schillers Justiz- und Rechtskritik, den Konflikt zwischen Staatsräson und Privatinteresse, die Frage nach der Legitimität und die Verarbeitung von Schillers ästhetisch-theoretischen Schriften im Drama. Konkret werden die Darstellung von Schein und Sein am Hof, die politischen Machtkämpfe und die Legitimitätsansprüche der Königinnen Elisabeth und Maria Stuart untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, die die Relevanz des politischen Aspekts in "Maria Stuart" begründet. Es folgt ein Kapitel über "Schein und Sein am königlichen Hofe", ein Kapitel über die "Politik in Maria Stuart" mit Unterkapiteln zu Justiz- und Rechtskritik, Staatsräson contra Privatinteresse und der Legitimitätsfrage, und schließlich ein Fazit. Zusätzlich enthält die Arbeit ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was ist der Fokus des Kapitels "Schein und Sein am königlichen Hofe"?
Dieses Kapitel analysiert die Darstellung des höfischen Lebens als von Misstrauen, Verstellung und Intrigen geprägt. Anhand von Dialogen und Handlungen der Figuren wird gezeigt, wie der Schein am Hofe die wahre Natur der Beziehungen und Handlungen verdeckt und ein Klima des Misstrauens schafft. Die "Gefährlichkeit der höfischen Sphäre" und die allgegenwärtige Gefahr von Intrigen und Verrat werden thematisiert.
Welche Rolle spielt die Justiz- und Rechtskritik in der Analyse?
Die Arbeit untersucht Schillers Kritik am Justizsystem und Rechtsverständnis seiner Zeit. Dies wird im Kontext der politischen Intrigen und Machtkämpfe in "Maria Stuart" analysiert, um die Ungerechtigkeit und die Willkür der Machtverhältnisse aufzuzeigen.
Wie wird der Konflikt zwischen Staatsräson und Privatinteresse dargestellt?
Die Analyse beleuchtet den Konflikt zwischen den Interessen des Staates und den persönlichen Interessen der handelnden Figuren. Es wird untersucht, wie Schiller diesen Konflikt in seinem Drama darstellt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben.
Welche Bedeutung hat die Legitimitätsfrage?
Die Legitimität der Herrschaft von Elisabeth und Maria Stuart ist ein zentrales Thema der Analyse. Es wird untersucht, wie Schiller die Frage nach dem rechtmäßigen Anspruch auf die Krone behandelt und welche Argumente er hierfür verwendet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Maria Stuart, Schiller, Politik, Hofintrigen, Schein und Sein, Legitimität, Justizkritik, Staatsräson, Privatinteresse, Elisabethanische Ära, historisches Drama, ästhetisch-theoretische Schriften.
- Quote paper
- Annika Weißsohn (Author), 2006, Macht, Schein und Legitimität - Das Politische in Schillers Drama Maria Stuart, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/63386