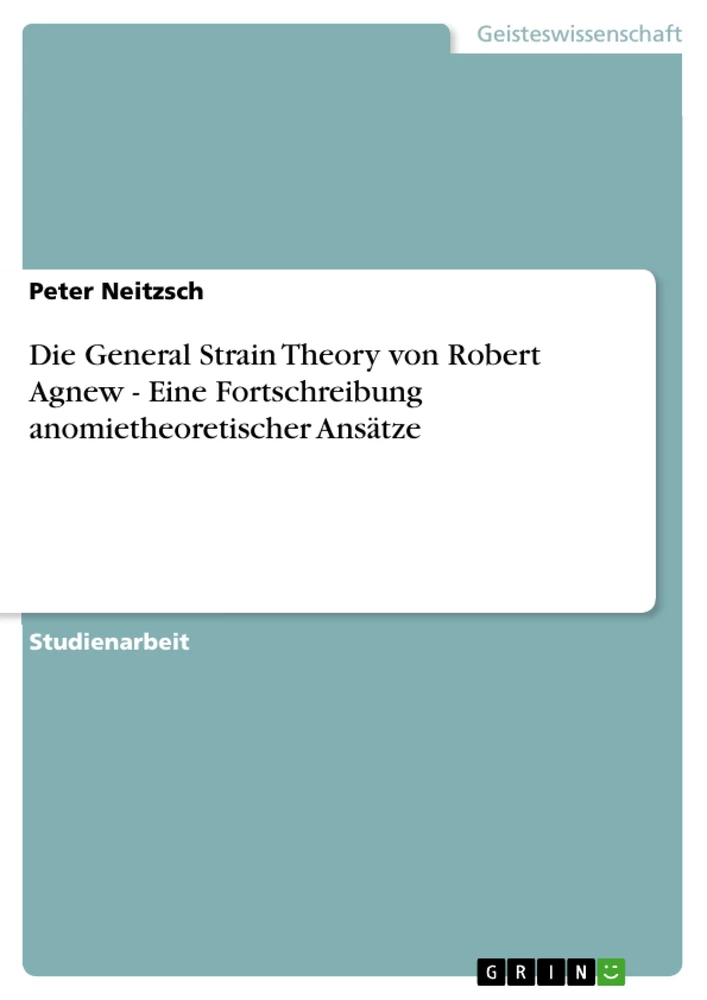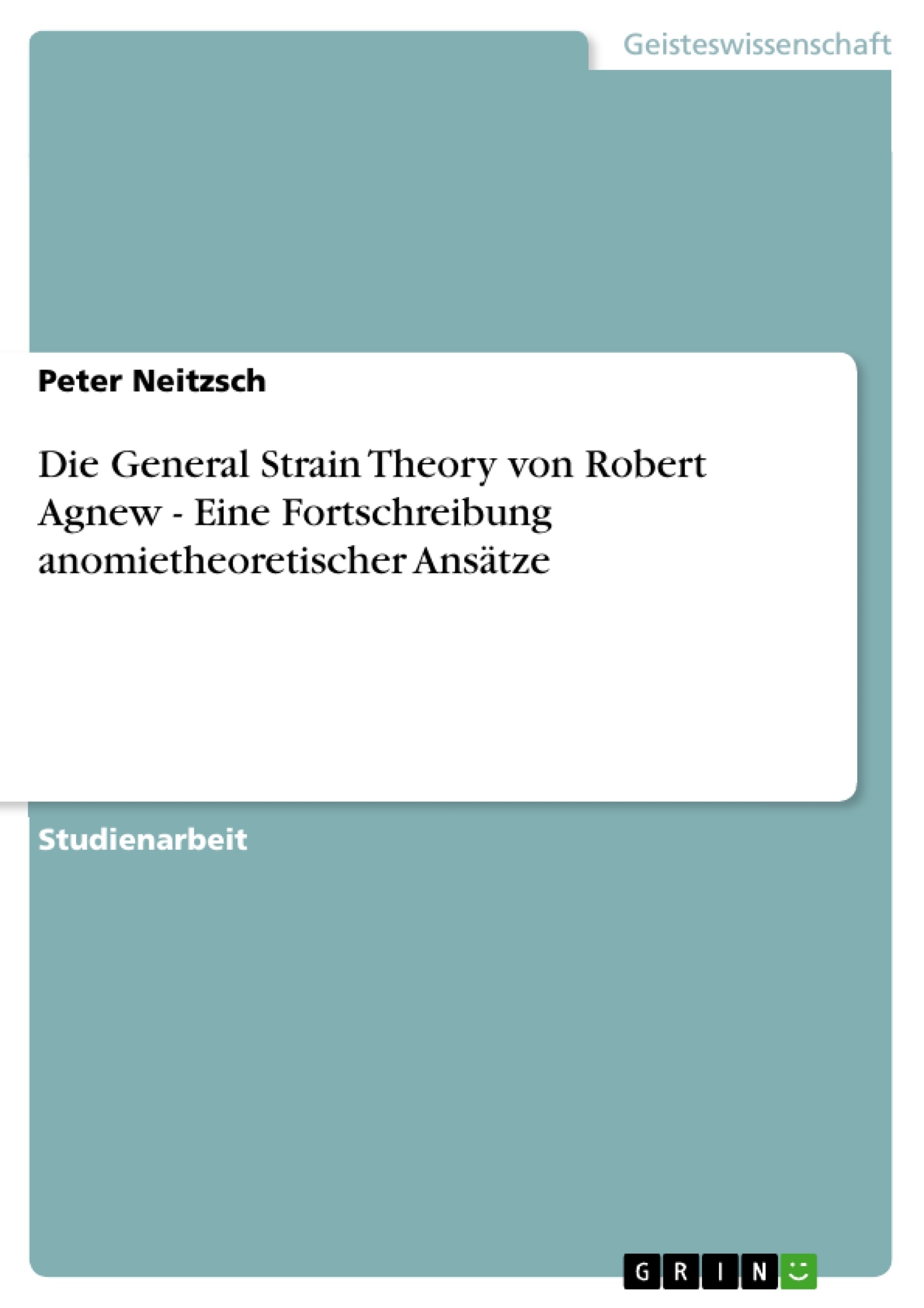Einerseits gehört die in dieser Arbeit vorgestellte ‚General Strain Theory’ von Robert Agnew zu den jüngeren Ansätzen auf dem Gebiet der Kriminalsoziologie, andererseits stammt sie aus einer Theorie-Familie mit langer Tradition. Die Vorläufer der modernen ‚Strain Theory’ gehören zu den ersten soziologischen Theorien überhaupt, die sich mit abweichendem Verhalten befasst haben. Die Frage „Was ist die Strain Theory?“ wird daher auch im Rückgriff auf die Entstehungsgeschichte der Theorie geklärt. Um die ‚General Strain Theory’ im Bereich der Anomietheorien verorten zu können, wird zu erst in die klassischen Anomietheorien von Durkheim und Merton eingeführt. Dabei soll herausgestellt werden, worin die Bedeutung der Anomietheorie für die Devianzforschung besteht, nämlich in dem genuin soziologischer Blickwinkel, den sie beisteuert. In Abgrenzung zu biologistischen Ansätzen (Triebtheorien), psychologischen Ansätzen (Lerntheorie) und ökonomischen Ansätzen (Rational Choice) wird – vor allem bei den klassischen Anomietheorien – ein sozialer Tatbestand, die Kriminalitätsrate, durch einen anderen erklärt – durch den gesellschaftlichen Zustand der Anomie. ‚Anomie’ beschreibt laut Duden einen „Zustand mangelnder sozialer Ordnung; (…) Zustand mangelhafter gesellschaftlicher Integration innerhalb eines sozialen Gebildes, verbunden mit Einsamkeit, Hilflosigkeit u. Ä.“ Die ‚General Strain Theory’ von Agnew kann in diesem Kontext als eine Art mikro-analytische Operationalisierung des Anomiekonzepts begriffen werden. Das englische Wort strain bedeutet in etwa soviel wie: Zwang, Druck, Belastung oder Stress und kann als die Folgen der Anomie für den Einzelnen verstanden werden. Agnew selbst definiert strain wie folgt: „Strain refers to relationships in which others are not treating the individual in the way he or she would like to be treated” (Agnew, 2001, S. 320). Im zweiten Teil der Arbeit wird genauer in diese Theorie ‚individueller Belastungen’ eingeführt und es werden eine Reihe von Randbedingungen für das Zustandekommen von Kriminalität aufgrund dieser ‚Belastungen’ beschrieben. Anhand eines konkreten Beispiels, nämlich der Erklärung unterschiedlicher Kriminalitätsraten von Männern und Frauen, soll abschließend das Erklärpotential der ‚General Strain Theory’ untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Entstehung der Anomietheorie
- 2.1 Durkheim - Anomie als Krise
- 2.2 Merton - Anomie als soziales Problem
- 2.3 Unterschiede des „Anomie“ Begriffs bei Durkheim und Merton
- 2.4 Entwicklung der Anomietheorie im Anschluss an Merton
- 3 Die „General Strain Theory“ von Agnew
- 3.1 Die „General Strain Theory“ als mikro-fundierte Anomietheorie
- 3.2 Wie misst man „Strain“?
- 3.3 Intervenierende Variablen
- 4 Anwendungsbeispiel: Kriminalität und Geschlecht
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Robert Agnews „General Strain Theory“ im Kontext der Anomietheorie. Ziel ist es, die Theorie im historischen Kontext der Anomietheorien Durkheims und Mertons zu verorten und deren mikro-analytische Operationalisierung des Anomiekonzepts zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die Bedeutung des „Strain“-Konzepts und untersucht dessen Erklärpotential anhand eines Anwendungsbeispiels.
- Die historische Entwicklung der Anomietheorie
- Die „General Strain Theory“ als mikro-fundierte Anomietheorie
- Der Begriff „Strain“ und dessen Messung
- Intervenierende Variablen in der „General Strain Theory“
- Anwendung der Theorie auf Kriminalitätsunterschiede zwischen Männern und Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der „General Strain Theory“ von Robert Agnew ein und verortet sie im Kontext der Kriminalsoziologie und der Geschichte der Anomietheorie. Sie erläutert die Bedeutung der Anomietheorie für die Devianzforschung und hebt deren genuin soziologischen Blickwinkel im Vergleich zu biologistischen, psychologischen und ökonomischen Ansätzen hervor. Die Arbeit kündigt die Untersuchung der klassischen Anomietheorien von Durkheim und Merton an, um die „General Strain Theory“ als mikro-analytische Operationalisierung des Anomiekonzepts zu verstehen. Schließlich wird das Anwendungsbeispiel der Erklärung unterschiedlicher Kriminalitätsraten bei Männern und Frauen angekündigt.
2 Die Entstehung der Anomietheorie: Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung des Anomiebegriffs, beginnend mit Durkheims Konzept der Anomie als krisenhafter Gesellschaftszustand, der durch raschen gesellschaftlichen Wandel und die Schwächung des Kollektivbewusstseins entsteht. Es wird Durkheims Analyse der Arbeitsteilung und des Übergangs von mechanischer zu organischer Solidarität erläutert, sowie seine Erklärung für abweichendes Verhalten wie Selbstmord im Kontext von Anomie. Anschließend wird Mertons Anomietheorie vorgestellt, die den Fokus auf den sozialen Druck legt, der Individuen dazu bringt, sich nicht-konform zu verhalten. Mertons Theorie baut auf Durkheim auf, jedoch mit einer stärker strukturellen Perspektive.
3 Die „General Strain Theory“ von Agnew: Dieses Kapitel widmet sich Agnews „General Strain Theory“, die als mikro-fundierte Anomietheorie verstanden wird. Es erklärt den Begriff „Strain“ als individuellen Druck, Belastung oder Stress, der aus der Nicht-Erfüllung von Bedürfnissen und Erwartungen resultiert. Das Kapitel beschreibt verschiedene Arten von „Strain“ und diskutiert, wie dieser gemessen werden kann. Weiterhin werden intervenierende Variablen beleuchtet, die den Zusammenhang zwischen „Strain“ und abweichendem Verhalten beeinflussen.
4 Anwendungsbeispiel: Kriminalität und Geschlecht: Dieses Kapitel wendet die „General Strain Theory“ auf ein konkretes Anwendungsbeispiel an: die Erklärung unterschiedlicher Kriminalitätsraten zwischen Männern und Frauen. Es wird untersucht, wie die Theorie die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Kriminalität erklären kann, indem sie die verschiedenen Arten von „Strain“ und deren Auswirkungen auf Männer und Frauen betrachtet.
Schlüsselwörter
General Strain Theory, Anomietheorie, Durkheim, Merton, Agnew, Kriminalität, Devianz, Strain, sozialer Druck, Belastung, Stress, Kriminalitätsraten, Geschlecht, Mikro-analytische Perspektive, Soziale Ordnung.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: "Die General Strain Theory von Agnew im Kontext der Anomietheorie"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht Robert Agnews „General Strain Theory“ im Kontext der Anomietheorie. Sie verortet die Theorie historisch, beleuchtet ihre mikro-analytische Operationalisierung des Anomiekonzepts und analysiert die Bedeutung des „Strain“-Konzepts anhand eines Anwendungsbeispiels.
Welche Theorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Anomietheorien von Emile Durkheim und Robert Merton als Grundlage und vergleicht sie mit Agnews „General Strain Theory“. Durkheims Anomie wird als krisenhafter Gesellschaftszustand vorgestellt, Mertons Theorie fokussiert den sozialen Druck zu nicht-konformem Verhalten. Agnew erweitert dies mit einer mikro-fundierten Perspektive auf individuellen Stress ("Strain").
Was ist der Kern der "General Strain Theory"?
Die „General Strain Theory“ versteht „Strain“ als individuellen Druck, Belastung oder Stress durch unerfüllte Bedürfnisse und Erwartungen. Die Arbeit untersucht verschiedene Arten von „Strain“, deren Messung und intervenierende Variablen, die den Zusammenhang zwischen „Strain“ und abweichendem Verhalten beeinflussen.
Wie wird das Konzept "Strain" gemessen?
Die Seminararbeit diskutiert die Messung von "Strain", ohne jedoch eine spezifische Messmethode im Detail zu beschreiben. Der Fokus liegt auf dem Verständnis des Konzepts und seiner Bedeutung innerhalb der Theorie.
Welches Anwendungsbeispiel wird verwendet?
Die „General Strain Theory“ wird auf die Erklärung unterschiedlicher Kriminalitätsraten zwischen Männern und Frauen angewendet. Die Arbeit untersucht, wie die Theorie geschlechtsspezifische Unterschiede in der Kriminalität durch verschiedene Arten von „Strain“ und deren Auswirkungen erklären kann.
Welche Schlüsselkonzepte werden behandelt?
Schlüsselkonzepte sind die General Strain Theory, Anomietheorie, Durkheim, Merton, Agnew, Kriminalität, Devianz, Strain, sozialer Druck, Belastung, Stress, Kriminalitätsraten, Geschlecht, Mikro-analytische Perspektive, und Soziale Ordnung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Entstehung der Anomietheorie (Durkheim und Merton), ein Kapitel zur General Strain Theory, ein Anwendungsbeispiel (Kriminalität und Geschlecht) und ein Fazit. Die Einleitung und die Zusammenfassung der Kapitel geben einen detaillierten Überblick über die behandelten Themen.
Wie werden Durkheims und Mertons Anomietheorien unterschieden?
Durkheims Anomie ist ein krisenhafter Gesellschaftszustand durch gesellschaftlichen Wandel und schwaches Kollektivbewusstsein, während Mertons Theorie den sozialen Druck auf Individuen betont, sich nicht-konform zu verhalten. Die Arbeit vergleicht beide Theorien und hebt die Unterschiede hervor.
Welche Rolle spielen intervenierende Variablen?
Intervenierende Variablen beeinflussen den Zusammenhang zwischen „Strain“ und abweichendem Verhalten in der „General Strain Theory“. Die Arbeit beleuchtet diese Variablen, ohne sie explizit zu benennen.
- Quote paper
- Peter Neitzsch (Author), 2006, Die General Strain Theory von Robert Agnew - Eine Fortschreibung anomietheoretischer Ansätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/63240