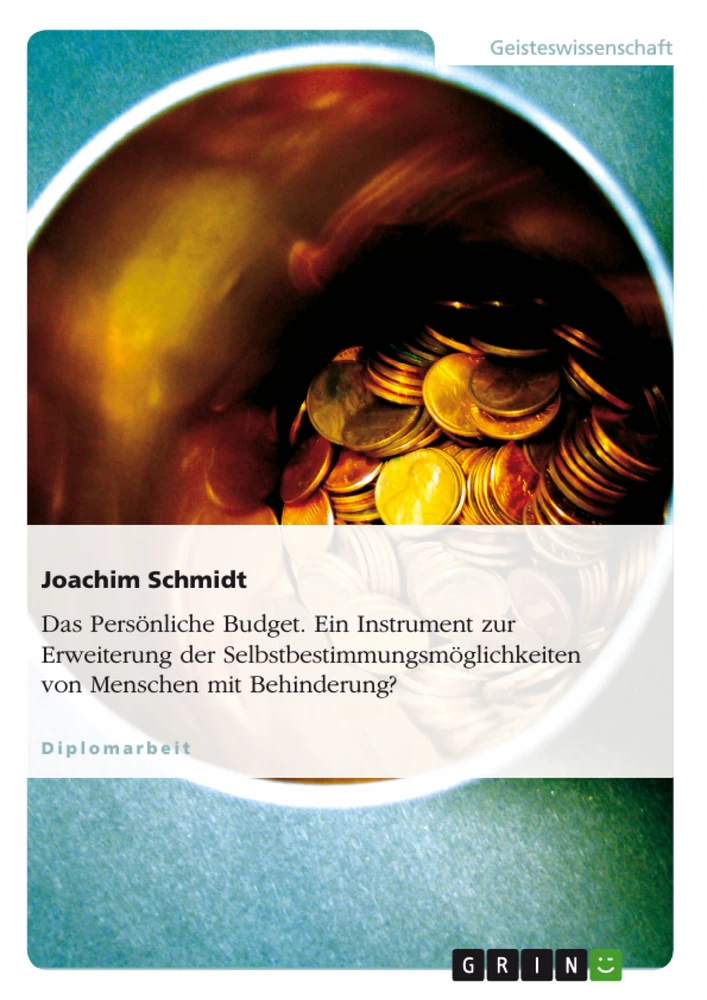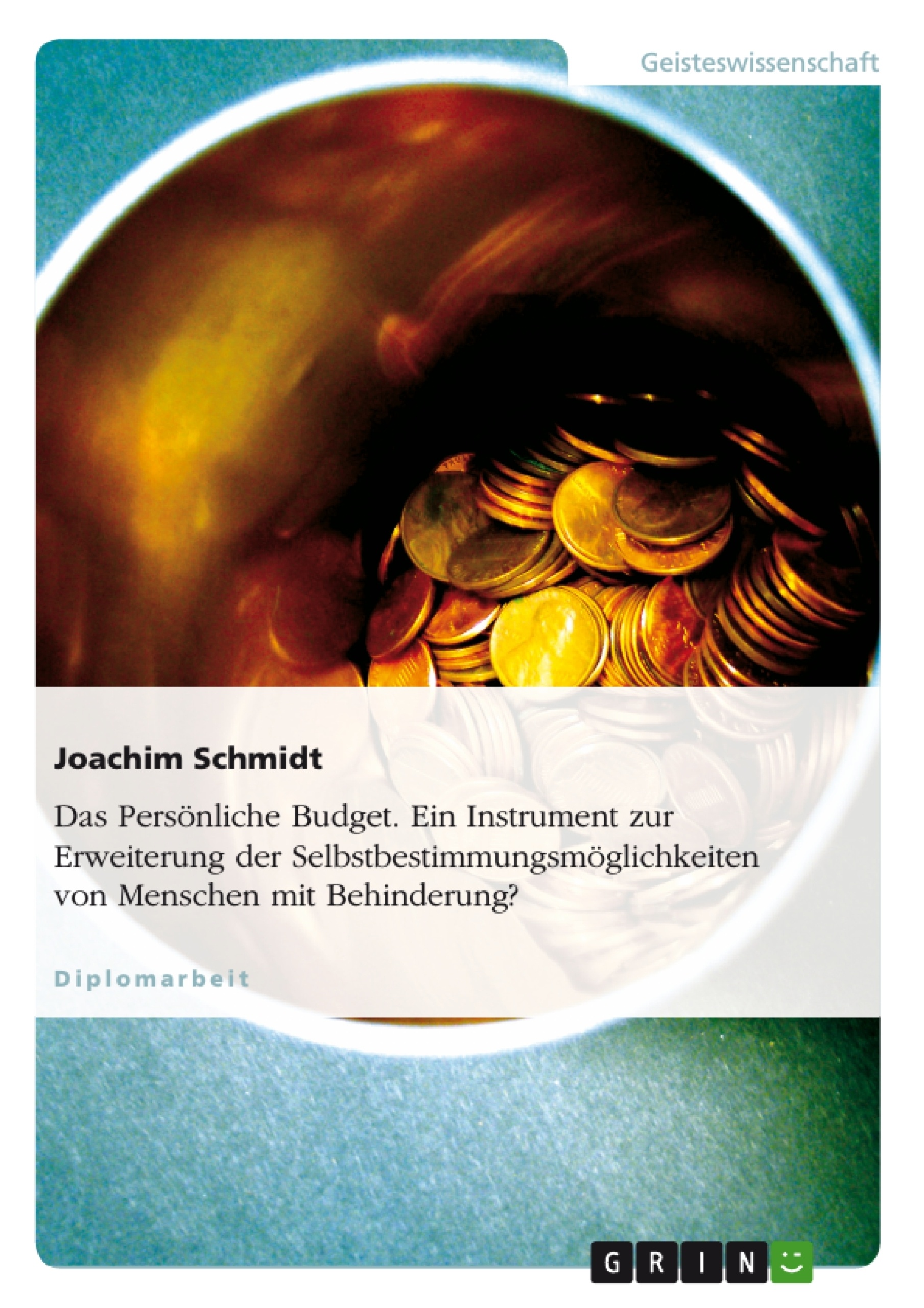Im Bereich der Behindertenhilfe und –politik dürfte das Persönliche Budget die in Deutschland zur Zeit am meisten diskutierte Innovation darstellen. Beim Persönlichen Budget handelt es sich um eine Geldleistung, die ein Mensch mit Behinderung vom Sozialleistungsträger statt der durch einen anerkannten Träger der Wohlfahrtspflege erbrachten Sachleistung erhält. Mit diesem Geld kann er sich direkt eine Hilfeleistung auf dem sozialen Dienstleistungsmarkt einkaufen oder auf andere Weise selbst organisieren. Das Persönliche Budget, so die in der fachlichen und sozialpolitischen Diskussion überwiegend zum Ausdruck gebrachte Auffassung, stelle zumindest von seiner Grundkonstruktion her ein geeignetes Instrument zur Erweiterung der Selbstbestimmungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung dar und sei damit Inbegriff eines behinderungspolitischen Paradigmenwechsels von „fremdbestimmter Fürsorge“ zu „Selbstbestimmung“. Anhand der Individualisierungstheorie nach U. Beck und des Wohlfahrtspluralismusansatzes nach A. Evers/T. Olk beschreibt der Autor zunächst den grundlegenden gesellschaftlichen und institutionellen Kontext des Persönlichen Budgets. Am Beispiel des Modellprojekts in Bielefeld wird dann diskutiert, inwiefern das Persönliche Budget die Erwartung erweiterter Selbstbestimmungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung tatsächlich erfüllen kann. Zum einen kommt der Autor dabei zu dem Ergebnis, dass die Erweiterung von Entscheidungs- und Gestaltungsspielräumen durch das Persönliche Budget aufgrund dessen sozialrechtlicher Konstruktion im spezifischen Kontext des deutschen Wohlfahrtssystems deutlichen Einschränkungen unterliegt. Zum anderen arbeitet er heraus, dass eine Ausweitung des Persönliche Budgets möglicherweise auf Dauer erhebliche strukturelle Risiken für die Lebenslage behinderter Menschen produziert. Neben dem Risiko der Entstehung neuer Abhängigkeitsstrukturen durch eine sich auf den Sozialraum und die Lebenswelt behinderter Menschen ausweitende soziale Kontrolle durch den jeweiligen Kostenträger und dem Risiko einer Verstärkung von Abhängigkeitsstrukturen innerhalb von Familien- und Nachbarschaftskontexten durch eine „Kommerzialisierung“ des informellen Sektors der Wohlfahrtsproduktion, dürfte die dem Persönlichen Budget inhärente Ausweitung der Handlungslogik des Marktes mittel- bis langfristig das größte Risiko für die Lebenslage behinderter Menschen und deren Selbstbestimmungsmöglichkeiten darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Erklärungsansätze
- Die Grundzüge der Individualisierungstheorie
- Niveauverschiebungen
- Einkommen
- Bildung
- Markt-Sektor
- Staats-Sektor
- Sonstige Niveauverschiebungen
- Wohlfahrtspluralismus nach Evers/Olk
- Die vier Sektoren der Wohlfahrtsproduktion
- Staats-Sektor
- Markt-Sektor
- Informeller Sektor
- Nonprofit-Sektor/Intermediärer Bereich
- Die vier Sektoren der Wohlfahrtsproduktion
- Das Persönliche Budget
- Kurze Einführung in das Persönliche Budget
- Entstehungskontext des Persönlichen Budgets
- Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik
- Erklärungsansätze zum Paradigmenwechsel und Persönlichen Budget
- Das Bielefelder Bundesmodellprojekt
- Rechtliche Grundlagen des Bundesmodellprojekts
- Potentiell budgetfähige Leistungen
- Umsetzung des Bielefelder Modellprojekts
- Potenzielle Fallbeispiele
- Erweiterte Selbstbestimmungsmöglichkeiten?
- Vom klassischen Leistungsdreieck zum Persönlichen Budget
- Die Stellung des Leistungsberechtigten beim Sachleistungsbezug
- Die Stellung des Leistungsberechtigten beim Persönlichen Budget
- Neue Spielräume gegenüber den Leistungserbringern
- Die Verpflichtung zum zweckentsprechenden Budgetmitteleinsatz
- Direkte Teilhabeleistungen
- Die Ausweitung der Handlungslogik des Marktes
- Beauftragung von Leistungserbringern ohne Anerkennung
- Der Leistungsberechtigte als Kunde
- Kundenorientierung
- Handlungseffizienz versus Kundenorientierung
- Informeller Sektor und Persönliches Budget
- Das neue Verhältnis zum Leistungsträger
- Durchsetzung von Leistungsansprüchen
- Neue Formen der sozialen Kontrolle durch den Leistungsträger
- Anforderungen an den Budgetnehmer
- Erforderliche Kompetenzen
- Budgetberatung und -unterstützung
- Vom klassischen Leistungsdreieck zum Persönlichen Budget
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, ob das Persönliche Budget die Erwartungen erweiterter Selbstbestimmungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung erfüllen kann. Dazu wird untersucht, wie das Persönliche Budget die Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume von Menschen mit Behinderung im Vergleich zum traditionellen Sachleistungsprinzip beeinflusst. Die Arbeit analysiert dabei das Bundesmodellprojekt zum Persönlichen Budget in Bielefeld und bezieht andere Modellprojekte nur am Rande mit ein.
- Die Relevanz des Persönlichen Budgets für die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung
- Der Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik von "fremdbestimmter Fürsorge" zu "Selbstbestimmung"
- Die Auswirkungen des Persönlichen Budgets auf die Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume von Menschen mit Behinderung
- Die Bedeutung der Individualisierungstheorie und des Wohlfahrtspluralismus für die Analyse des Persönlichen Budgets
- Die Herausforderungen und Chancen des Persönlichen Budgets im Kontext des Bielefelder Modellprojekts
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Persönliche Budget als eine aktuelle Innovation in der Behindertenhilfe und -politik vor. Sie untersucht die Frage, ob das Persönliche Budget die Erwartung erweiterter Selbstbestimmungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung erfüllen kann.
- Theoretische Erklärungsansätze: Dieses Kapitel präsentiert die Individualisierungstheorie von Beck und den Wohlfahrtspluralismusansatz von Evers und Olk als theoretische Modelle, die den gesellschaftlichen und institutionellen Kontext des Persönlichen Budgets beschreiben.
- Das Persönliche Budget: Dieses Kapitel bietet eine kurze Einführung in das Persönliche Budget und beleuchtet dessen Entstehungskontext. Der Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik von "fremdbestimmter Fürsorge" zu "Selbstbestimmung" wird näher untersucht.
- Das Bielefelder Bundesmodellprojekt: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Bundesmodellprojekt zum Persönlichen Budget in Bielefeld. Die rechtlichen Grundlagen des Projekts und zwei potenzielle Fallbeispiele werden vorgestellt.
- Erweiterte Selbstbestimmungsmöglichkeiten?: Dieses Kapitel befasst sich mit der zentralen Fragestellung der Arbeit: Wie wirkt sich das Persönliche Budget auf die Selbstbestimmungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung aus? Es analysiert die neuen Spielräume gegenüber den Leistungserbringern, das neue Verhältnis zum Leistungsträger und die Anforderungen an den Budgetnehmer.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Persönlichen Budget als Instrument zur Erweiterung der Selbstbestimmungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung. Sie beleuchtet die Rolle des Paradigmenwechsels in der Behindertenpolitik von "fremdbestimmter Fürsorge" zu "Selbstbestimmung". Weitere zentrale Themen sind die Individualisierungstheorie, der Wohlfahrtspluralismus, die Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume, die Anforderungen an den Budgetnehmer sowie die rechtlichen Grundlagen und die Umsetzung des Persönlichen Budgets im Kontext des Bielefelder Modellprojekts.
- Arbeit zitieren
- Joachim Schmidt (Autor:in), 2006, Das Persönliche Budget. Ein Instrument zur Erweiterung der Selbstbestimmungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/62358