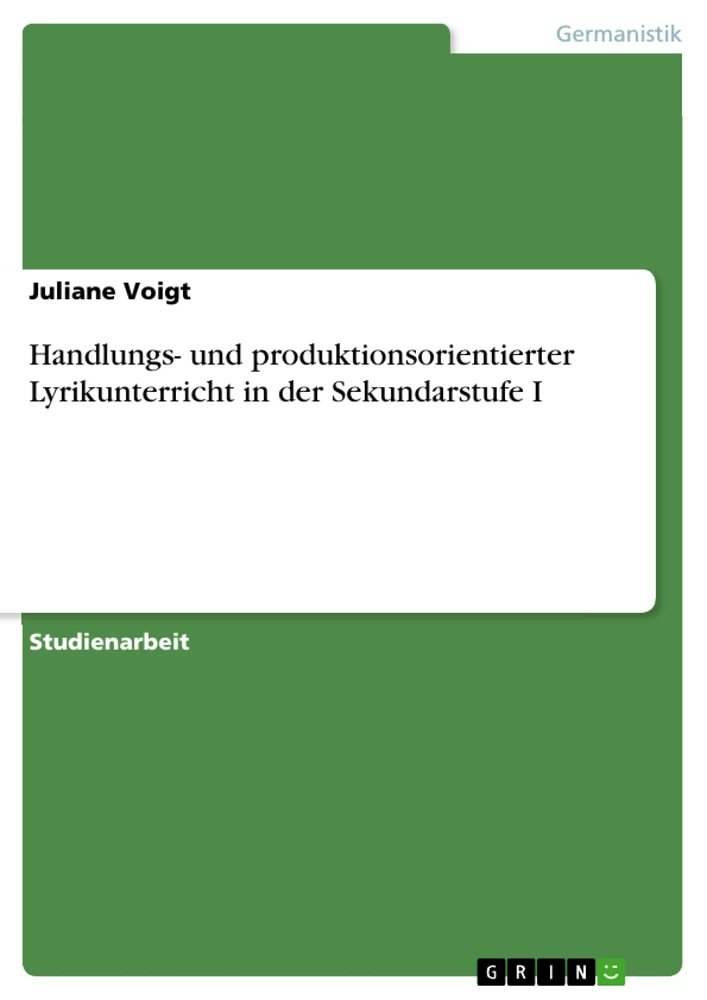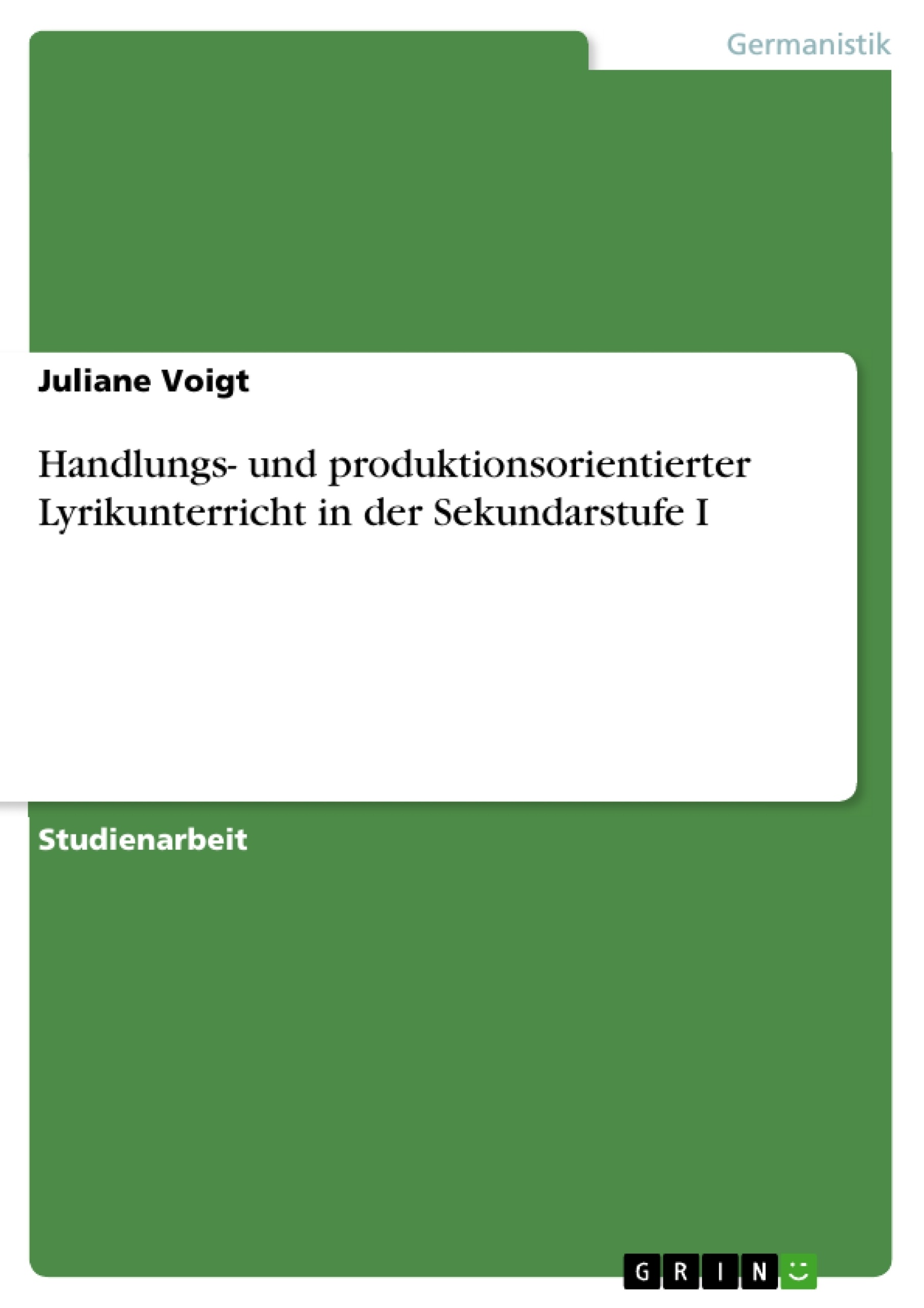Lyrik nervt! Eine Meinung, die nicht nur unter Schülern breite Zustimmung findet. Nicht wenige Studenten der Germanistik, unter ihnen auch angehende Deutsch-Lehrer, würden ebenfalls behaupten, dass sie kaum oder nur schwer Zugang zu lyrischen Texten finden. Lyrik ist jedoch fester Bestandteil der Rahmenlehrpläne für den Deutschunterricht und unter Didaktikern unumstrittene Ingredienz des Fachcolloquiums. Woher kommt die Antipathie unter den Betroffenen? Und wie kann man ihr entgegenwirken?
Antwort auf die erste Frage gibt ein Blick in die Unterrichtspraxis der letzten Jahrzehnte wie ihn Hilbert Meyer darstellt: Mit rund 77% dominiert der Frontalunterricht unter den Sozialformen, das Unterrichtsgespräch ist dabei mit rund 49% das am häufigsten verwendete Handlungsmuster. Für den Lyrikunterricht bedeutet dies ein rein kognitiv-analytisches Vorgehen im gelenkten Lehrer-Schüler-Gespräch, das Interpretation und Aufschlüsselung des Unterrichtsgegenstandes zum Ziel hat. Ein so strukturierter Unterricht wird von Schülern als trocken und langweilig empfunden, was häufig eine negative Einstellung zur ganzen Gattung zur Folge hat.
Nun ist es jedoch u.a. erklärtes Ziel des Deutschunterrichts, die Lesemotivation der Heranwachsenden zu erhalten und zu fördern, denn nur daraus lasse sich laut Rahmenplan eine Lesekompetenz beim Schüler entwickeln. Darüber hinaus soll Sprache als „Material und Mittel für die individuelle produktive und kreative Gestaltung“ erfahrbar werden. Die Verfolgung dieser beiden Ziele liegt den Vertretern des Konzepts eines handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts im besonderen Maße am Herzen. Die von ihnen entwickelten Methoden, die immer mehr Eingang in die aktuellen Lehrpläne finden, sollen als Ergänzung zu den kognitiv-analytischen Verfahren im Unterricht eingesetzt werden, um den Schülern den Zugang zu Literatur zu erleichtern.
Diese Arbeit wird sich mit der Frage beschäftigen, was genau hinter dem Konzept eines handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts steckt. Zunächst sollen dazu die Basis eines handlungsorientierten Unterrichts vorgestellt, um zu erläutern, welche didaktischen Überlegungen und Kriterien die Grundlage eines solchen Literaturunter-richts sind. Anschließend soll das Konzept für den Literaturunterricht im Allgemeinen und den Lyrikunterricht im speziellen vorgestellt werden. Desweiteren wird der Schwerpunkt darauf liegen, die Anwendbarkeit der Konzeption auf den Lyrikunterricht zu prüfen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- HANDLUNGSORIENTIERTER UNTERRICHT
- BEGRIFFSKLÄRUNG
- BEGRÜNDUNGSANSÄTZE
- DIDAKTISCHE KRITERIEN
- DIE ROLLE DER LEHRKRAFT
- VORBEHALTE UND EINWÄNDE
- BEDEUTUNG DES KONZEPTS FÜR DEN LITERATURUNTERRICHT
- HANDLUNGS- UND PRODUKTIONSORIENTIERTER LITERATURUNTERRICHT
- LITERARISCHES LESEN ALS PRODUKTIVES HANDELN
- LYRIK ALS DIFFERENZERFAHRUNG
- HANDLUNGS- UND PRODUKTIONSORIENTIERTER UMGANG MIT LYRISCHEN TEXTEN
- GRUNDSÄTZE ZUR LEISTUNGSBEWERTUNG
- UNTERRICHTSMODELL: EINFÜHRUNG IN DIE VERSLEHRE
- DAS VERSMAB ALS UNTERRICHTSGEGENSTAND
- EINFÜHRUNG DES METRUMS MITHILFE VON KLAPPHORNVERSEN
- ERARBEITUNG: MUSIKALISCHES ERSPIELEN
- SICHERUNG: PARALLELGEDICHT
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept des handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts und untersucht seine Anwendbarkeit auf den Lyrikunterricht, insbesondere im Hinblick auf das Themengebiet Metrum. Ziel ist es, die Grundlagen des handlungsorientierten Unterrichts zu erläutern, die Bedeutung des Konzepts für den Literaturunterricht im Allgemeinen und für den Lyrikunterricht im Speziellen aufzuzeigen sowie die Möglichkeiten der Umsetzung in der Praxis zu demonstrieren.
- Grundlagen des handlungsorientierten Unterrichts
- Bedeutung des Konzepts für den Literaturunterricht
- Anwendbarkeit des Konzepts im Lyrikunterricht
- Das Metrum als Unterrichtsgegenstand
- Entwicklung und Anwendung von Unterrichtsmethoden
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Text beleuchtet die Bedeutung eines handlungsorientierten Ansatzes im Lyrikunterricht, um die Schülermotivation und den Zugang zu lyrischen Texten zu verbessern. Er kritisiert die traditionelle, analytisch-kognitive Vorgehensweise im Lyrikunterricht als ineffektiv und stellt die Ziele des handlungs- und produktionsorientierten Unterrichts vor.
- Handlungsorientierter Unterricht: Dieses Kapitel definiert den Begriff des handlungsorientierten Unterrichts und beschreibt seine historischen Wurzeln und theoretischen Grundlagen, insbesondere die sozialisationstheoretischen und lernpsychologischen Argumente. Die Bedeutung der Schüleraktivität und des aktiven Lernens wird hervorgehoben.
- Bedeutung des Konzepts für den Literaturunterricht: Das Konzept des handlungs- und produktionsorientierten Unterrichts wird auf den Literaturunterricht angewendet und seine Relevanz für die Entwicklung von Lesekompetenz und Sprachkompetenz bei Schülern erläutert.
- Unterrichtsmodell: Einführung in die Verslehre: Dieses Kapitel stellt ein konkretes Unterrichtsmodell zur Einführung in die Verslehre vor. Es beschreibt die Methode, die auf dem Prinzip des musikalischen Erspielens basiert, und beinhaltet die Anwendung von Klapphornversen, Parallelgedichten und anderen interaktiven Elementen.
Schlüsselwörter
Handlungsorientierter Unterricht, produktionsorientierter Literaturunterricht, Lyrikunterricht, Metrum, Verslehre, Schüleraktivität, Lesekompetenz, Sprachkompetenz, Unterrichtsmethoden, Klapphornverse, Parallelgedichte.
- Arbeit zitieren
- Juliane Voigt (Autor:in), 2006, Handlungs- und produktionsorientierter Lyrikunterricht in der Sekundarstufe I, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/61939