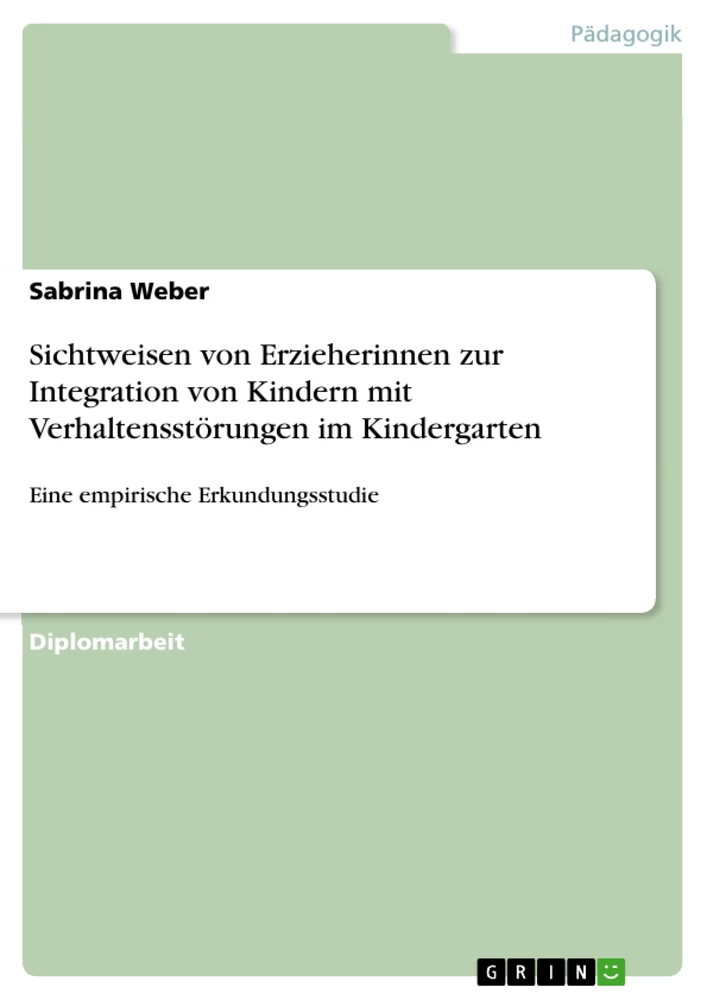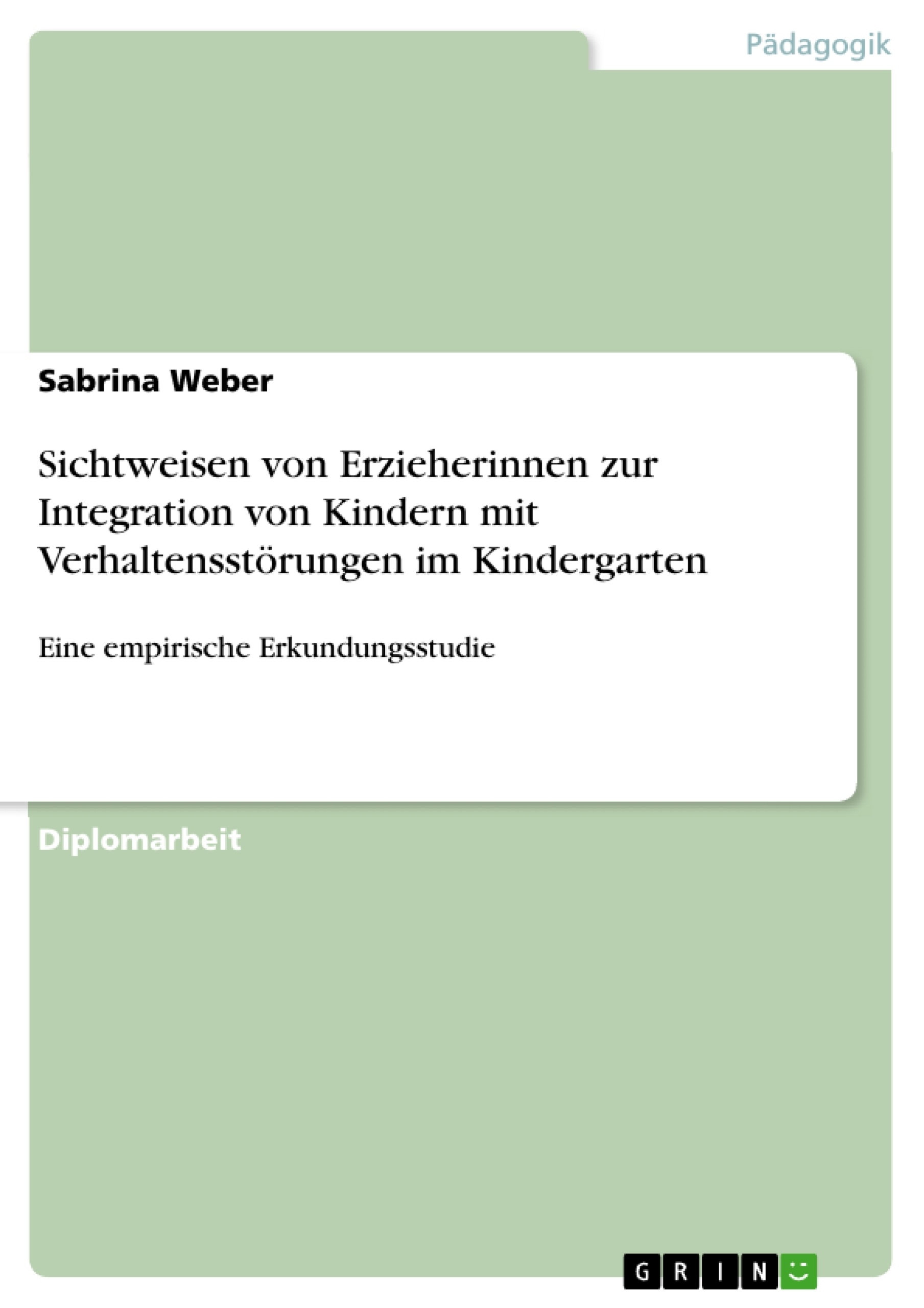Das Thema Integration ist im Kindergarten so aktuell wie nie. Doch wie können speziell Kinder mit auffälligem Verhalten in der Gruppe integrativ gefördert und betreut werden?
In dieser Arbeit werden nicht nur ausführlich die theoretischen Grundlagen der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen im Elementarbereich dargelegt, sondern es kommen auch die Personen zu Wort, welche täglich mit den Kindern arbeiten: die Erzieherinnen. Anhand eines ausführlichen Fragebogens wurden sie nach ihrer Meinung zur Integration dieser Kinder, den dazu notwendigen Voraussetzungen sowie den Fördermöglichkeiten im Kindergarten befragt.
Inhaltsverzeichnis
- TEIL A: KINDER MIT VERHALTENSSTÖRUNGEN UND IHRE INTEGRATIVE FÖRDERUNG IM KINDERGARTEN
- 1 Integration im Elementarbereich
- 1.1 Einführung in die Theorie der integrativen Förderung im Elementarbereich
- 1.2 Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung in Berlin
- 1.3 Rahmenbedingungen für die Integration im Elementarbereich
- 2 Die integrative Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen im Kindergarten
- 2.1 Verhaltensstörungen im Kindergarten
- 2.2 Fördermöglichkeiten im Kindergarten
- TEIL B: PLANUNG UND DURCHFÜHRUNG DER UNTERSUCHUNG
- 3 Entwicklung des Forschungsanliegens
- 4 Darstellung der Untersuchungsmethode
- 5 Die Durchführung der Untersuchung
- TEIL C AUSWERTUNGSVERFAHREN UND ERGEBNISSE
- 6 Auswertungsmethodik
- 7 Die Zusammensetzung der Stichprobe
- 8 Die Einstellungen der Erzieherinnen
- 9 Die für eine erfolgreiche Integration notwendigen Voraussetzungen
- 10 Fördermöglichkeiten für Kinder mit Verhaltensstörungen in integrativen Einrichtungen
- 11 Zusammenfassung und Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Sichtweisen von Erzieherinnen zur Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen im Kindergarten. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Einstellungen, Herausforderungen und Fördermöglichkeiten aus der Perspektive der pädagogischen Fachkräfte zu gewinnen. Die Studie basiert auf einer empirischen Erkundungsstudie mittels Fragebogen.
- Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen im Kindergarten
- Einstellungen und Perspektiven der Erzieherinnen
- Notwendige Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Integration
- Geeignete Fördermöglichkeiten für Kinder mit Verhaltensstörungen
- Verständnis von „Verhaltensstörung“ aus der Sicht der Erzieherinnen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Integration im Elementarbereich: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in die Theorie und Praxis der integrativen Förderung im Elementarbereich. Es beleuchtet bedeutende Grundpositionen der Integrationsbewegung, die Entwicklung der Integration in Deutschland und insbesondere in Berlin, sowie die aktuellen Rahmenbedingungen für integrative Erziehung im Kindergarten. Besonderes Augenmerk liegt auf den Anforderungen an die Qualifikation der Erzieherinnen und Stützpädagoginnen im Kontext der Inklusion.
2 Die integrative Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen im Kindergarten: Der Fokus liegt auf der Definition und dem Ausmaß von Verhaltensstörungen im Kindergarten. Das Kapitel analysiert mögliche Erklärungsansätze für diese Störungen und beleuchtet die Bedeutung der frühen Förderung. Ein zentraler Aspekt ist die Darstellung verschiedener Fördermöglichkeiten im Kindergarten und die Herausforderungen bei der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen, inklusive einer Betrachtung der sozialen Integration dieser Kinder.
3 Entwicklung des Forschungsanliegens: Dieses Kapitel beschreibt den Entstehungsprozess der Forschungsfrage und die Begründung der Wahl der Methodik. Es legt dar, warum die Sichtweisen von Erzieherinnen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen im Kindergarten im Fokus der Studie stehen und wie dies mit der bestehenden Literatur zusammenhängt.
4 Darstellung der Untersuchungsmethode: Hier wird die gewählte Methode der empirischen Untersuchung, die Verwendung eines Fragebogens, detailliert erläutert. Der Aufbau und die Konstruktion des Fragebogens werden beschrieben, um die Validität und Reliabilität der Ergebnisse zu gewährleisten. Die Kapitel beleuchtet den Prozess der Datenerhebung und die spezifischen Fragestellungen, welche mit diesem Instrument untersucht wurden.
5 Die Durchführung der Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt den Ablauf der Datenerhebung, einschließlich der Verteilung der Fragebögen und der resultierenden Rücklaufquote. Es werden methodische Aspekte der Datenerfassung und mögliche Limitationen des gewählten Verfahrens angesprochen.
6 Auswertungsmethodik: Dieses Kapitel erläutert die angewandten statistischen Verfahren zur Analyse der erhobenen Daten und rechtfertigt die Wahl der verwendeten Methoden im Hinblick auf die Fragestellung der Studie. Die Kapitel legt die Grundlage für die Interpretation der in den folgenden Kapiteln präsentierten Ergebnisse.
7 Die Zusammensetzung der Stichprobe: Hier wird die Stichprobe der befragten Erzieherinnen detailliert charakterisiert. Es werden demografische Daten sowie Angaben zum Erfahrungshorizont und der beruflichen Tätigkeit der Teilnehmerinnen präsentiert, um die Repräsentativität und die möglichen Limitationen der Stichprobe zu diskutieren.
8 Die Einstellungen der Erzieherinnen: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Befragung hinsichtlich des Verständnisses von „Verhaltensstörung“, möglicher Bedingungsfaktoren, der Zielsetzungen in der integrativen Förderung und der Bereitschaft zur Integration von Kindern mit verschiedenen Beeinträchtigungen. Die Ansichten der Erzieherinnen über Kinder mit Verhaltensstörungen und deren Integrationsstatus werden analysiert und verglichen.
9 Die für eine erfolgreiche Integration notwendigen Voraussetzungen: Das Kapitel analysiert die von den Erzieherinnen als wichtig erachteten Voraussetzungen für eine erfolgreiche integrative Förderung. Es werden sowohl die notwendigen Eigenschaften der Erzieherinnen als auch die institutionellen und trägerseitigen Rahmenbedingungen untersucht.
10 Fördermöglichkeiten für Kinder mit Verhaltensstörungen in integrativen Einrichtungen: Dieses Kapitel befasst sich mit den von den Erzieherinnen präferierten Therapieformen und den in den Kitaalltag integrierbaren Therapien. Es werden spezielle Fördermöglichkeiten im Kindergarten beleuchtet und wichtige Aspekte in der Arbeit mit Kindern mit Verhaltensstörungen diskutiert.
Schlüsselwörter
Integration, Verhaltensstörungen, Kindergarten, Erzieherinnen, Inklusion, Fördermöglichkeiten, empirische Studie, integrative Förderung, Rahmenbedingungen, Qualifikation.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Integrative Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen im Kindergarten
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die Sichtweisen von Erzieherinnen zur Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen im Kindergarten. Das Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Einstellungen, Herausforderungen und Fördermöglichkeiten aus der Perspektive der pädagogischen Fachkräfte zu gewinnen. Die Studie basiert auf einer empirischen Erkundungsstudie mittels Fragebogen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen im Kindergarten, die Einstellungen und Perspektiven der Erzieherinnen, notwendige Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Integration, geeignete Fördermöglichkeiten für Kinder mit Verhaltensstörungen und das Verständnis von „Verhaltensstörung“ aus der Sicht der Erzieherinnen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Teil A befasst sich mit der integrativen Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen im Kindergarten, Teil B mit der Planung und Durchführung der Untersuchung und Teil C mit den Auswertungsverfahren und Ergebnissen. Die einzelnen Kapitel befassen sich mit der Einführung in die integrative Förderung, Verhaltensstörungen im Kindergarten, der Entwicklung des Forschungsanliegens, der Untersuchungsmethode, der Durchführung der Untersuchung, der Auswertungsmethodik, der Zusammensetzung der Stichprobe, den Einstellungen der Erzieherinnen, notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration, Fördermöglichkeiten und einer Zusammenfassung und Diskussion.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Studie basiert auf einer empirischen Erkundungsstudie mittels Fragebogen. Die Arbeit beschreibt detailliert den Aufbau und die Konstruktion des Fragebogens, den Prozess der Datenerhebung und die spezifischen Fragestellungen, die mit diesem Instrument untersucht wurden. Die Auswertungsmethodik wird ebenfalls ausführlich erläutert.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse präsentieren die Einstellungen der Erzieherinnen zum Thema Verhaltensstörungen, ihre Sichtweisen zu Bedingungsfaktoren, Zielsetzungen in der integrativen Förderung und die Bereitschaft zur Integration. Die Arbeit analysiert die Ansichten der Erzieherinnen über Kinder mit Verhaltensstörungen und deren Integrationsstatus. Weiterhin werden die von den Erzieherinnen als wichtig erachteten Voraussetzungen für eine erfolgreiche integrative Förderung und die präferierten Fördermöglichkeiten beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Integration, Verhaltensstörungen, Kindergarten, Erzieherinnen, Inklusion, Fördermöglichkeiten, empirische Studie, integrative Förderung, Rahmenbedingungen, Qualifikation.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Erzieherinnen, Pädagogen, Studierende der Sozialpädagogik, sowie alle, die sich mit der integrativen Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen im Kindergarten beschäftigen.
Wo finde ich die detaillierten Kapitelzusammenfassungen?
Die Kapitelzusammenfassungen sind im HTML-Dokument enthalten und geben einen detaillierten Überblick über den Inhalt jedes einzelnen Kapitels.
- Quote paper
- Sabrina Weber (Author), 2006, Sichtweisen von Erzieherinnen zur Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen im Kindergarten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/61842