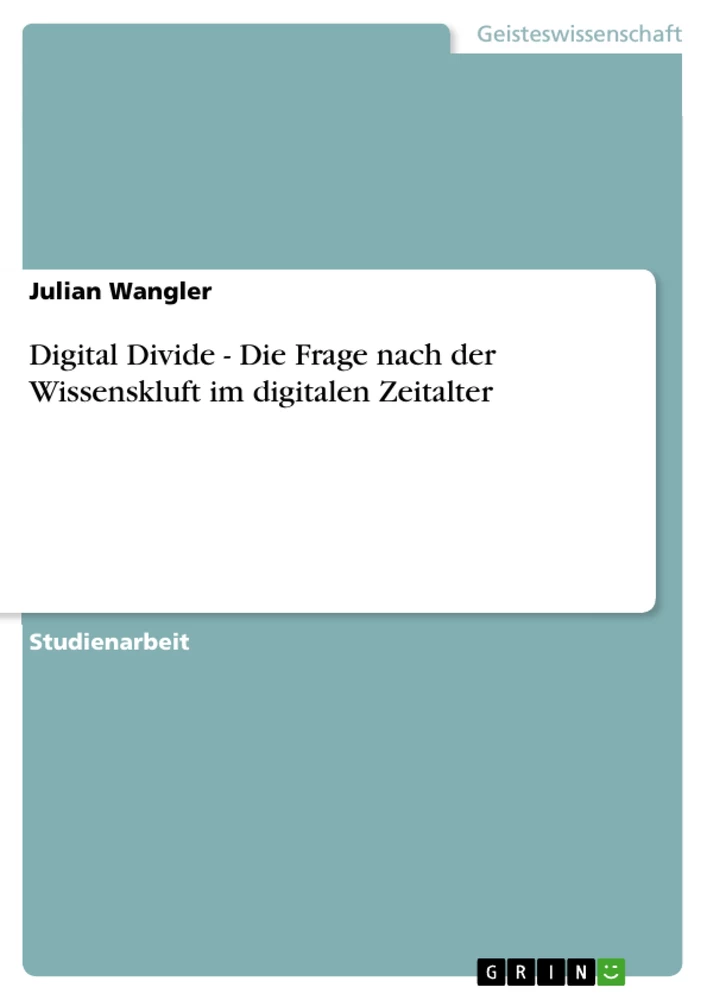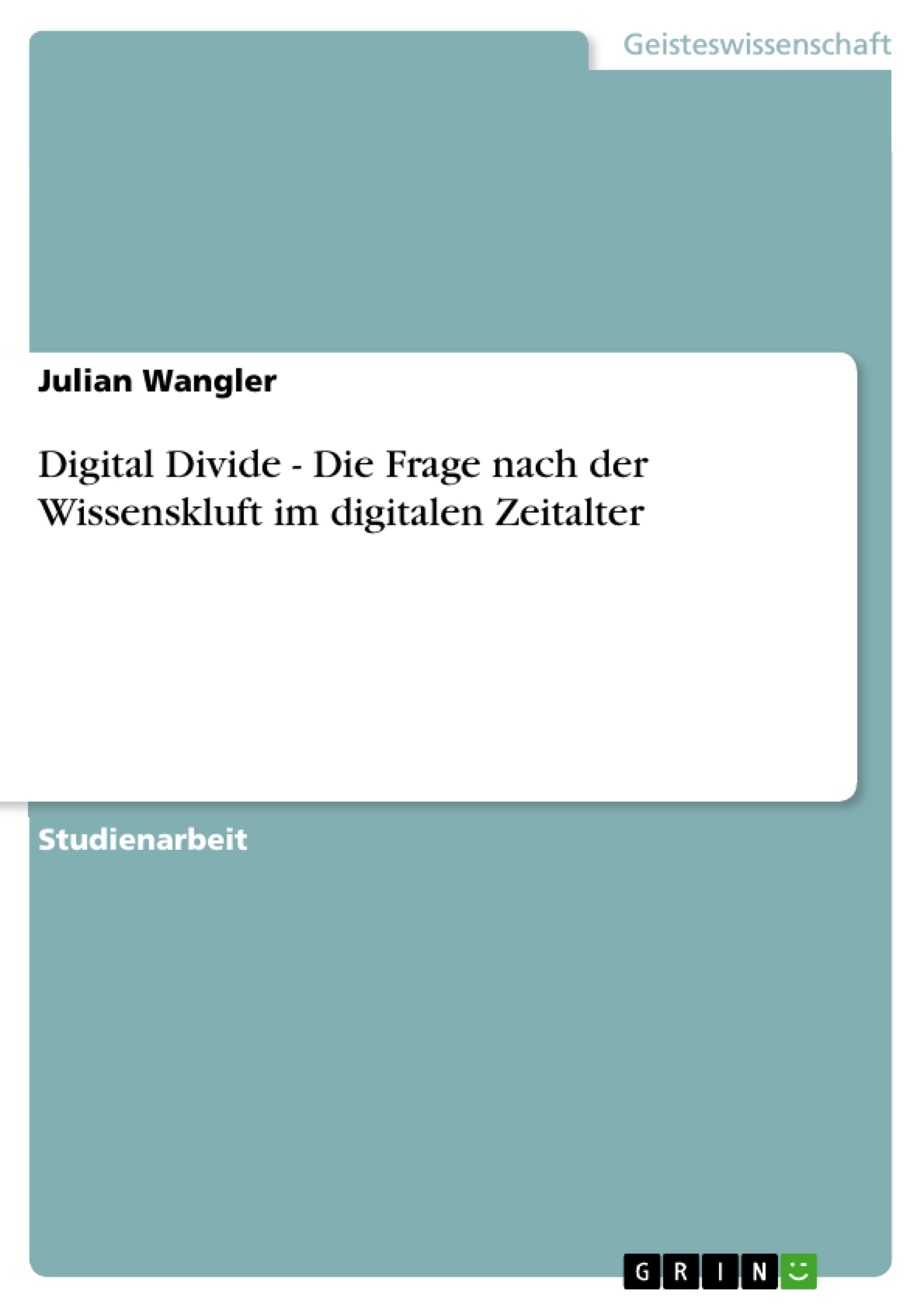Information technology, and the ability to use it and adapt it, is the critical factor in generation and accessing wealth, power, and knowledge in our time. (Castells, Manuel, 1996)
Der Soziologe Manuel Castells drückte mit diesen Worten den vorherrschenden Zeitgeist aus: In den Industriestaaten der Welt hat sich durch den immerzu fortschreitenden Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien ein tief greifender struktureller Wandel ergeben. Das Proprium dieses Wandels ist, dass für das Erstreben und Erlangen von Reichtum und Macht die Information der ausschlaggebende Faktor ist. Eng damit verknüpft ist die Art und Weise, also wie man an Informationen gelangt und diese nutzt.
Nun gibt es aber die Befürchtung, dass aufgrund ungleicher Zugangsmöglichkeiten in modernen Informationsgesellschaften, insbesondere in Bezug auf das Internet, eine soziale Spaltung herbeigeführt wird. Dieses Phänomen wird allgemeinhin als Digital Divide bezeichnet und geht auf die ursprüngliche Theorie von der wachsenden Wissenskluft zurück.
Seit Mitte der neunziger Jahre ist das Thema im Rahmen nationaler und internationaler Politik aufgegriffen worden.
Jedoch teilen längst nicht alle Forscher die Auffassung, dass Digital Divide ein Thema von großer gesellschafts- und wirtschaftspolitischer Brisanz ist. Tatsächlich sind der Begriff und seine Auslegung nach wie vor umstritten.
Die vorliegende Hausarbeit hat das Ziel, den Begriff der Digital Divide zugrunde liegenden Wissenskluft zu definieren, zu klären, warum und wie dieses Phänomen auftreten kann und warum es dem Demokratiebegriff widerspricht. Im Übrigen soll ein knapper Überblick über den Stand der empirischen Forschung und ihrer Probleme geboten werden. In einem zweiten Teil soll auf Digital Divide selbst eingegangen werden, bei dem das Spezifikum Internet im Mittelpunkt steht. In ihrem Verlauf und auch in der Schlussbetrachtung soll diese Hausarbeit zwei zentralen Fragen Rechnung tragen:
1. Handelt es sich bei Digital Divide um ein normales und vorübergehendes Phänomen oder um ein strukturelles, also anhaltendes Defizit in modernen Informationsgesellschaften?
2. Inwieweit kann das Internet zur Entstehung von Wissensklüften beitragen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Von der Wissensklufthypothese zum Digital Divide
- I Die Wissensklufthypothese
- 1 Theoretische Grundlagen
- 1.1 Definition
- 1.2 Ursachen
- 1.3 Ausprägungen
- 1.4 Folgen
- 2 Empirische Wissenskluftforschung
- 2.1 Drei zu untersuchende Dimensionen von Wissensklüften
- 2.2 Erklärungsgrößten von Wissensklüften
- 2.3 Keine eindeutigen empirischen Ergebnisse
- 3 Kritik an der Wissenskluftforschung in Theorie und Praxis
- 3.1 Methodische Mängel
- 3.2 Frage nach Drittfaktoren
- 3.2.1 Defizittheorie vs. Differenztheorie
- 3.3 Sozioökonomische Wandlungen
- 1 Theoretische Grundlagen
- II Digital Divide - Die Wissenskluft des 21. Jahrhunderts?
- 1.1 Definition: Digital Divide
- 1.2 Das Internet
- 1.2.1 Dienste und Anwendungen
- 1.2.2 Zwischenresümee
- 1.2.3 Allgemeiner Zugang – ein mehrschichtiges Problem
- 1.2.4 Zwischenresümee
- 1.2.5 Die Verbreitung des Internets in Deutschland
- 1.2.6 Nationale Initiativen zur Verbreitungsförderung
- Schlussbetrachtung: Keine eindeutige Antwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit verfolgt das Ziel, den Begriff der Digital Divide zugrunde liegenden Wissenskluft zu definieren, zu klären, warum und wie dieses Phänomen auftreten kann und warum es dem Demokratiebegriff widerspricht. Des Weiteren wird ein knapper Überblick über den Stand der empirischen Forschung und ihrer Probleme gegeben. Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit Digital Divide selbst, wobei das Internet im Mittelpunkt steht.
- Definition und Erklärung der Wissenskluft
- Kritik an der Wissenskluftforschung
- Digital Divide als Phänomen des 21. Jahrhunderts
- Der Einfluss des Internets auf Wissensklüfte
- Demokratiebegriff und Digital Divide
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Von der Wissensklufthypothese zum Digital Divide
Die Einleitung führt in die Thematik der Digital Divide ein und stellt die Wissensklufthypothese als Ausgangspunkt für die Diskussion dar. Sie beleuchtet den tiefgreifenden strukturellen Wandel in den Industriestaaten durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien. Die Einleitung stellt die Frage, ob die ungleichen Zugangsmöglichkeiten in modernen Informationsgesellschaften, insbesondere in Bezug auf das Internet, zu einer sozialen Spaltung führen. Das Phänomen des Digital Divide wird als problematisch dargestellt, da es dem Demokratiebegriff widerspricht.
I Die Wissensklufthypothese
Dieses Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Wissensklufthypothese, ihrer Definition, Ursachen, Ausprägungen und Folgen. Es wird die Kritik an der Wissenskluftforschung in Theorie und Praxis beleuchtet, wobei methodische Mängel und die Frage nach Drittfaktoren im Fokus stehen. Die Bedeutung von sozioökonomischen Wandlungen im Kontext der Wissenskluft wird ebenfalls behandelt.
II Digital Divide - Die Wissenskluft des 21. Jahrhunderts?
Dieses Kapitel untersucht die Definition des Begriffs "Digital Divide" und betrachtet das Internet als spezifisches Beispiel. Es werden die Dienste und Anwendungen des Internets analysiert und die Frage des allgemeinen Zugangs zu diesem Medium als mehrschichtiges Problem dargestellt. Der Fokus liegt auf der Verbreitung des Internets in Deutschland und auf nationalen Initiativen zur Verbreitungsförderung.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Wissenskluft, Digital Divide, Informationsgesellschaft, Medienwirkungsforschung, Internet, Zugangsmöglichkeiten, soziale Spaltung, Demokratiebegriff, empirische Forschung, Defizittheorie, Differenztheorie, sozioökonomische Wandlungen.
- Quote paper
- Julian Wangler (Author), 2006, Digital Divide - Die Frage nach der Wissenskluft im digitalen Zeitalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/60834