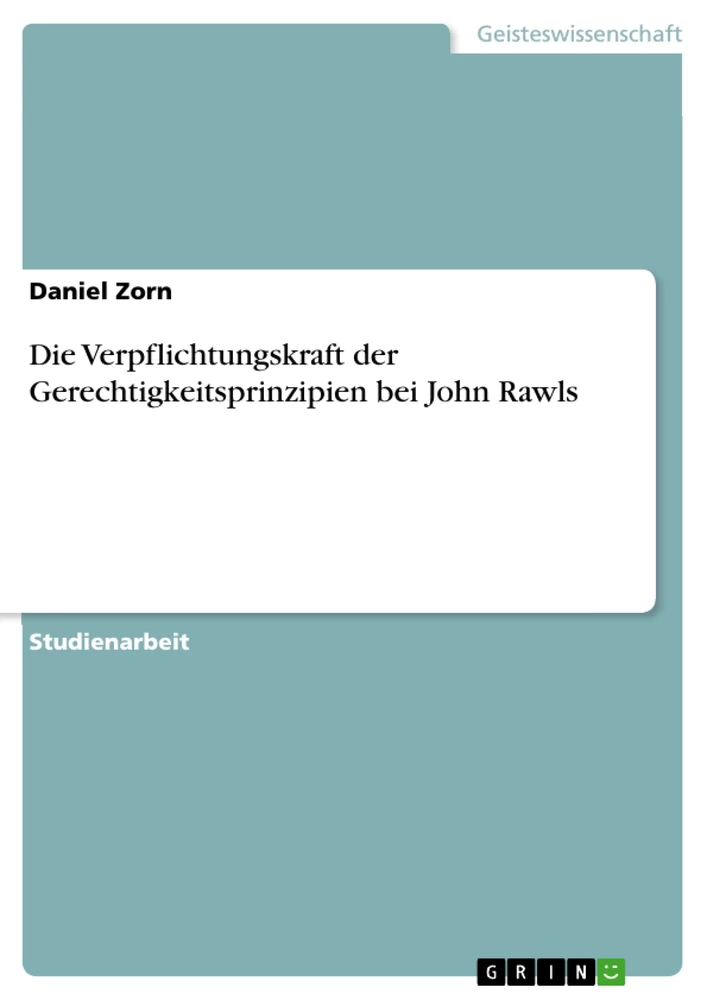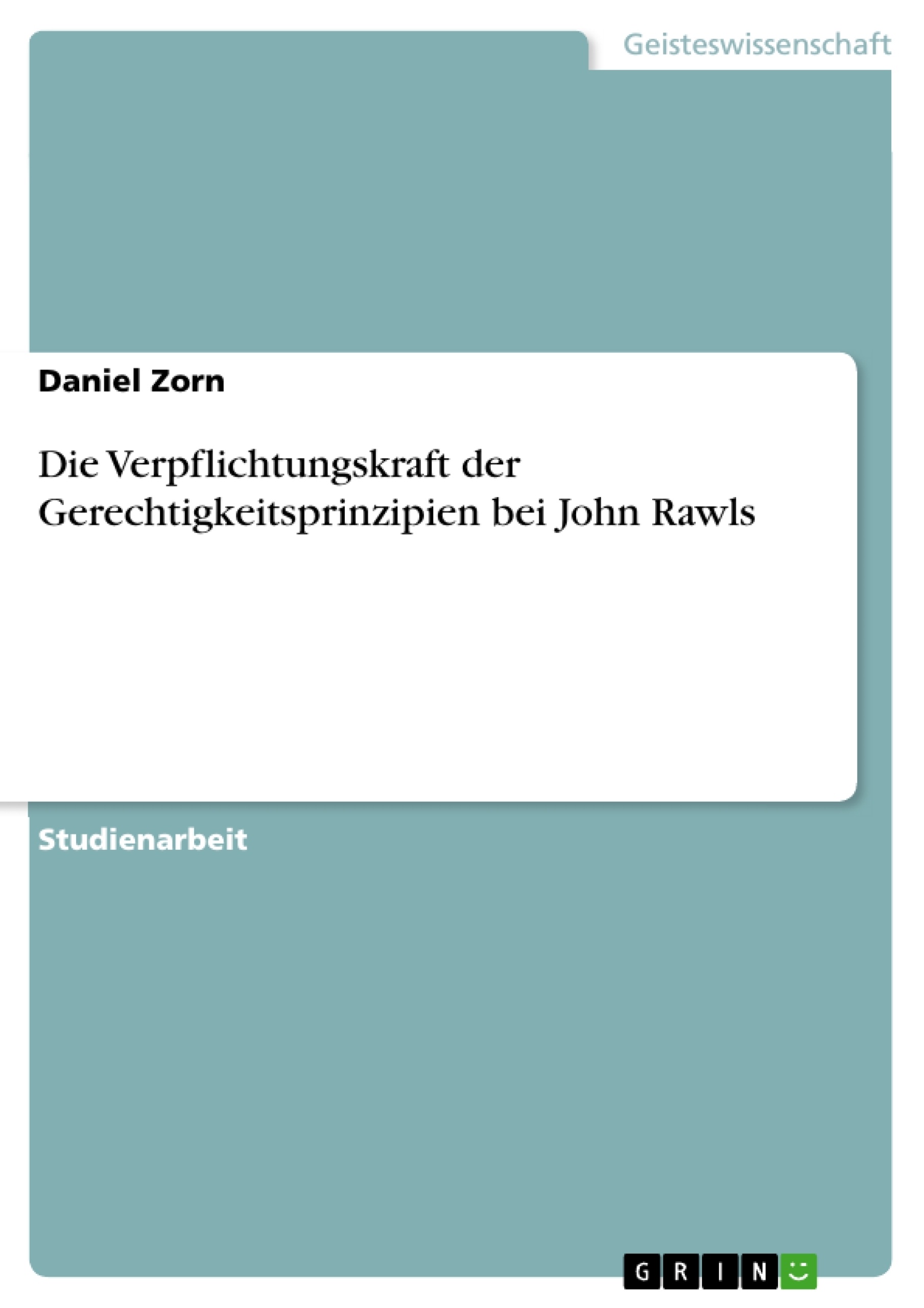Ein chinesisches Sprichwort besagt „Ein gerechtes Urteil findet nur, wer sich öffentlich berät“. Tiefsinnig, wie chinesische Sprichwörter manchmal sind, verrät dieses eine Verbindung zwischen dem kaum fassbaren Begriff der Gerechtigkeit und einem Konsensurteil, das nicht von einem, sondern von allen getroffen wird. Was in dem Aphorismus nur intuitiv anklingt, das hat der amerikanische Philosoph John Rawls in seiner „Theorie der Gerechtigkeit“ systematisch untersucht. Grundlage diese Theorie sind zwei Prinzipien der Gerechtigkeit, anhand derer man ebenso gut wie mit einer öffentlichen Beratung, feststellen können soll, ob etwas gerecht ist oder nicht. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit der Frage, ob eine bestimmte Verpflichtungskraft von diesen beiden Prinzipien ausgeht und wenn ja, wie diese gefasst werden kann. In meiner Darstellung werde ich – neben dem Hauptwerk aus dem Jahr 1971 „Eine Theorie der Gerechtigkeit“ und einigen Aufsätzen, die unter dem Titel „Gerechtigkeit als Fairness“ erschienen sind – vor allem auf die aktuellste und gleichzeitig finale Bearbeitung durch Rawls zurückgreifen. Sie trägt im Deutschen den Namen „Gerechtigkeit als Fairness – Ein Neuentwurf“ und enthält eine teilweise Neuformulierung des Schlüsseltextes aus dem Hauptwerk. Final ist sie deswegen, weil Rawls noch vor Beendigung der letzten Feinarbeiten im Jahr 2002 im Alter von 81 Jahren verstarb.
In meiner Arbeit beschäftige ich mich mit der Frage, woher die Gerechtigkeitsprinzipien ihre Verpflichtungskraft beziehen. Hierzu muss – in einem ersten, ausführlichen Schritt – die Grundlage der beiden Prinzipien umrissen werden, die mit Begriffen wie „Grundgüter“, „Urzustand“ und „Schleier des Unwissens“ verbunden ist, welche ich zunächst erklären werde. In einem zweiten Schritt widme ich mich dann dem Problem der Verpflichtungskraft für die die Gesellschaft konstituierenden Institutionen. In diesem Teil meiner Untersuchung will ich dann auch einige Fragen stellen, die ich „mit Rawls“ zu beantworten versuche. Dabei soll die argumentative Struktur der Prinzipien deutlich werden und es soll vor allem die Anwendbarkeit der Rawls’schen Prinzipien im Diskurs getestet werden. Zum Abschluss will ich mein persönliches Fazit geben und eine weitere Verknüpfung anbieten, die dann über diese Arbeit hinausweist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A. Die zwei Prinzipien der Gerechtigkeit bei John Rawls
- 1. Darstellung und Erläuterung
- 2. Die Funktion der Prinzipien in der Gerechtigkeitstheorie von John Rawls
- 3. Die grundlegenden Bedingungen für die Gerechtigkeitsprinzipien: Grundgüter, Urzustand und Schleier des Unwissens
- a) Grundgüter
- b) Der Urzustand und der Schleier des Unwissens
- B. Die Verpflichtungskraft der Prinzipien
- 1. Im Hinblick auf die Institutionen
- 2. Im Hinblick auf die sprachliche Struktur der Prinzipien
- C. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und wie die beiden Gerechtigkeitsprinzipien von John Rawls eine Verpflichtungskraft besitzen. Sie analysiert die Grundlage dieser Prinzipien, insbesondere die Konzepte der Grundgüter, des Urzustands und des Schleiers des Unwissens. Anschließend wird die Frage der Verpflichtungskraft im Hinblick auf die Institutionen und die sprachliche Struktur der Prinzipien behandelt.
- Die zwei Prinzipien der Gerechtigkeit bei John Rawls
- Die Bedeutung der Grundgüter, des Urzustands und des Schleiers des Unwissens
- Die Verpflichtungskraft der Prinzipien für die Institutionen
- Die Rolle der sprachlichen Struktur der Prinzipien
- Die Anwendbarkeit der Rawls'schen Prinzipien im Diskurs
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die These auf, dass die Gerechtigkeitsprinzipien von John Rawls eine Verpflichtungskraft besitzen und beleuchtet den Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Konsens. Sie führt die beiden Hauptprinzipien der Gerechtigkeitstheorie ein und beschreibt die Ziele der Arbeit, die sich auf die Frage der Verpflichtungskraft konzentriert.
- A. Die zwei Prinzipien der Gerechtigkeit bei John Rawls: Dieser Abschnitt beschreibt die beiden Prinzipien der Gerechtigkeit, die Rawls in seiner Theorie der Gerechtigkeit formuliert. Er unterscheidet zwischen formaler und substantieller Gerechtigkeit und erklärt die Funktion der Prinzipien in der Gestaltung eines modernen demokratischen Staates.
- B. Die Verpflichtungskraft der Prinzipien: Der zweite Teil der Arbeit untersucht die Verpflichtungskraft der Prinzipien im Hinblick auf die Institutionen und die sprachliche Struktur der Prinzipien. Er stellt Fragen zur Anwendbarkeit der Prinzipien im Diskurs und beleuchtet die argumentative Struktur der Prinzipien.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Gerechtigkeitstheorie von John Rawls, insbesondere auf seine beiden Prinzipien der Gerechtigkeit, den Urzustand, den Schleier des Unwissens, die Grundgüter und die Verpflichtungskraft dieser Prinzipien. Sie untersucht die Bedeutung dieser Prinzipien für die Gestaltung einer gerechten Gesellschaft und ihre Anwendbarkeit im politischen Diskurs.
- Quote paper
- Daniel Zorn (Author), 2006, Die Verpflichtungskraft der Gerechtigkeitsprinzipien bei John Rawls, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/60726