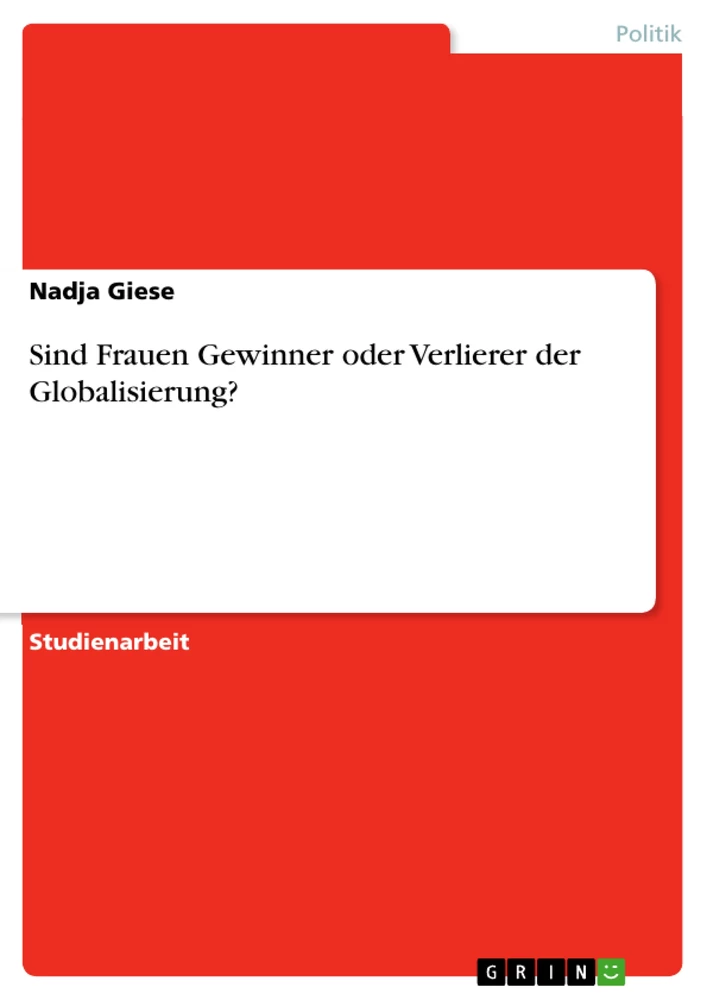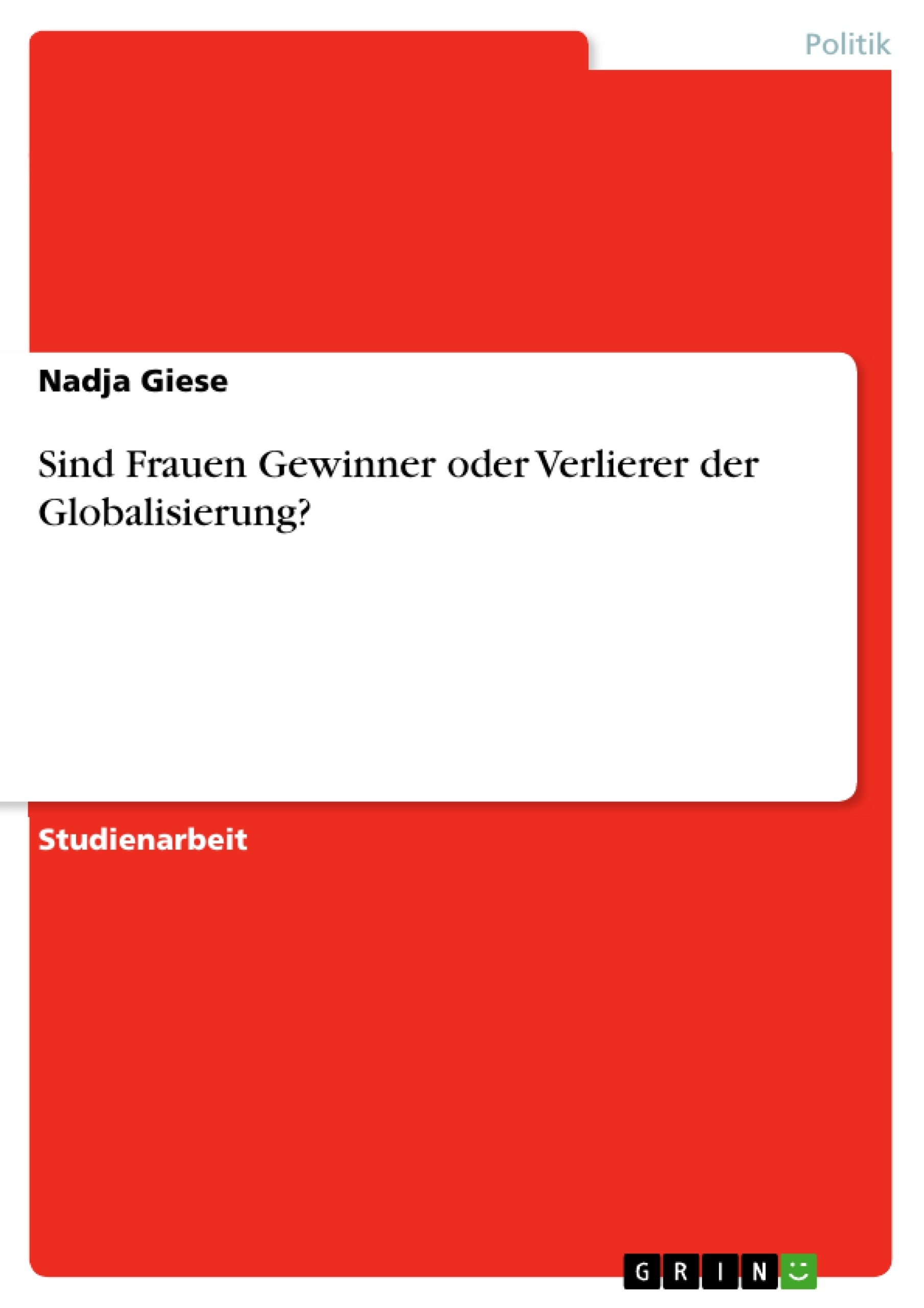Frau Christa Wichterich, Soziologin und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von Attac formuliert folgende These zur Globalisierung; „Die neoliberalistische Globalisierung nutzt die hierarchischen Geschlechterverhältnisse und andere soziale Ungleichheiten, um sich über Mechanismen wie Konkurrenz und Polarisierung, Aufwertung und Abwertung, Ausschluss und Integration durchzusetzen.“. Das neoliberalistische Regime baut auf bestehende Geschlechterverhältnisse auf, modernisiert sie aber gemäß der Markt-, Effizienz- und Wettbewerbslogik. Zusammenfassend gesagt, Globalisierungsprozesse haben unterschiedliche Auswirkungen auf Männer und Frauen und sie realisieren sich über die Geschlechterordnung.
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern gehört zu den ungelösten Problemen der Weltentwicklung. Bisher haben Frauen in keiner Gesellschaft die gleichen Chancen auf ein gutes Leben wie Männer. Tagtäglich werden wir damit konfrontiert, sei es im eigenen gelebten Alltag oder wir erfahren aus der Zeitung und dem Fernsehen von benachteiligten Frauen in anderen Ländern. Welche Auswirkungen hat Globalisierung auf die Geschlechterungleichheit? Sind Frauen Verlierer der Globalisierung oder eröffnen sich ihnen dadurch Möglichkeiten und Chancen zur Gleichberechtigung. Kapitel 2 setzt sich mit der Definition der Globalisierung auseinander und macht diese anhand eines Beispiels anschaulich. In Kapitel 3 sind geschlechtsbezogene Daten zu finden und Verfahren zur Messung, die die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen widerspiegeln. Die feministische Perspektive zur Ökonomie findet eine kurze Erläuterung in Kapitel 4. Eine kurze Auseinandersetzung mit den differenten Zugangsbedingungen von Frauen und Männern erfolgt in Kapitel 5. In Kapitel 6 wird deutlich, weshalb in Entwicklungsländern gerade Frauen für die Industrie einen Standortvorteil bedeuten. Das nächste Kapitel beschreibt die Frauenarbeit in den Entwicklungs- und Industrieländern. Nicht zuletzt stellt sich dann die Frage, ob die Ausübung einer Tätigkeit zu mehr Partizipation führen kann und damit zur Gleichberechtigung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition Globalisierung
- 3. Zahlen zur Geschlechterungleichheit/ Geschlechterindizes
- 4. Feministische Ökonomie
- 5. Ausgangsbedingungen
- 5.1. Zugang zu Qualifikation
- 5.2. Zugang zu ökonomischen Ressourcen
- 6. Standortvorteil Frau
- 7. Frauenarbeit
- 7.1. Frauen in Industrieländern
- 7.2. Frauen in Entwicklungsländern
- 7.2.1. Der informelle Sektor
- 8. Emanzipation durch Arbeit?
- 9. Rechtliche Regelungen
- 10. Gender Mainstreaming und Empowerment
- 11. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Globalisierung auf die Geschlechterungleichheit. Ziel ist es, zu analysieren, ob Frauen von Globalisierungsprozessen profitieren oder benachteiligt werden. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte, um ein umfassendes Bild zu zeichnen.
- Definition und Auswirkungen der Globalisierung
- Geschlechterungleichheit und deren Messung
- Feministische ökonomische Perspektiven
- Zugang von Frauen zu Ressourcen und Qualifikationen
- Frauenarbeit in Industrie- und Entwicklungsländern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Auswirkungen der Globalisierung auf Frauen. Sie präsentiert die These von Christa Wichterich, die die neoliberale Globalisierung als ausbeuterisch gegenüber bestehenden Geschlechterverhältnissen beschreibt. Die Einleitung umreißt die Struktur der Arbeit und kündigt die einzelnen Kapitel mit ihren jeweiligen Schwerpunkten an. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Chancen und Risiken der Globalisierung für Frauen und der Auseinandersetzung mit der Frage, ob diese zu Gewinnerinnen oder Verliererinnen werden.
2. Definition Globalisierung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Globalisierung anhand eines Beispiels der Jeansproduktion, welches die komplexen und global vernetzten Produktionsketten verdeutlicht. Es werden verschiedene Definitionen aus der Fachliteratur herangezogen, die die Globalisierung als einen multidimensionalen Prozess beschreiben, der Märkte und Produktionen vernetzt und gesellschaftliche Verhältnisse über nationale Grenzen hinweg neu ordnet. Die Darstellung der Globalisierung als widersprüchlicher Prozess, der sowohl Chancen als auch Risiken für marginalisierte Gruppen birgt, wird hervorgehoben.
3. Zahlen zur Geschlechterungleichheit/ Geschlechterindizes: Dieses Kapitel präsentiert statistische Daten und Messverfahren zur Geschlechterungleichheit. Es werden Indikatoren vorgestellt, die die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen in verschiedenen Bereichen aufzeigen und quantifizieren. Die Daten dienen als Grundlage für die weitere Analyse und die Bewertung der Auswirkungen der Globalisierung auf die Geschlechterverhältnisse.
4. Feministische Ökonomie: Kapitel 4 bietet einen kurzen Überblick über die feministische Ökonomie. Es werden zentrale Konzepte und Perspektiven dieser Disziplin vorgestellt, die die Geschlechterverhältnisse als konstitutiv für ökonomische Prozesse begreifen. Die feministische Ökonomie liefert somit einen wichtigen analytischen Rahmen für die Untersuchung der Auswirkungen der Globalisierung auf Frauen.
5. Ausgangsbedingungen: In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen von Frauen und Männern hinsichtlich des Zugangs zu Qualifikation und ökonomischen Ressourcen beleuchtet. Dies stellt den Kontext für die weitere Analyse dar und zeigt die strukturellen Ungleichheiten auf, die von Globalisierungsprozessen beeinflusst werden. Es werden die unterschiedlichen Zugangsbarrieren für Frauen in Bezug auf Bildung und wirtschaftliche Teilhabe im Detail erläutert.
6. Standortvorteil Frau: Dieses Kapitel untersucht, warum Frauen in Entwicklungsländern für die Industrie einen Standortvorteil darstellen können. Die Analyse konzentriert sich auf die Gründe für diese scheinbar paradoxe Situation und setzt dies in Beziehung zu den in den vorherigen Kapiteln besprochenen Aspekten der Geschlechterungleichheit und der Globalisierung.
7. Frauenarbeit: Kapitel 7 beschreibt die Situation von Frauen in der Arbeitswelt, getrennt nach Industrieländern und Entwicklungsländern. Es wird der Unterschied in den Arbeitsbedingungen, den Tätigkeitsfeldern und den Einkommen dargelegt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bedeutung des informellen Sektors in Entwicklungsländern. Das Kapitel analysiert die unterschiedlichen Herausforderungen und Möglichkeiten für Frauen im Arbeitsleben in Abhängigkeit vom Kontext.
8. Emanzipation durch Arbeit?: In diesem Kapitel wird die Frage diskutiert, inwieweit Erwerbstätigkeit zur Emanzipation von Frauen beiträgt und ob dies zur Gleichberechtigung führt. Die Analyse setzt die Ergebnisse der vorherigen Kapitel in Beziehung zueinander und erörtert die komplexen Zusammenhänge zwischen Arbeit, Geschlechterrollen und der Möglichkeit zur selbstbestimmten Lebensführung.
9. Rechtliche Regelungen: Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen Regelungen und internationalen Harmonisierungsbestrebungen im Bereich der Gleichstellungspolitik am Arbeitsmarkt. Es untersucht, welchen Einfluss diese Regelungen auf die Situation von Frauen haben und wie effektiv sie im Hinblick auf die Reduzierung von Geschlechterungleichheiten sind.
10. Gender Mainstreaming und Empowerment: Das Kapitel erörtert zwei wichtige politische Ansätze zur Gleichstellung der Geschlechter: Gender Mainstreaming und Empowerment. Es analysiert die jeweiligen Strategien, Ziele und die Möglichkeiten, Geschlechtergerechtigkeit in verschiedenen Bereichen zu fördern. Die unterschiedlichen Ansätze und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile werden miteinander verglichen.
Schlüsselwörter
Globalisierung, Geschlechterungleichheit, Frauenarbeit, Entwicklungsländer, Industrieländer, Feministische Ökonomie, Gender Mainstreaming, Empowerment, Rechtliche Regelungen, Standortvorteil.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema: Auswirkungen der Globalisierung auf die Geschlechterungleichheit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Globalisierung auf die Geschlechterungleichheit. Sie analysiert, ob Frauen von Globalisierungsprozessen profitieren oder benachteiligt werden und beleuchtet verschiedene Aspekte, um ein umfassendes Bild zu zeichnen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die Definition und Auswirkungen der Globalisierung, die Messung von Geschlechterungleichheit mittels verschiedener Indikatoren, feministische ökonomische Perspektiven, den Zugang von Frauen zu Ressourcen und Qualifikationen, sowie die Situation von Frauenarbeit in Industrie- und Entwicklungsländern, rechtliche Regelungen, Gender Mainstreaming und Empowerment.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Definition Globalisierung, Zahlen zur Geschlechterungleichheit, Feministische Ökonomie, Ausgangsbedingungen (Zugang zu Qualifikation und Ressourcen), Standortvorteil Frau, Frauenarbeit (in Industrie- und Entwicklungsländern, inklusive des informellen Sektors), Emanzipation durch Arbeit, Rechtliche Regelungen, Gender Mainstreaming und Empowerment, und Fazit.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie wirken sich Globalisierungsprozesse auf Frauen aus – profitieren sie davon oder werden sie benachteiligt?
Welche These wird in der Einleitung vorgestellt?
Die Einleitung präsentiert die These von Christa Wichterich, die die neoliberale Globalisierung als ausbeuterisch gegenüber bestehenden Geschlechterverhältnissen beschreibt.
Wie wird Globalisierung definiert?
Globalisierung wird anhand eines Beispiels der Jeansproduktion veranschaulicht und als multidimensionaler Prozess definiert, der Märkte und Produktionen vernetzt und gesellschaftliche Verhältnisse über nationale Grenzen hinweg neu ordnet. Sie wird als widersprüchlicher Prozess dargestellt, der sowohl Chancen als auch Risiken birgt.
Welche Daten werden zur Messung der Geschlechterungleichheit verwendet?
Das Kapitel zu Geschlechterindizes präsentiert statistische Daten und Messverfahren, um die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen in verschiedenen Bereichen aufzuzeigen und zu quantifizieren. Diese Daten dienen als Grundlage für die weitere Analyse.
Welche Rolle spielt die feministische Ökonomie?
Die feministische Ökonomie liefert einen wichtigen analytischen Rahmen. Sie begreift Geschlechterverhältnisse als konstitutiv für ökonomische Prozesse.
Wie werden die Ausgangsbedingungen von Frauen und Männern beschrieben?
Die Ausgangsbedingungen werden hinsichtlich des Zugangs zu Qualifikation und ökonomischen Ressourcen beleuchtet, um die strukturellen Ungleichheiten aufzuzeigen, die von Globalisierungsprozessen beeinflusst werden.
Warum stellt der "Standortvorteil Frau" in Entwicklungsländern ein Paradox dar?
Dieses Kapitel analysiert, warum Frauen in Entwicklungsländern für die Industrie einen Standortvorteil darstellen können und setzt dies in Beziehung zu den Aspekten der Geschlechterungleichheit und der Globalisierung.
Wie wird die Situation von Frauenarbeit dargestellt?
Die Situation von Frauen in der Arbeitswelt wird getrennt nach Industrieländern und Entwicklungsländern beschrieben, wobei der informelle Sektor in Entwicklungsländern einen besonderen Fokus erhält.
Trägt Erwerbstätigkeit zur Emanzipation von Frauen bei?
Dieses Kapitel diskutiert die Frage, inwieweit Erwerbstätigkeit zur Emanzipation von Frauen beiträgt und ob dies zur Gleichberechtigung führt. Die komplexen Zusammenhänge zwischen Arbeit, Geschlechterrollen und selbstbestimmter Lebensführung werden erörtert.
Welche rechtlichen Regelungen werden betrachtet?
Das Kapitel beleuchtet die rechtlichen Regelungen und internationalen Harmonisierungsbestrebungen im Bereich der Gleichstellungspolitik und deren Einfluss auf die Situation von Frauen.
Was sind Gender Mainstreaming und Empowerment?
Das Kapitel erörtert diese beiden politischen Ansätze zur Gleichstellung der Geschlechter, analysiert ihre Strategien, Ziele und Möglichkeiten zur Förderung von Geschlechtergerechtigkeit, und vergleicht ihre Vor- und Nachteile.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Globalisierung, Geschlechterungleichheit, Frauenarbeit, Entwicklungsländer, Industrieländer, Feministische Ökonomie, Gender Mainstreaming, Empowerment, Rechtliche Regelungen, Standortvorteil.
- Quote paper
- Nadja Giese (Author), 2004, Sind Frauen Gewinner oder Verlierer der Globalisierung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/60403