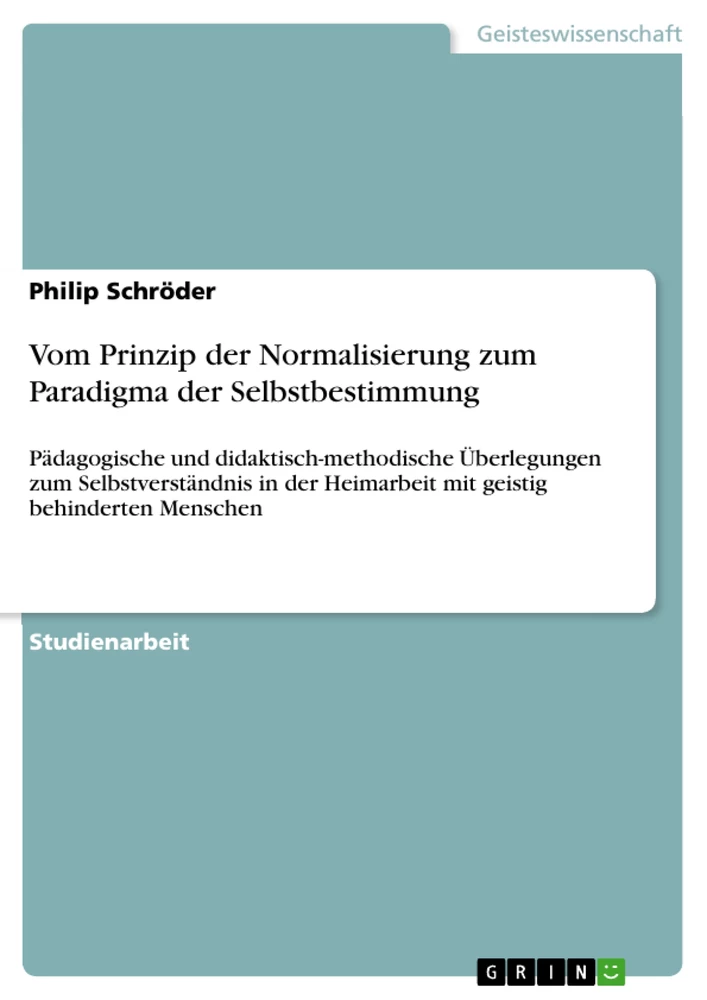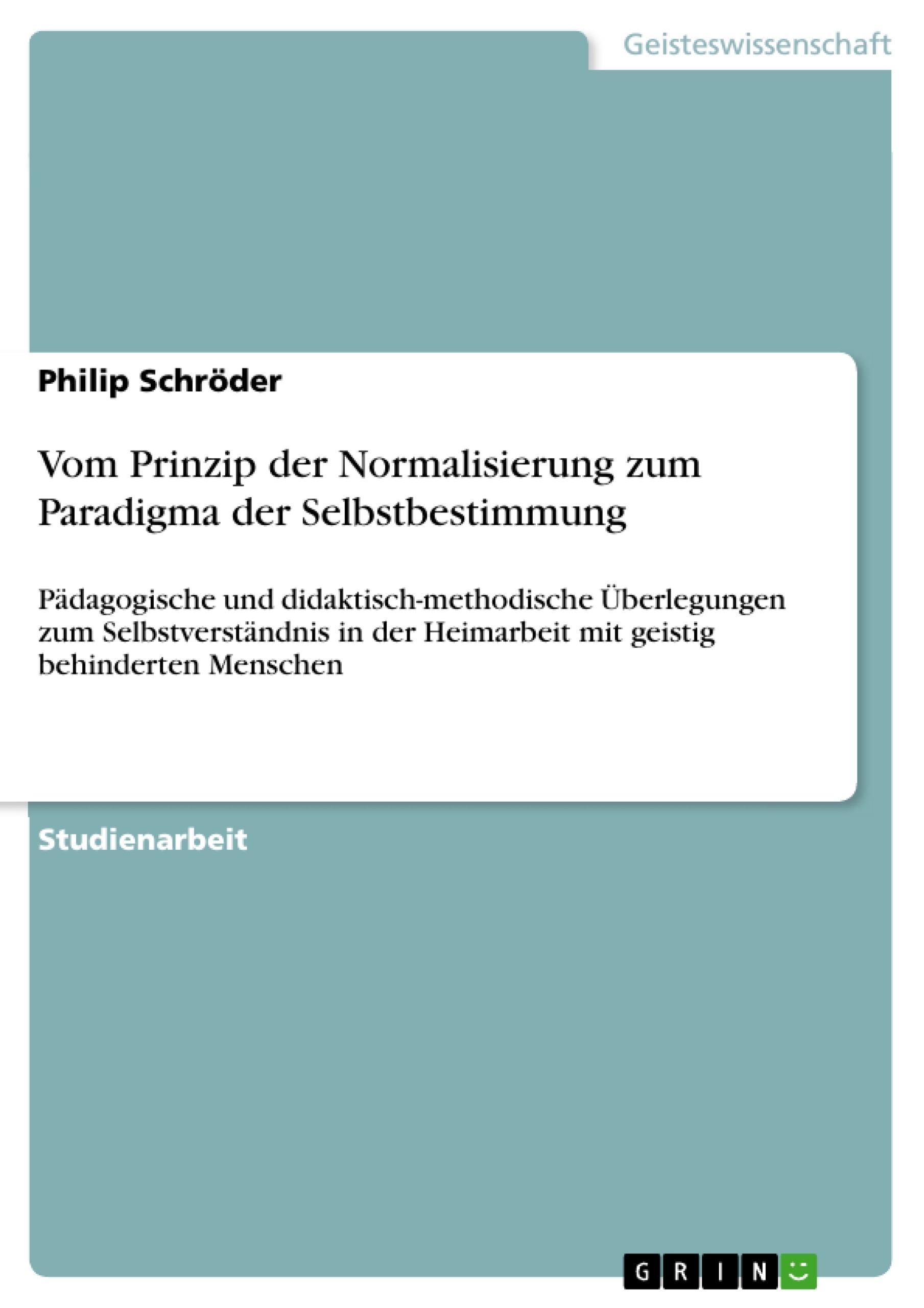Die im Jahre 1994 vom Gesetzgeber beschlossene Erweiterung des Grundgesetzes durch das Diskriminierungsverbot behinderter Menschen erinnerte uns erneut daran, dass auch Menschen mit einer Behinderung, auch wenn sie im Heim „untergebracht sind“, Träger von Grundrechten sind. Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen sind fast ausnahmslos auf stationäre Heimeinrichtungen angewiesen. Diese Wohneinrichtungen sollten dem Menschen mit Behinderung all das ermöglichen, was wir alle in unseren vier Wänden auch für selbstverständlich halten.
Für eine Abkehr vom bisherigen Betreuungsdenken ist eine innere Umstrukturierung notwendig, um den Menschen in diesen Einrichtungen Bedingungen zu schaffen, die dem näher kommen, was Wohnen in Selbstbestimmung bedeutet. Aufgegeben werden muss nicht nur der fachliche Allmachtsglauben, den defizitären Behinderten fördern zu müssen, verlassen werden muss auch die sichere Position des in jeder Hinsicht mächtigeren Experten. Ziel muss es sein, unter den Bedingungen eines Heimes dem Grundrecht auf Teilhabe mehr Raum zu verschaffen. Behinderte Menschen sollten mehr selbst bestimmen können und weniger fremdbestimmt sein.
In der Praxis stellt sich dies oftmals als Gratwanderung dar; Freiheiten zu gewähren bedeutet eben nicht nur, Chancen für eine selbstgesteuerte freiheitliche Entwicklung zu schaffen, sondern auch die Unsicherheit, Gefahrenmomente zu verkennen und fahrlässig zu handeln.
Nach einem knappen historischer Abriss und der Erläuterung relevanter Leitbilder und Grundlagen der Behindertenhilfe wird neben einem theoretischen Kapitel versucht, dem ›Paradigma der Selbstbestimmung‹ in seiner praktischen Konsequenz Gestalt zu verleihen.
Philip Schröder (Jahrgang 1969) ist seit 1989 in der praktischen Behindertenhilfe tätig und hat die vorliegende Arbeit während seines Studiums der Sozialpädagogik verfasst. Als weitere Veröffentlichung liegt vor: „Qualitätssicherung in der Behindertenhilfe – Schnäppchen oder Mogelpackung?“, Bochum 2003.
Inhaltsverzeichnis
- 0) Einleitung.
- 1) Historischer Abriss
- 1.1) Erbkrank und unheilbar
- 1.2) Versorgt und verwahrt
- 1.3) Entpsychiatrisiert und individualisiert.
- 1.4) Subventioniert und legalisiert
- 1.5) Therapiert und isoliert ....
- 1.6) Integriert und selbstbestimmt
- 2) Zentrale Leitbilder in der Behindertenarbeit.
- 2.1) Das Normalisierungsprinzip
- 2.1.1) Normaler Tagesrhythmus
- 2.1.2) Normaler Wochenrhythmus
- 2.1.3) Normaler Jahresrhythmus
- 2.1.4) Normaler Lebenslauf
- 2.1.5) Respektierung von Bedürfnissen
- 2.1.6) Angemessener Kontakt zwischen den Geschlechtern
- 2.1.7) Normaler wirtschaftlicher Standard
- 2.1.8) Standards von Einrichtungen
- 2.2) Integration
- 2.3) Selbstbestimmtes Leben
- 2.3.1) Assistenzkonzept
- 2.3.2) Kundenmodell
- 2.3.3) Empowerment
- 2.3.4) Regiekompetenz
- 2.3.5) Self-Advocacy
- 2.3.6) Trialog
- 3) Metatheoretische Erwägungen
- 3.1) Erziehungswissenschaftliche Aspekte
- 3.2) Anthropologische Sichtweise
- 4) Praktische Überlegungen
- 4.1) Heimalltag und Realität
- 4.1.1) Beispiel Paul
- 4.1.2) Beispiel Inge.
- 4.2) Perspektiven und Möglichkeiten der Umsetzung
- 5) Konsequenzen für das Selbstverständnis der Begleiter ....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Paradigma der Selbstbestimmung im Kontext der stationären Heimarbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung. Ziel ist es, dieses Paradigma im historischen Kontext der Behindertenarbeit zu verorten und seine Relevanz für die Praxis zu beleuchten.
- Entwicklung des Verständnisses von Behinderung im historischen Kontext
- Zentrale Leitbilder in der Behindertenarbeit: Normalisierungsprinzip, Integration und Selbstbestimmtes Leben
- Metatheoretische Erwägungen: Erziehungswissenschaftliche und anthropologische Perspektiven
- Praktische Implikationen des Selbstbestimmungsparadigmas im Heimalltag
- Konsequenzen für das Selbstverständnis der Begleiter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Selbstbestimmung in der stationären Heimarbeit mit geistig behinderten Menschen ein und erläutert die Motivation für die Arbeit. Kapitel 1 beleuchtet den historischen Wandel des Verständnisses von Behinderung, beginnend mit der Sichtweise von Menschen mit geistiger Behinderung als "Erbkranke" bis hin zum Paradigma der Selbstbestimmung.
Kapitel 2 widmet sich den zentralen Leitbildern in der Behindertenarbeit, insbesondere dem Normalisierungsprinzip, Integration und dem Selbstbestimmten Leben. Dabei werden die einzelnen Aspekte dieser Konzepte und ihre Bedeutung für die Praxis dargestellt.
Kapitel 3 befasst sich mit metatheoretischen Erwägungen, indem es erziehungswissenschaftliche und anthropologische Perspektiven auf die Thematik der Selbstbestimmung in der Behindertenarbeit einbezieht.
Kapitel 4 beleuchtet die praktischen Implikationen des Selbstbestimmungsparadigmas im Heimalltag anhand von konkreten Beispielen und zeigt Perspektiven für die Umsetzung in der Praxis auf.
Schlüsselwörter
Selbstbestimmung, Behinderung, Heimarbeit, Normalisierungsprinzip, Integration, Empowerment, Assistenzkonzept, Erziehungswissenschaft, Anthropologie, Heimalltag.
- Quote paper
- Dipl. Soz. Päd. Philip Schröder (Author), 1999, Vom Prinzip der Normalisierung zum Paradigma der Selbstbestimmung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/59754