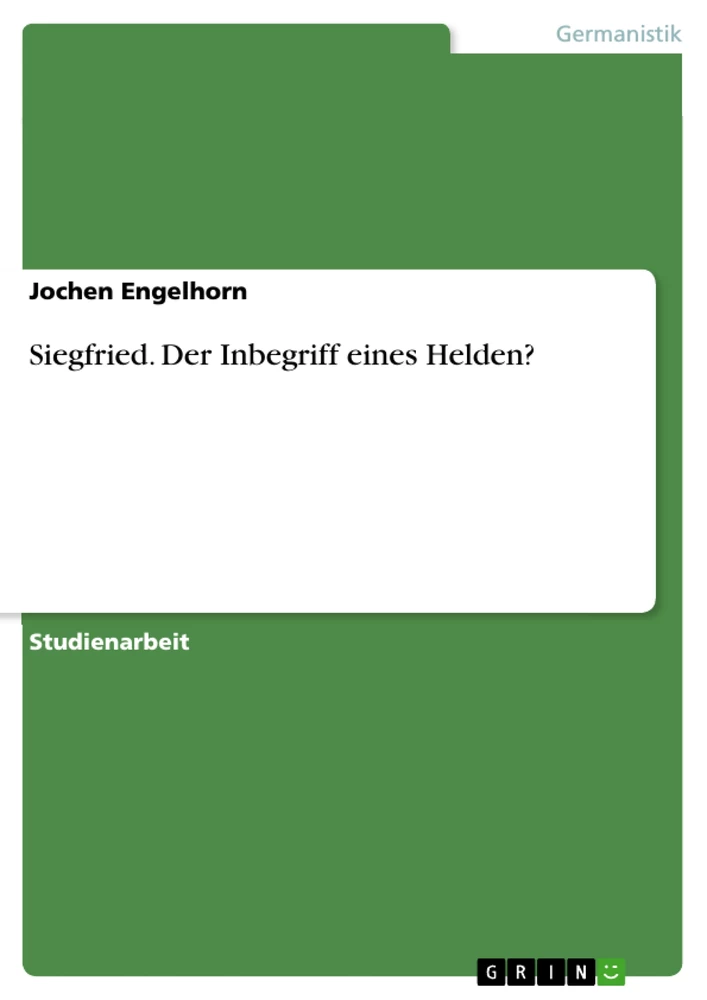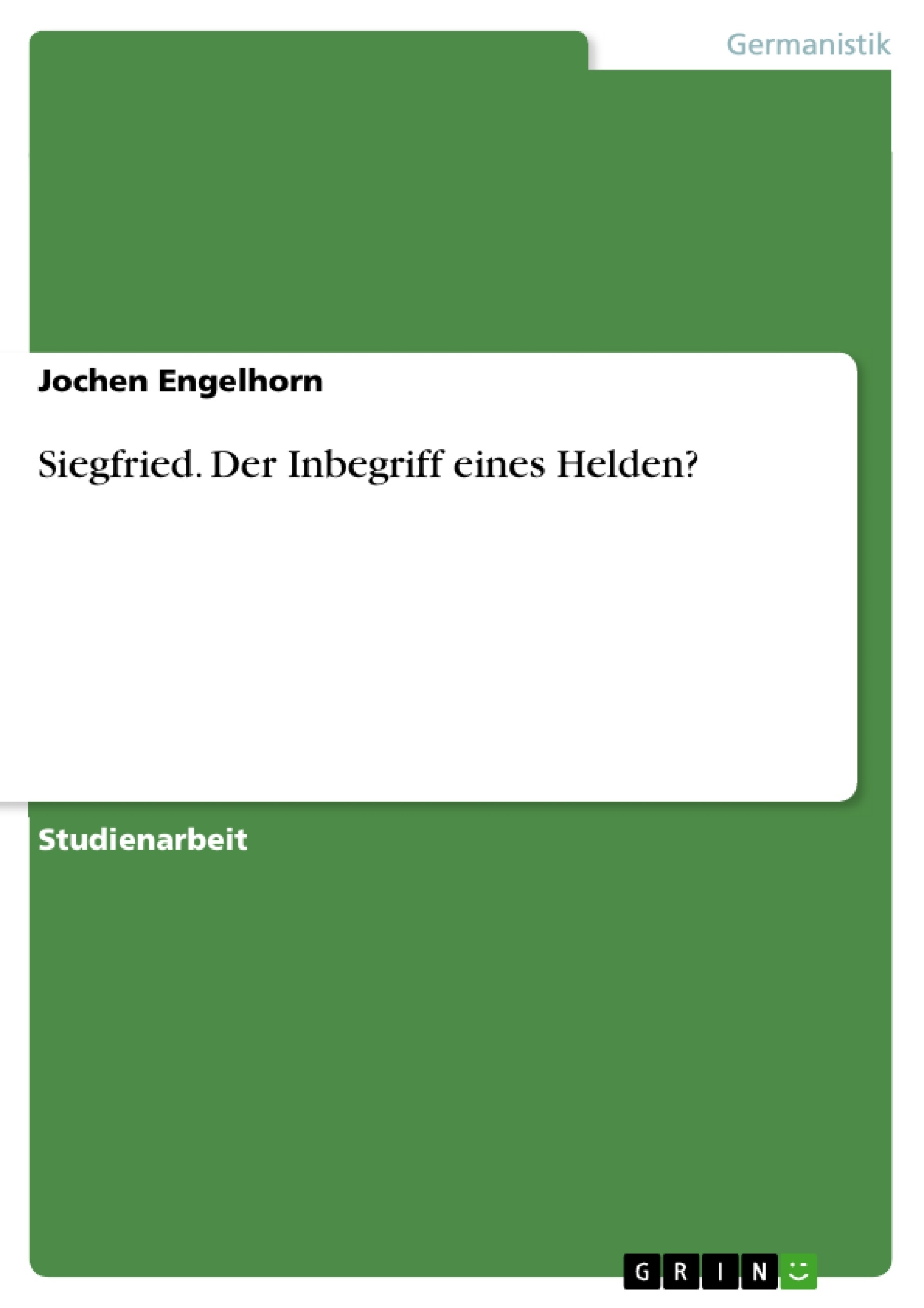„Siegfried ist ein Held, wie die Sonne keinen zweiten gesehen hat, voll kühnsten Mutes und übermenschlicher Kraft. Sein Erscheinen ist wie das Strahlen der Sonne an einem heiteren Frühlingsmorgen, sein Tod wie das Sterben einer Blume voll sonnigen Glanzes und liebliche Duftes.“ Dieses idealisierte und klischeehafte Bild der frühen Siegfriedforschung, das im wesentlichen durch die überlieferte Sagenvorstellung des Helden gekennzeichnet ist, hat sich bis heute in den Köpfen der Menschen festgesetzt. Selbst die Filmindustrie greift die beliebte Überlieferung vom Drachentöter dankbar auf und bestätigt die weit verbreitete Auffassung vom Inbegriff des Heldentums: Siegfried als der strahlende Held, der durch eine hinterhältige Intrige zugrunde gerichtet wird. Lässt sich diese Meinung jedoch nach einer sorgfältigen Analyse des Epos aufrechterhalten? Wird der Xantener im Text tatsächlich als der Inbegriff des Helden dargestellt? Auf den folgenden Seiten möchte ich mich daher der Darstellung der Siegfriedfigur im Nibelungenlied widmen. Im Vordergrund der Arbeit steht hierbei das Bild vom Helden und seine Schilderung im Epos. Anhand von Textbeispielen wird versucht die traditionelle Meinung von Siegfried aufzugreifen und im Lied zu überprüfen. Positive sowie negative Seiten der Heldengestalt sollen kritisch am Text untersucht werden, um schließlich die Figur im Gesamten erfassen zu können. Dabei werde ich zunächst auf das Idealbild des Helden eingehen, um später Widersprüche und Ungereimtheiten dieses Konzepts aufzudecken. Allgemein kann man feststellen, dass Siegfried im Vergleich zu den restlichen Figuren im Nibelungenlied trotz seiner Stellung keine Königstitel, sondern fast ausschließlich Heldentitel trägt: der „starke Sîfrit“, der „küene Sîfrit“, der helt von Niderlant“, „Sîfrit der degen“. Seine Person wird somit nicht durch den Status als König oder Landesherr bestimmt, sondern vielmehr wird der Held aufgrund seiner besonderen Eigenschaften und herausragenden Merkmale hervorgehoben. Was versteht man jedoch unter einem Helden? Was macht einen Helden aus? In der mittelhochdeutschen Literatur des 12. Jahrhunderts bezeichnet „helt“ einen hervorragenden und bewundernswürdigen Kämpfer, der durch seine Taten Bewunderung und Aufmerksamkeit hervorruft. Seine kämpferischen Leistungen und seine Tugenden stellt er in außerordentlichen Situationen unter Beweis. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Das Idealbild des Helden
- 1. Wesenszüge
- 2. Märchenhafte Züge
- 3. Heldenhafte Siege
- III. Brüche in der Heldenkonzeption
- 1. Siegfrieds Tod - der Tod eines Helden?
- 2. Siegfrieds Schuld
- IV. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der Siegfriedfigur im Nibelungenlied und beleuchtet, inwieweit Siegfried tatsächlich als Inbegriff eines Helden dargestellt wird. Die Analyse basiert auf einer kritischen Auseinandersetzung mit dem traditionellen Bild Siegfrieds und berücksichtigt sowohl positive als auch negative Aspekte seiner Persönlichkeit.
- Das Idealbild des Helden im Mittelalter
- Siegfrieds Eigenschaften und Taten im Vergleich zum Idealbild
- Die Widersprüchlichkeit der Siegfriedfigur
- Siegfrieds Tod und dessen Bedeutung
- Die Frage nach Siegfrieds Schuld
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Darstellung Siegfrieds als Inbegriff eines Helden im Nibelungenlied. Sie verweist auf das idealisierte Bild Siegfrieds in der frühen Forschung und kündigt den Ansatz an, diese traditionelle Sichtweise anhand einer Textanalyse zu überprüfen. Die Arbeit fokussiert auf eine kritische Untersuchung der positiven und negativen Aspekte der Siegfriedfigur, um ein umfassendes Bild zu entwickeln. Der Bezug auf die bereits existierende Forschung, die sowohl das idealisierte als auch ein kritischeres Bild von Siegfried präsentiert, wird hervorgehoben.
II. Das Idealbild des Helden: Dieses Kapitel beschreibt das Idealbild des Helden im mittelhochdeutschen Kontext des 12. Jahrhunderts. Es definiert den Begriff "Helt" und erläutert die Eigenschaften und Taten, die einen Helden auszeichnen. Es wird herausgestellt, dass Helden durch außergewöhnliche Leistungen und Tugenden Bewunderung hervorrufen und als Vorbilder für die Nachwelt dienen. Die Kapitel unterstreicht die Bedeutung des Heldentums im kollektiven Gedächtnis und seiner Rolle im Epos. Die unterschiedliche Gewichtung positiver und negativer Aspekte in der Forschung zu Siegfried wird bereits hier angedeutet und als Ausgangspunkt für die nachfolgende Analyse verwendet.
III. Brüche in der Heldenkonzeption: Dieses Kapitel befasst sich mit den Widersprüchen und Ungereimtheiten im Bild Siegfrieds. Es untersucht kritisch, inwieweit die Darstellung Siegfrieds im Nibelungenlied von dem im vorherigen Kapitel etablierten Idealbild abweicht. Der Fokus liegt auf den Ereignissen um Siegfrieds Tod und der Frage nach seiner möglichen Schuld an seinem eigenen Schicksal. Dieses Kapitel analysiert die Brüche im Bild des Helden und die Komplexität der Figur, die über die reine Heldendarstellung hinausgeht.
Schlüsselwörter
Nibelungenlied, Siegfried, Held, Heldendarstellung, Mittelalter, Epos, Heldenepos, Heldenideal, Widersprüche, Schuld, Tod, Textanalyse, Literaturwissenschaft
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Nibelungenlied: Siegfried - Held oder Antiheld?
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Darstellung Siegfrieds im Nibelungenlied und untersucht kritisch, inwieweit er dem Idealbild eines mittelalterlichen Helden entspricht. Sie betrachtet sowohl positive als auch negative Aspekte seiner Persönlichkeit und beleuchtet die Widersprüche in seiner Figur. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, die Kapitel zum Idealbild des Helden, zu Brüchen in diesem Bild im Fall Siegfrieds (insbesondere um seinen Tod), sowie eine Schlussfolgerung und ein Literaturverzeichnis (implizit durch die Schlüsselwörter angedeutet).
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Idealbild des mittelalterlichen Helden, Siegfrieds Eigenschaften und Taten im Vergleich zu diesem Ideal, den Widersprüchlichkeiten in Siegfrieds Charakter, Siegfrieds Tod und dessen Bedeutung, sowie der Frage nach Siegfrieds Schuld an seinem eigenen Schicksal. Es wird eine textbasierte Analyse des Nibelungenlieds vorgenommen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, die die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz erläutert; ein Kapitel zum Idealbild des mittelalterlichen Helden; ein Kapitel, das die Brüche in der Heldenkonzeption am Beispiel Siegfrieds analysiert, insbesondere seinen Tod und die Frage seiner Schuld; und eine Schlussfolgerung (deren Inhalt nicht explizit dargestellt ist). Ein Inhaltsverzeichnis ist im HTML-Code enthalten.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das traditionelle, idealisierte Bild Siegfrieds kritisch zu hinterfragen und durch eine detaillierte Textanalyse ein umfassenderes und nuancierteres Bild der Figur zu entwickeln. Es geht darum, die Widersprüche in der Darstellung Siegfrieds aufzuzeigen und seine Komplexität zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Nibelungenlied, Siegfried, Held, Heldendarstellung, Mittelalter, Epos, Heldenepos, Heldenideal, Widersprüche, Schuld, Tod, Textanalyse, Literaturwissenschaft.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden geboten?
Die Zusammenfassung der Kapitel beschreibt die Einleitung als Einführung in die Thematik und die Forschungsfrage. Kapitel II beschreibt das Idealbild des mittelalterlichen Helden. Kapitel III analysiert die Abweichungen Siegfrieds von diesem Idealbild, insbesondere im Hinblick auf seinen Tod und die Frage nach seiner Schuld. Die Schlussfolgerung ist in der Zusammenfassung nicht weiter ausgeführt.
- Arbeit zitieren
- Jochen Engelhorn (Autor:in), 2006, Siegfried. Der Inbegriff eines Helden?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/58760