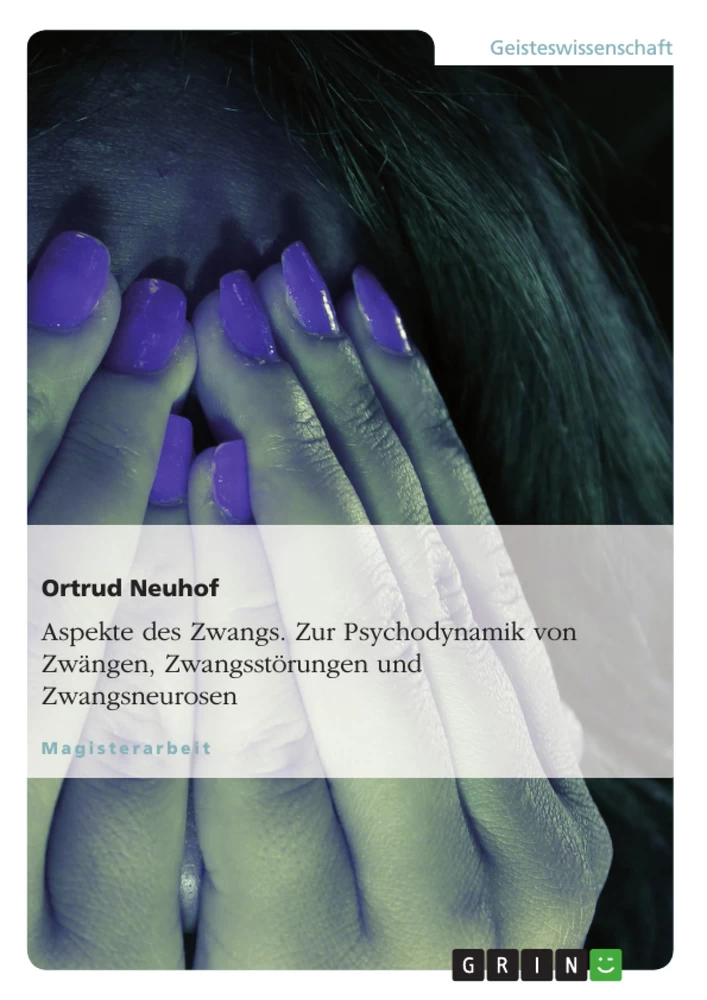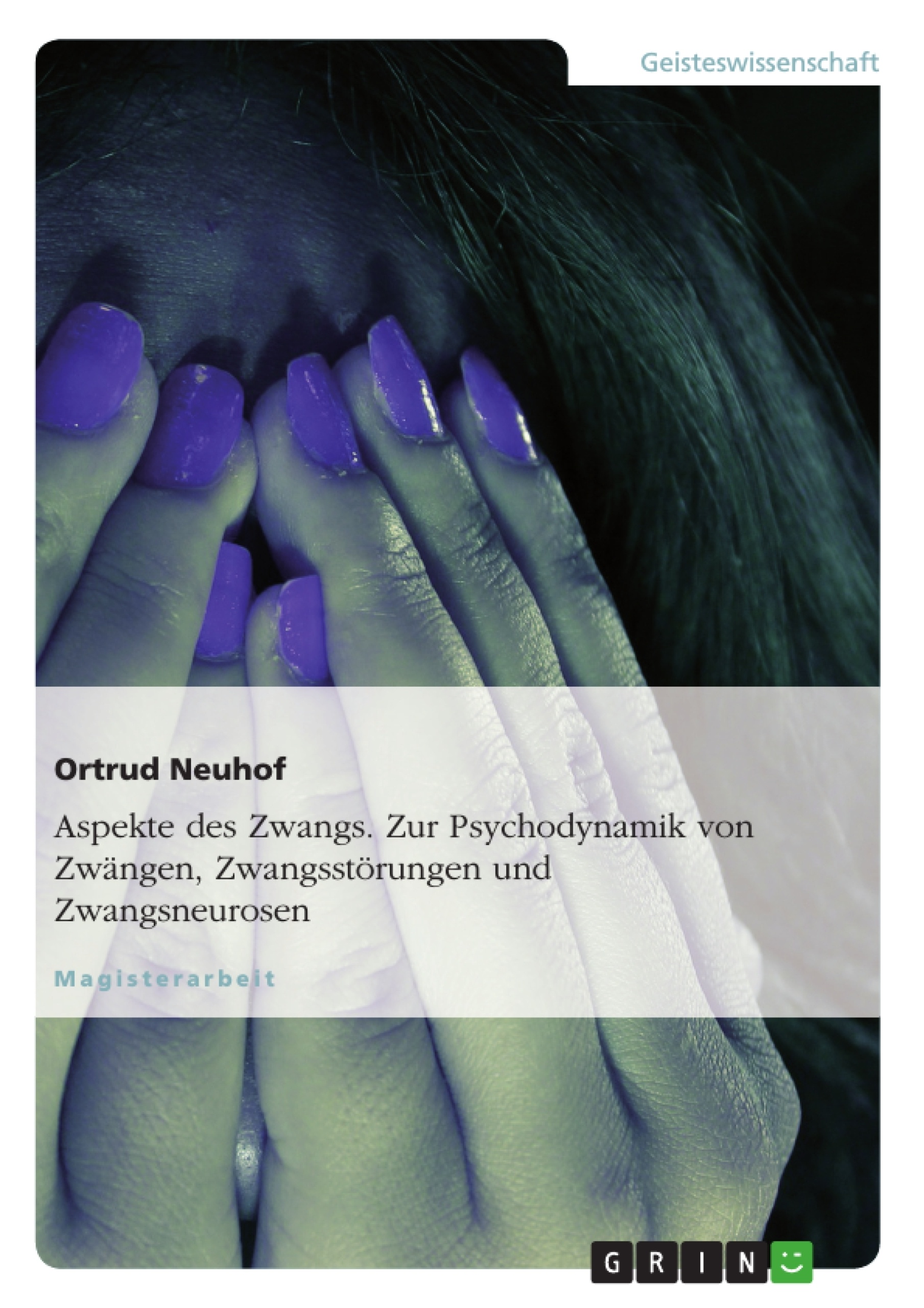Gegenstand dieser Arbeit ist der psychische Zwang als pathologische Erscheinung. Die Überschrift Aspekte des Zwangs weist darauf hin, dass er nicht nur als eigenes Krankheitsbild, sondern auch im Zusammenhang mit anderen Krankheiten, als Phänomen auftritt. Er wird unterschiedlich bezeichnet: als Zwang, Zwangsstörung und Zwangsneurose. Klinisch-psychiatrische Klassifikationsschemata bevorzugen den Begriff Zwangsstörung. Tritt er als eigenes Krankheitsbild auf, müssen als Hauptmerkmale Zwangsgedanken und Zwangshandlungen nachgewiesen werden.
Im ersten Teil dieser Arbeit werden Epidemiologie, Prävalenz, Inzidenz und Verlauf, sowie psychosoziale und soziokulturelle Faktoren untersucht. Zusätzlich werden Zwansspektrumstörungen und Komorbidität erörtert. Das neurobiologische und lerntheoretische Erklärungsmodell wird kurz umrissen und anschließend auf die Familienforschung eingegangen.
Im zweiten Teil, dem Hauptteil, wird das psychodynamische Erklärungsmodell vorgestellt und damit die psychoanalytische Sichtweise. Das triebtheoretische klassische Konfliktmodell Sigmund Freuds wird ergänzt durch neoanalytische, ich- und selbstpsychologische, sowie objekttheoretische Ansätze.
Weil im Vordergrund psychoanalytischer Aussagen vermehrt die autoprotektive Funktion des Zwangs als Sicherung menschlicher Existenz steht, erfolgt eine Gegenüberstellung des Zwangs als Ausdruck eines Konflikts versus Ausdruck eines strukturellen Mangels. In diesem Zusammenhang wird abschließend die Frage eines Symptomwandels diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Psychischer Zwang - ein pathologisches Phänomen
- Epidemiologie, Prävalenz und transkultureller Vergleich
- Inzidenz und Verlauf
- Ätiologieforschung
- Psychosoziale und soziokulturelle Faktoren
- Zwangsspektrumstörungen und Komorbiditäten
- Ätiologiemodelle
- Neurobiologische Erklärung
- Lerntheoretische Erklärung
- Die neobiologistische Wende in der Psychiatrie und ihre Folgen
- Psychodynamische Erklärung
- Der Zwang als lebenserhaltendes Prinzip – ein ideengeschichtlicher Hintergrund
- Neurose
- Historische Anmerkungen zum Neurosenbegriff
- Der Neurosenbegriff Sigmund Freuds
- Die Zwangsneurose - ein Konfliktmodell
- Psychogenese
- Pathogenese und Psychodynamik
- Der ödipale Konflikt und die Abwehrmechanismen des Ichs bei der Zwangsneurose
- Die anal-sadistische Stufe als Ausgangsbasis normaler und pathologischer Entwicklung
- Der Konflikt zwischen den Instanzen
- Symptomatologie
- Konflikt versus strukturelle Mängel
- Diagnose und Differentialdiganose der Zwangsstörung/Zwangsneurose
- Zur Frage eines Symptomwandels bei Zwangserscheinungen
- Die Bedeutung der Somatogenese in dem multifaktoriellen Bedingungsgefüge von Zwangserkrankungen aus psychoanalytischer Sicht
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht den psychischen Zwang als pathologisches Phänomen, wobei insbesondere die psychodynamischen Aspekte im Fokus stehen. Die Arbeit beleuchtet unterschiedliche Erklärungsmodelle und diskutiert die Verwendung der Begriffe „Zwang“, „Zwangsstörung“ und „Zwangsneurose“.
- Epidemiologie und Prävalenz von Zwangserkrankungen
- Vergleich verschiedener Erklärungsmodelle (neurobiologisch, lerntheoretisch, psychodynamisch)
- Psychodynamische Betrachtung der Zwangsneurose nach Freud und nachfolgenden Psychoanalytikern
- Der ödipale Konflikt und Abwehrmechanismen bei Zwangsneurosen
- Zwang als Konflikt vs. struktureller Mangel
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Gegenstand der Arbeit: den psychischen Zwang als pathologische Erscheinung und die unterschiedliche Verwendung der Begriffe „Zwang“, „Zwangsstörung“ und „Zwangsneurose“. Sie führt in die Thematik ein und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich in einen empirisch-deskriptiven und einen psychodynamischen Teil gliedert. Besonderes Augenmerk wird auf die psychoanalytische Perspektive gelegt, welche im zweiten Teil der Arbeit im Detail behandelt wird.
Psychischer Zwang - ein pathologisches Phänomen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Epidemiologie, Prävalenz, Inzidenz und dem Verlauf von Zwangserkrankungen. Es werden verschiedene ätiologische Faktoren beleuchtet, darunter psychosoziale und soziokulturelle Einflüsse, Komorbiditäten und unterschiedliche Erklärungsmodelle wie das neurobiologische und das lerntheoretische Modell. Die Bedeutung der Familienforschung und die jeweiligen Stärken und Schwächen der verschiedenen Ansätze werden diskutiert, wobei die Grenzen des neurobiologischen und lerntheoretischen Ansatzes in Bezug auf die umfassende Erklärung des Phänomens hervorgehoben werden.
Psychodynamische Erklärung: Dieses Kapitel stellt das psychoanalytische Erklärungsmodell in den Mittelpunkt. Es analysiert das klassische Konfliktmodell der Zwangsneurose basierend auf Freuds Schriften und den Ausführungen späterer Triebtheoretiker. Es werden die relevanten Abwehrmechanismen (Verdrängung, Regression, Reaktionsbildung, Isolierung, Ungeschehenmachen, Intellektualisierung) detailliert untersucht und ihre Rolle im Entstehungsprozess der Zwangsneurose erläutert. Die Bedeutung der anal-sadistischen Phase sowie der Konflikt zwischen Es, Ich und Über-Ich werden im Kontext der Symptomatologie der Zwangsneurose umfassend diskutiert. Schließlich wird die Frage nach dem Zwang als Konflikt versus struktureller Mangel angesprochen und ein möglicher Symptomwandel beleuchtet.
Schlüsselwörter
Psychischer Zwang, Zwangsstörung, Zwangsneurose, Psychodynamik, Sigmund Freud, Abwehrmechanismen, Ödipuskomplex, anal-sadistische Phase, Neurobiologie, Lerntheorie, Komorbidität, Ätiologie, Pathogenese.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Psychischer Zwang
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht den psychischen Zwang als pathologisches Phänomen, wobei der Fokus besonders auf den psychodynamischen Aspekten liegt. Es werden verschiedene Erklärungsmodelle beleuchtet und die Verwendung der Begriffe „Zwang“, „Zwangsstörung“ und „Zwangsneurose“ diskutiert.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Epidemiologie und Prävalenz von Zwangserkrankungen, vergleicht verschiedene Erklärungsmodelle (neurobiologisch, lerntheoretisch, psychodynamisch), analysiert die psychodynamische Betrachtung der Zwangsneurose nach Freud und späteren Psychoanalytikern, untersucht den ödipalen Konflikt und Abwehrmechanismen bei Zwangsneurosen und diskutiert Zwang als Konflikt versus strukturellen Mangel.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über den psychischen Zwang als pathologisches Phänomen, ein Kapitel zur psychodynamischen Erklärung und eine Schlussfolgerung. Der empirisch-deskriptive Teil wird durch den detaillierten psychodynamischen Teil ergänzt, welcher der psychoanalytischen Perspektive besondere Aufmerksamkeit schenkt.
Welche Erklärungsmodelle für psychischen Zwang werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert und vergleicht neurobiologische, lerntheoretische und psychodynamische Erklärungsmodelle für psychischen Zwang. Die Stärken und Schwächen der jeweiligen Ansätze werden diskutiert, wobei die Grenzen des neurobiologischen und lerntheoretischen Ansatzes hinsichtlich einer umfassenden Erklärung des Phänomens hervorgehoben werden.
Wie wird die psychodynamische Perspektive auf den psychischen Zwang dargestellt?
Das Kapitel zur psychodynamischen Erklärung analysiert das klassische Konfliktmodell der Zwangsneurose basierend auf Freuds Schriften und späteren Psychoanalytikern. Es werden relevante Abwehrmechanismen (Verdrängung, Regression, Reaktionsbildung, Isolierung, Ungeschehenmachen, Intellektualisierung) detailliert untersucht und ihre Rolle im Entstehungsprozess der Zwangsneurose erläutert. Die Bedeutung der anal-sadistischen Phase und des Konflikts zwischen Es, Ich und Über-Ich wird im Kontext der Symptomatologie umfassend diskutiert. Die Frage nach Zwang als Konflikt versus strukturellem Mangel wird ebenfalls behandelt.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselbegriffe der Arbeit sind: Psychischer Zwang, Zwangsstörung, Zwangsneurose, Psychodynamik, Sigmund Freud, Abwehrmechanismen, Ödipuskomplex, anal-sadistische Phase, Neurobiologie, Lerntheorie, Komorbidität, Ätiologie, Pathogenese.
Welche Aspekte der Epidemiologie und Prävalenz von Zwangserkrankungen werden behandelt?
Das Kapitel „Psychischer Zwang – ein pathologisches Phänomen“ befasst sich mit der Epidemiologie, Prävalenz, Inzidenz und dem Verlauf von Zwangserkrankungen. Es werden verschiedene ätiologische Faktoren beleuchtet, darunter psychosoziale und soziokulturelle Einflüsse und Komorbiditäten.
Wie wird der Begriff „Zwang“ in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit diskutiert die unterschiedliche Verwendung der Begriffe „Zwang“, „Zwangsstörung“ und „Zwangsneurose“ und beleuchtet die jeweiligen Konnotationen und Unterschiede in der Bedeutung.
Welche Rolle spielen Abwehrmechanismen in der Entstehung von Zwangsneurosen?
Die Arbeit untersucht detailliert die relevanten Abwehrmechanismen (Verdrängung, Regression, Reaktionsbildung usw.) und deren Rolle im Entstehungsprozess der Zwangsneurose im Rahmen des psychodynamischen Erklärungsmodells.
Wie wird der ödipale Konflikt im Zusammenhang mit Zwangsneurosen betrachtet?
Der ödipale Konflikt und seine Bedeutung im Entstehungsprozess von Zwangsneurosen werden im Kontext der psychodynamischen Betrachtung umfassend diskutiert.
- Arbeit zitieren
- Ortrud Neuhof (Autor:in), 2004, Aspekte des Zwangs. Zur Psychodynamik von Zwängen, Zwangsstörungen und Zwangsneurosen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/58617