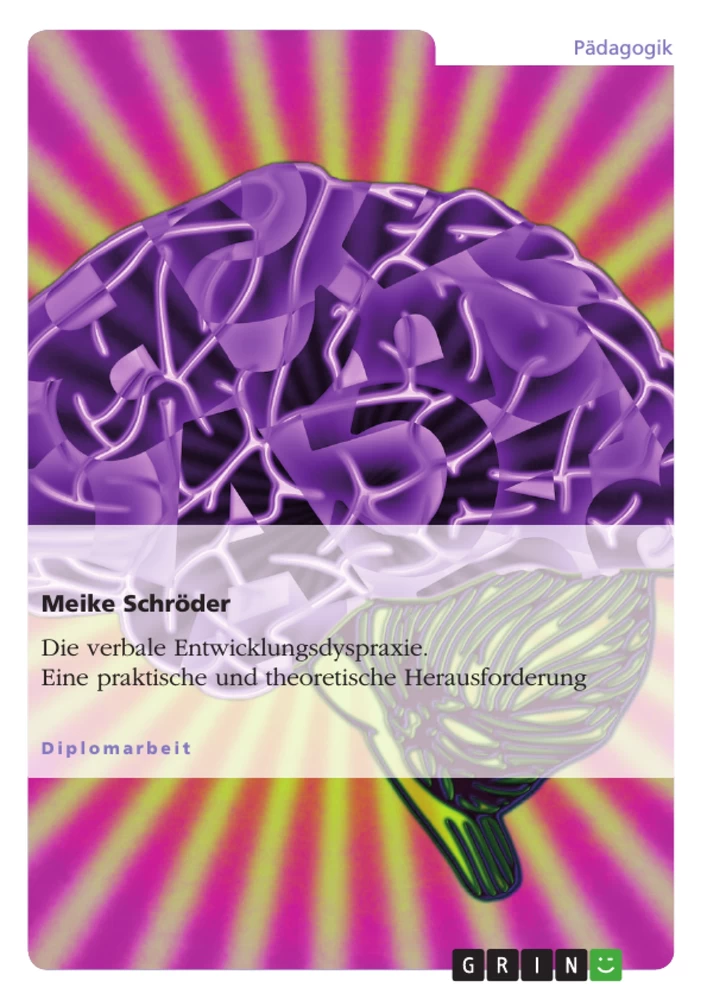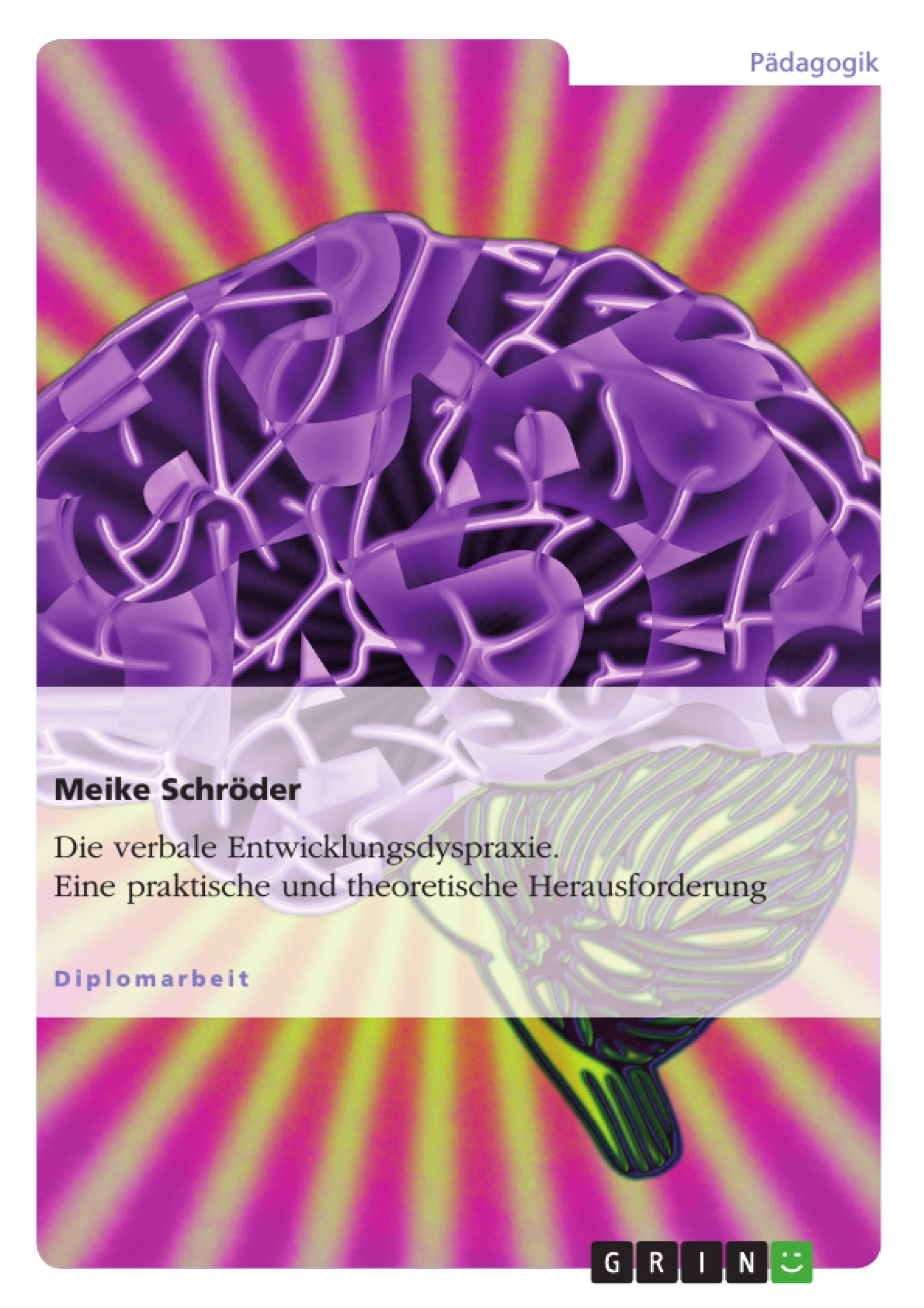„My mouth won´t cooperate with my brain." (SCHULTE-MÄTER 1996, S.15)
So beschreibt der 13jährige Keith seine Artikulationsschwierigkeiten, denen eine verbale Entwicklungsdyspraxie zugrunde gelegt wird. Der Begriff der „Developmental Articulatory Dyspraxia“, zu deutsch „verbale Entwicklungsdyspraxie“, wird seit den 50er Jahren verwendet. Ein Fall von verbaler Entwicklungsdyspraxie wird in der Literatur sogar schon 1891 geschildert.
Die verbale Entwicklungsdyspraxie äußert sich als ein Problem auf der Ebene der Sprechbewegungsplanung bzw. -programmierung. Sie zeigt sich in dem Unvermögen, die Artikulationsorgane für geplante Äußerungen willkürlich und kontrolliert in korrekter räumlicher und zeitlicher Beziehung zueinander einzusetzen. Die Produktion isolierter Laute verläuft meist störungsfrei. Allgemein weist die Sprachproduktion manchmal „Inseln“ auf, Phasen in denen das Sprechen ungestört verläuft.
In meiner Arbeit werde ich den Begriff und das Störungsbild der verbalen Entwicklungsdyspraxie näher beleuchten. Ich werde versuchen einen „roten Faden“ durch dieses umstrittene, unklar umrissene Thema zu ziehen. Mein Hauptaugenmerk werde ich dem Bereich der Diagnostik widmen, dem, meiner Meinung nach, bisher zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Terminologie, Definition und Begriffskritik
- 1.1 Überlegungen zu den Begriffen „verbale Entwicklungsdyspraxie“ und „-apraxie“
- 1.2 Historischer Exkurs
- 1.2.1 Die erste Erwähnung des Begriffs der „Developmental Articulatory Dyspraxia“
- 1.2.2 Der erste in der Literatur beschriebene Fall von verbaler Entwicklungsdyspraxie
- 1.3 Das Sprachproduktionsmodell von CARUSO und STRAND
- 1.4 Zur Einordnung der Störung
- 1.5 Exkurs: Neurogen erworbene Apraxie
- 1.5.1 Kurze Darstellung des Störungsbildes Apraxie
- 1.5.2 Kurze Darstellung des Störungsbildes Sprechapraxie
- 1.6 Zur Problematik des Begriffs „verbale Entwicklungsdyspraxie“
- 2. Symptomatik der verbalen Entwicklungsdyspraxie
- 2.1 Zur Häufigkeit und dem Geschlechterverhältnis
- 2.2 Zur genetischen Disposition
- 2.3 Zum neurologischen Hintergrund
- 2.4 Ausschlusskriterien
- 2.5 Nichtsprachliche Auffälligkeiten
- 2.6 Auffälligkeiten der Sprache und des Sprechens
- 2.6.1 Artikulatorische Auffälligkeiten
- 2.6.2 Prosodische Auffälligkeiten
- 2.6.3 Oraler Befund
- 2.6.4 Weitere Auffälligkeiten
- 2.7 Verbale Entwicklungsdyspraxie in Verbindung mit anderen Störungsbildern
- 3. Diagnostik
- 3.1 Zur Problematik der Diagnose und Differentialdiagnose bei verbaler Entwicklungsdyspraxie
- 3.2 Klinische Untersuchungsmethoden
- 3.3 Anamnese
- 3.4 Prüfverfahren zur Erfassung einer verbalen Entwicklungsdyspraxie
- 3.4.1 Beurteilung der Spontansprache
- 3.4.2 Screening zur Erfassung der artikulatorischen und sprechmotorischen Komponenten bei Verdacht auf „verbale Entwicklungsdyspraxie“ zusammengestellt von DITTSCHEIDT
- 3.4.3 Verbal Motor Production Assessment for Children” nach HAYDEN und SQUARE
- 3.5 Prüfverfahren zur Erfassung anderer Störungsbilder, die mit verbaler Entwicklungsdyspraxie einhergehen können
- 3.5.1 Beobachtungsbogen zur Feststellung von Praxie oder einer motorisch-apraktischen Schwäche
- 3.5.2 Standardisierte Verfahren zur Feststellung einer motorischen Entwicklungsdyspraxie
- 3.5.3 Feststellung einer oralen Apraxie
- 3.5.4 Feststellung einer Störung der temporellen Verarbeitung
- 3.6 Zusammenfassung
- 4. Therapie der verbalen Entwicklungsdyspraxie
- 4.1 Allgemeine Überlegungen zur Therapie einer verbalen Entwicklungsdyspraxie
- 4.2 Verschiedene Therapieansätze
- 4.2.1 Therapieansätze zur Verbesserung der motorischen Planung
- 4.2.2 Intensiver Drill
- 4.2.3 Übungsmaßnahmen auf rein oromotorischer
- 4.2.4 Das Einüben von Bewegungssequenzen
- 4.2.5 Das Einüben kontrollierter Sprechgeschwindigkeit
- 4.2.6 Die Einbeziehung prosodischer Aspekte in die Therapie
- 4.2.7 Das Ansprechen verschiedener Modalitäten
- 4.3 Spezifische Therapiemethoden
- 4.3.1 Die Melodische Intonationstherapie
- 4.3.2 Das PROMPT System / TAKTKIN-Programm
- 4.3.3 Die Assoziationsmethode nach MCGINNIS
- 4.3.4 Die Totale Kommunikationstherapie
- 5. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema der verbalen Entwicklungsdyspraxie, einer Sprachstörung, die sich durch Schwierigkeiten bei der Planung und Ausführung von Sprechbewegungen auszeichnet. Die Arbeit analysiert den Begriff, die Symptomatik und die Diagnostik der Störung und beleuchtet verschiedene Therapieansätze.
- Definition und Begriffskritik der verbalen Entwicklungsdyspraxie
- Symptome und Merkmale der Störung
- Diagnostische Herausforderungen und Methoden
- Verschiedene Therapieansätze und deren Wirksamkeit
- Zusammenhang mit anderen Störungsbildern
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel befasst sich mit der Definition und Begriffskritik der verbalen Entwicklungsdyspraxie. Es wird der historische Kontext der Störung beleuchtet, sowie verschiedene Modelle der Sprachproduktion vorgestellt, um das Störungsbild einzuordnen. Des Weiteren werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zur neurogen erworbenen Apraxie dargestellt.
- Das zweite Kapitel behandelt die Symptomatik der verbalen Entwicklungsdyspraxie. Es werden Informationen zur Häufigkeit, genetischen Disposition, neurologischem Hintergrund, Ausschlusskriterien und nichtsprachlichen Auffälligkeiten gegeben. Des Weiteren werden die typischen Auffälligkeiten der Sprache und des Sprechens bei Betroffenen beschrieben.
- Das dritte Kapitel widmet sich der Diagnostik der verbalen Entwicklungsdyspraxie. Es werden die Herausforderungen der Diagnose und Differentialdiagnose erläutert, sowie klinische Untersuchungsmethoden und verschiedene Prüfverfahren vorgestellt.
- Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Therapie der verbalen Entwicklungsdyspraxie. Es werden allgemeine Überlegungen zur Therapie angestellt und verschiedene Therapieansätze und spezifische Therapiemethoden beschrieben.
Schlüsselwörter
Verbale Entwicklungsdyspraxie, Sprechapraxie, Sprachproduktion, Sprachentwicklung, Diagnostik, Therapie, Artikulation, Phonologie, Motorik, Neurologie.
- Quote paper
- Meike Schröder (Author), 2005, Die verbale Entwicklungsdyspraxie. Eine praktische und theoretische Herausforderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/58585