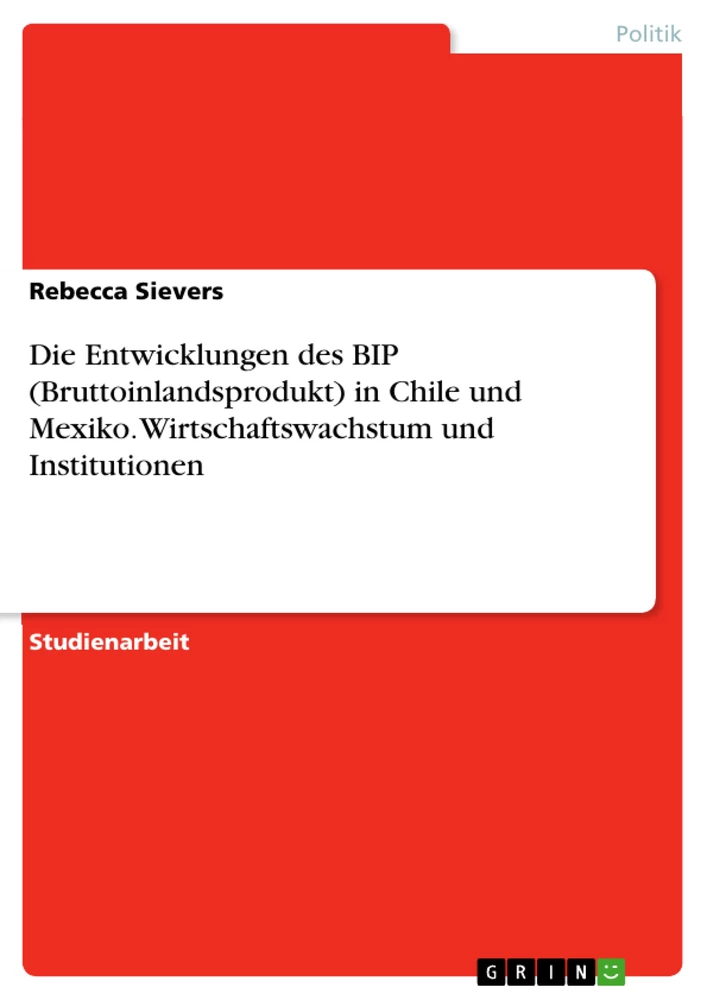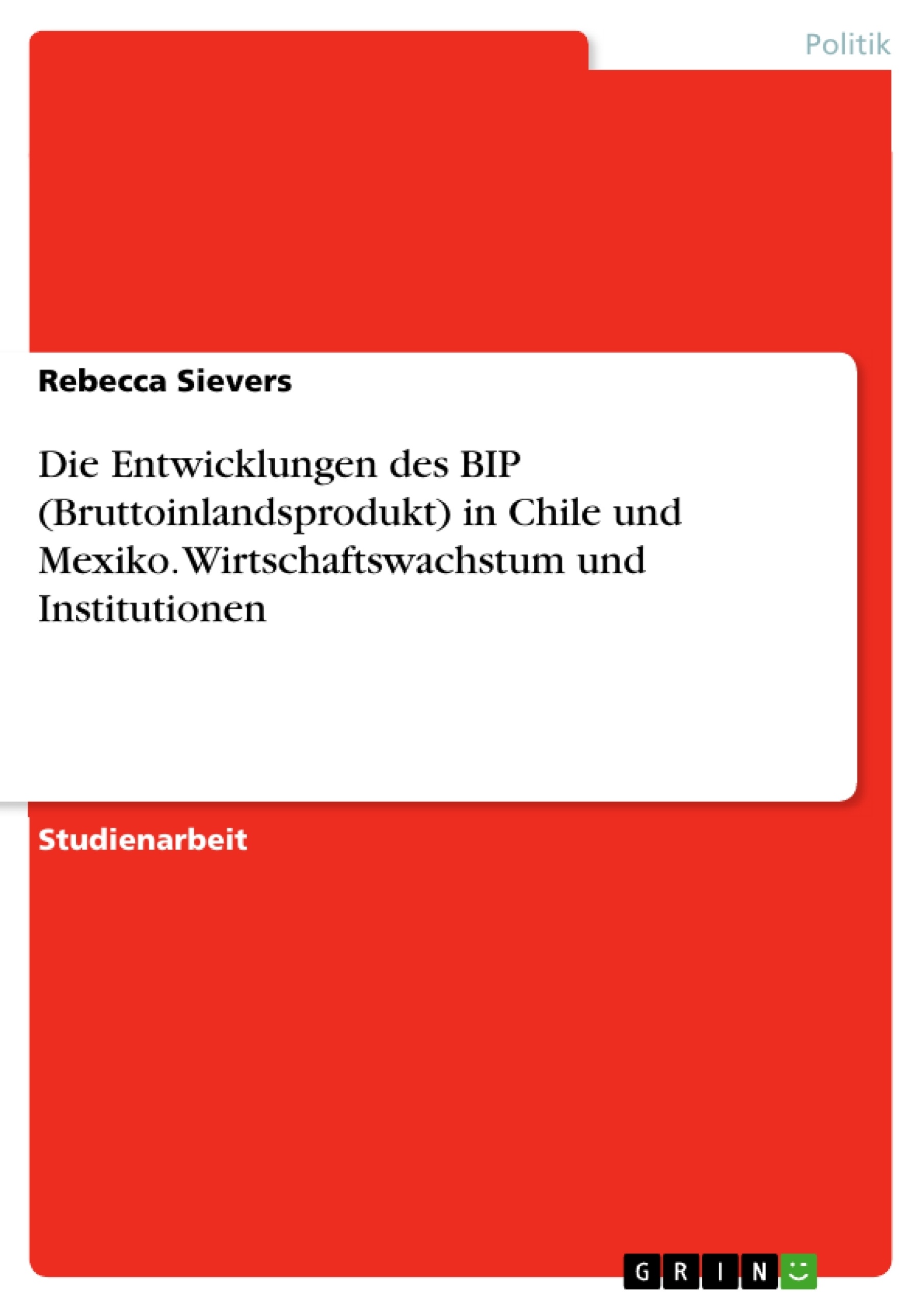Der Regierungschef Mexikos Andrés Manuel López Obrador (AMLO) betont immer wieder, dass „die Politik über der Wirtschaft stehen muss.“ (Blomeier, Beck, Téllez 2019). Was mit der Aussage genau gemeint ist, bleibt zwar unklar, gibt aber eine Idee darüber, wie die mexikanische Politik gegenüber der Wirtschaft eingestellt sein könnte. Politische Ökonomie geht davon aus, dass Politik und Ökonomie sich gegenseitig bedingen und nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. Obrador sieht die Ursache für soziale Ungleichheit in der Privatwirtschaft, weshalb er eine anti-neoliberalistische Haltung vertritt.
Er mag so ziemlich das Gegenteil vom rechtskonservativen Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique sein. Der chilenische Staatschef folgt konsequent der neoliberalen Kultur, durch die das Land seit der Diktatur Augusto Pinochets (1973-1990) geprägt ist. Die sogenannten Chicago Boys, die die Militärdiktatur damals berieten, brachten einen marktradikalen Neoliberalismus nach Chile und verringerten mit weitreichenden Privatisierungen den Einfluss des Staates. Neben sozialer Ungleichheit hatten die Maßnahmen vor allem ein erhöhtes Wirtschaftswachstum zur Folge. Piñera war, bevor er 2010 zum ersten Mal zum Präsidenten von Chile gewählt wurde, vor allem erfolgreicher Unternehmer. Anfang der 1990er Jahre tritt er der rechtskonservativen Renovación Nacional bei, die mit dem Diktator Pinochet sympathisiert. „Piñera selbst hat dessen Menschenrechtsverbrechen verurteilt, die Wirtschaftspolitik aber gelobt.“ (Caspari 2017).
Aus wirtschaftlicher Perspektive gilt Chile heute als das Musterland Lateinamerikas (vgl. Caspari 2017). Mexiko hingegen als Problemkind. Das sind Label, die nicht erst 2018 mit den Amtseintritten von Piñera und Obrador vergeben wurden, sondern sie sind das Ergebnis eines sich über Jahrhunderte entwickelnden Prozesses. Dabei haben beide Staaten ähnliche Kontextbedingungen und zeigten jahrelang eine ähnlich verlaufende wirtschaftliche Entwicklungskurve. Bis Anfang des 21. Jahrhunderts, als die Wachstumskurve Chiles die Mexikos schneidet und übersteigt. Anliegen der vorliegenden Ausarbeitung ist es zu erklären, welche Faktoren dazu führen, dass Wachstum in einem Land ansteigt und welche Faktoren dieses verhindern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Politikwissenschaftliche Relevanz
- Fragestellung und Vorgehensweise
- Literaturdiskussion
- Die Institutionentheorie
- Empirie
- Analytisches Verfahren
- Das koloniale Erbe Lateinamerikas
- Die wirtschaftliche Entwicklung vor 2004: Wachstum unter extraktiven Institutionen
- Die wirtschaftliche Entwicklung nach 2004: Wachstum unter inklusiven Institutionen
- Mexiko
- Chile
- Interpretation und eigene Positionierung
- Grenzen der Ergebnisse und Hypothesenentwicklung
- Fazit
- Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung befasst sich mit der unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklung Mexikos und Chiles. Ziel ist es, die Ursachen für das unterschiedliche Wirtschaftswachstum in den beiden Ländern zu analysieren und zu erklären, welche Faktoren zu einem Anstieg des Wachstums führen können und welche Faktoren dieses verhindern. Hierbei liegt der Fokus auf der Rolle politischer Institutionen und deren Einfluss auf die Wirtschaft.
- Die Bedeutung von Institutionen für Wirtschaftswachstum
- Der Vergleich der politischen und wirtschaftlichen Institutionen in Mexiko und Chile
- Das koloniale Erbe und seine Auswirkungen auf die heutige wirtschaftliche Entwicklung
- Die Rolle von extraktiven und inklusiven Institutionen für das Wirtschaftswachstum
- Die Bedeutung von politischer Stabilität und Demokratie für die Wirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die politische Ökonomie als Forschungsfeld vor und zeigt die Relevanz des institutionellen Vergleichs auf. Es wird die Fragestellung der Arbeit formuliert: Warum boomt die Wirtschaft in Chile, während in Mexiko vor nachlassenden Wachstum gewarnt wird?
- Literaturdiskussion: Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang von Wirtschaftswachstum und politischen Institutionen anhand von relevanten wissenschaftlichen Arbeiten. Es werden die Erkenntnisse von Daron Acemoglu und James A. Robinson sowie von Detlef Nolte und Dierk Herzer zur Erklärung von Wirtschaftswachstum in Entwicklungsländern vorgestellt.
- Die Institutionentheorie: Es wird die Institutionentheorie von Daron Acemoglu und James A. Robinson vorgestellt, die im weiteren Verlauf der Arbeit zur Analyse des Wirtschaftswachstums in Mexiko und Chile angewendet wird.
- Empirie: Dieses Kapitel befasst sich mit der empirischen Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung in Mexiko und Chile. Es werden die unterschiedlichen Entwicklungen des BIP pro Kopf in beiden Ländern dargestellt und im Kontext der jeweiligen politischen und wirtschaftlichen Institutionen analysiert.
Schlüsselwörter
Politische Ökonomie, Institutionentheorie, Wirtschaftswachstum, Entwicklung, Mexiko, Chile, politische Institutionen, extraktive Institutionen, inklusive Institutionen, koloniales Erbe, Demokratie, BIP pro Kopf.
- Arbeit zitieren
- Rebecca Sievers (Autor:in), 2020, Die Entwicklungen des BIP (Bruttoinlandsprodukt) in Chile und Mexiko. Wirtschaftswachstum und Institutionen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/585090