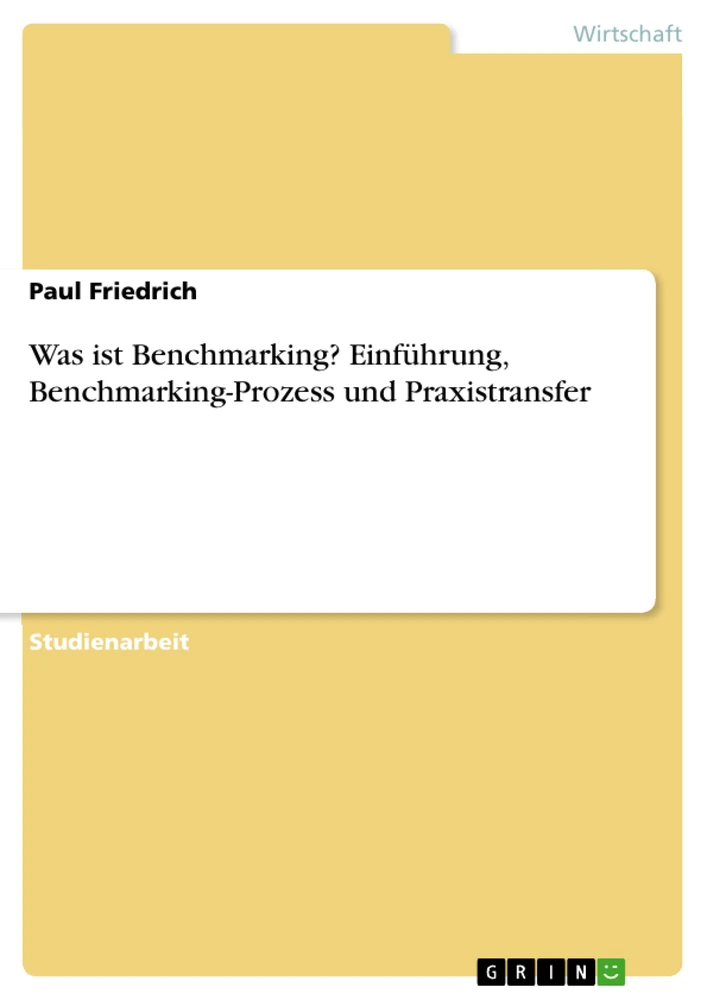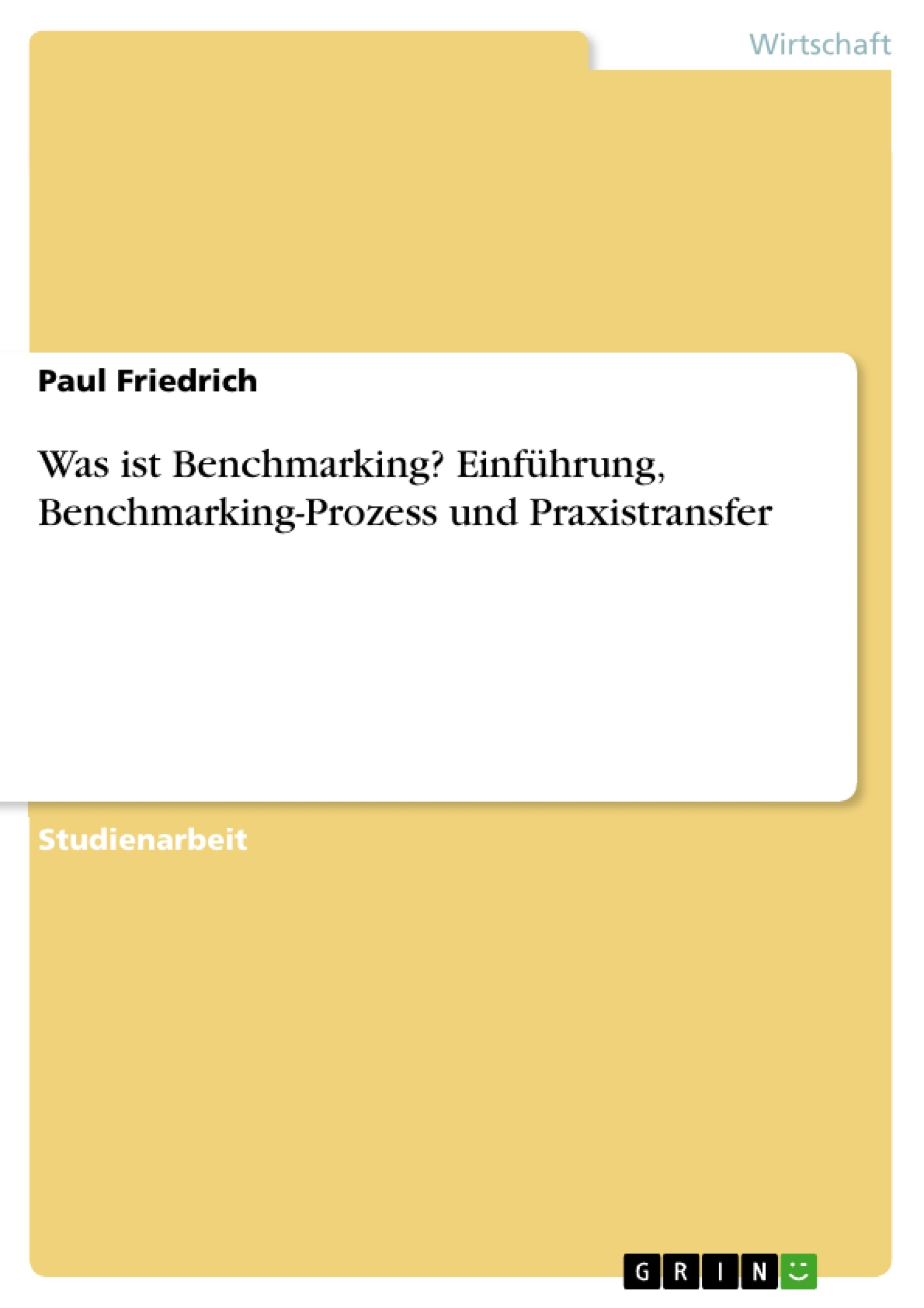Im Rahmen dieser Arbeit wird zuerst auf die Grundlagen des Benchmarkings sowie verschiedene Definitionen näher eingegangen. Anschließend wird ein Einblick in die verschiedenen Arten des Benchmarkings gegeben. Das Schwerpunktkapitel spiegelt detailliert den Benchmarking-Prozess anhand seiner fünf Phasen wider. Der anschließende Praxistransfer verdeutlicht die praktische Umsetzung des theoretischen Benchmarking-Konzeptes.
"Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist."
Dieses Zitat von Henry Ford verdeutlicht, dass eine stetige Weiterentwicklung essenziell für den Fortschritt ist, genauso ist es auch im Benchmarking.
Der ökonomische Wettbewerb ist aggressiver und globaler geworden denn je. Die Globalisierung und die nahezu vollständige Transparenz der Märkte, wachsender Kostendruck, die Dynamik der Märkte, kürzere Produktlebenszyklen sowie ständig wachsende Kundenwünsche zwingen Unternehmen dazu, ihre Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen sowie ihre Kosten zu senken, um in der heutigen Wirtschaft bestehen zu können. Einerseits wird für die Unternehmensentwicklung eine gewisse Kontinuität erwartet, welche zwangsläufig mit stabilen Prozessen einhergeht, auf der anderen Seite verlangt der Markt eine sehr hohe Flexibilität bei stets steigenden Qualitätsanforderungen. Um diesen Spagat meistern zu können, müssen die Unternehmen kontinuierlich nach Verbesserungen und vor allem nach Innovationen streben. Das Benchmarking ist also ein geeignetes Tool, um eine Wettbewerbsposition zurückzugewinnen, zu sichern oder auszubauen. Bei diesem Management-Instrument wird das Ziel angestrebt, der "Beste der Besten" zu werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen des Benchmarking
- 2.1. Definition „Benchmark“
- 2.2. Definition „Benchmarking“
- 3. Arten des Benchmarking
- 3.1. Internes Benchmarking
- 3.2. Externes Benchmarking
- 3.2.1 Branchenunabhängiges Benchmarking
- 3.2.2 Markt bzw. Konkurrentenbezogenes Benchmarking
- 3.2.3 Branchenbezogenes Benchmarking
- 4. Der Benchmarking-Prozess
- 4.1. Zielsetzung
- 4.2. Interne Analyse
- 4.3. Vergleichsphase
- 4.4. Ableitung von Maßnahmen
- 4.5. Umsetzung
- 5. Praxistransfer: Branchenunabhängiges, externes Benchmarking bei Praxispartner BMW Motorsport
- 6. Chancen und Grenzen des Benchmarking
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, das Konzept des Benchmarkings umfassend zu erläutern und seine praktische Anwendung zu veranschaulichen. Dabei werden die Grundlagen des Benchmarkings, verschiedene Arten und der detaillierte Prozess im Fokus stehen. Ein Praxisbeispiel verdeutlicht die Umsetzung.
- Definition und Arten des Benchmarkings
- Der Benchmarking-Prozess in einzelnen Phasen
- Branchenunabhängiges Benchmarking am Beispiel BMW Motorsport
- Chancen und Grenzen des Benchmarking
- Zusammenfassende Bewertung der Bedeutung von Benchmarking für Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Notwendigkeit kontinuierlicher Weiterentwicklung im heutigen, kompetitiven und globalisierten Wirtschaftsumfeld. Sie unterstreicht die Bedeutung von Kostensenkung und Leistungssteigerung angesichts von steigenden Kundenansprüchen und kürzeren Produktlebenszyklen. Benchmarking wird als geeignetes Instrument zur Verbesserung der Wettbewerbsposition vorgestellt und der Aufbau der Arbeit skizziert.
2. Grundlagen des Benchmarking: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen des Benchmarkings dar, beginnend mit verschiedenen Definitionen des Begriffs „Benchmark“ als messbarer Referenzpunkt und „Benchmarking“ als Prozess zur Identifikation von Bestleistungen. Es bildet die Basis für das Verständnis der darauffolgenden Kapitel.
3. Arten des Benchmarking: Hier werden unterschiedliche Arten des Benchmarkings differenziert, unterteilt in internes und externes Benchmarking. Das externe Benchmarking wird weiter in branchenunabhängiges, markt- bzw. konkurrentenbezogenes und branchenbezogenes Benchmarking untergliedert, wobei die jeweiligen Vor- und Nachteile implizit hervorgehoben werden.
4. Der Benchmarking-Prozess: Dieses zentrale Kapitel beschreibt den Benchmarking-Prozess in fünf Phasen: Zielsetzung, interne Analyse, Vergleichsphase, Ableitung von Maßnahmen und Umsetzung. Es bietet eine detaillierte Anleitung zur systematischen Durchführung von Benchmarking-Projekten und stellt einen strukturierten Ablauf dar.
5. Praxistransfer: Branchenunabhängiges, externes Benchmarking bei Praxispartner BMW Motorsport: Dieser Abschnitt zeigt die praktische Anwendung des Benchmarking-Konzepts am Beispiel von BMW Motorsport. Er veranschaulicht die einzelnen Schritte des Prozesses anhand eines konkreten Fallbeispiels und verdeutlicht so die Relevanz der vorangegangenen Kapitel.
6. Chancen und Grenzen des Benchmarking: Das Kapitel beleuchtet die Chancen und Risiken des Benchmarkings. Es analysiert die potentiellen Vorteile, wie z.B. Wettbewerbsvorteile und Effizienzsteigerungen, aber auch die möglichen Herausforderungen, wie z.B. die Schwierigkeit, geeignete Vergleichspartner zu finden und die richtige Daten zu interpretieren.
Schlüsselwörter
Benchmarking, Wettbewerbsfähigkeit, Kostenoptimierung, Prozessoptimierung, Best-Practice, interne Analyse, externe Analyse, Vergleich, Maßnahmenableitung, Umsetzung, BMW Motorsport, Referenzpunkte, Marktforschung, Wettbewerbsvorteil.
Häufig gestellte Fragen zum Benchmarking-Dokument
Was ist der Inhalt des Benchmarking-Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Benchmarking. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, sowie eine Liste der Schlüsselwörter. Der Schwerpunkt liegt auf der Erklärung der Grundlagen, verschiedener Arten und des detaillierten Prozesses des Benchmarkings, veranschaulicht durch ein Praxisbeispiel von BMW Motorsport.
Welche Arten von Benchmarking werden behandelt?
Das Dokument unterscheidet zwischen internem und externem Benchmarking. Externes Benchmarking wird weiter unterteilt in branchenunabhängiges, markt- bzw. konkurrentenbezogenes und branchenbezogenes Benchmarking. Die jeweiligen Vor- und Nachteile werden implizit behandelt.
Wie wird der Benchmarking-Prozess beschrieben?
Der Benchmarking-Prozess wird in fünf Phasen unterteilt: Zielsetzung, interne Analyse, Vergleichsphase, Ableitung von Maßnahmen und Umsetzung. Das Dokument bietet eine detaillierte Anleitung zur systematischen Durchführung von Benchmarking-Projekten.
Welches Praxisbeispiel wird verwendet?
Als Praxisbeispiel wird das branchenunabhängige, externe Benchmarking bei BMW Motorsport herangezogen. Dieser Abschnitt veranschaulicht die einzelnen Schritte des Prozesses anhand eines konkreten Fallbeispiels.
Welche Chancen und Grenzen des Benchmarking werden angesprochen?
Das Dokument beleuchtet sowohl die Chancen (z.B. Wettbewerbsvorteile und Effizienzsteigerungen) als auch die Grenzen (z.B. Schwierigkeit, geeignete Vergleichspartner zu finden und Daten richtig zu interpretieren) des Benchmarkings.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Dokument?
Die Schlüsselwörter umfassen Benchmarking, Wettbewerbsfähigkeit, Kostenoptimierung, Prozessoptimierung, Best-Practice, interne Analyse, externe Analyse, Vergleich, Maßnahmenableitung, Umsetzung, BMW Motorsport, Referenzpunkte, Marktforschung und Wettbewerbsvorteil.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der Kapitel?
Das Dokument enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels, beginnend mit der Einleitung und endend mit der Analyse der Chancen und Grenzen des Benchmarkings. Diese Zusammenfassungen liefern einen schnellen Überblick über den Inhalt jedes Abschnitts.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Zielsetzung des Dokuments ist es, das Konzept des Benchmarkings umfassend zu erläutern und seine praktische Anwendung zu veranschaulichen. Es soll ein umfassendes Verständnis der Grundlagen, Arten und des Prozesses des Benchmarkings vermitteln.
- Quote paper
- Paul Friedrich (Author), 2020, Was ist Benchmarking? Einführung, Benchmarking-Prozess und Praxistransfer, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/584797