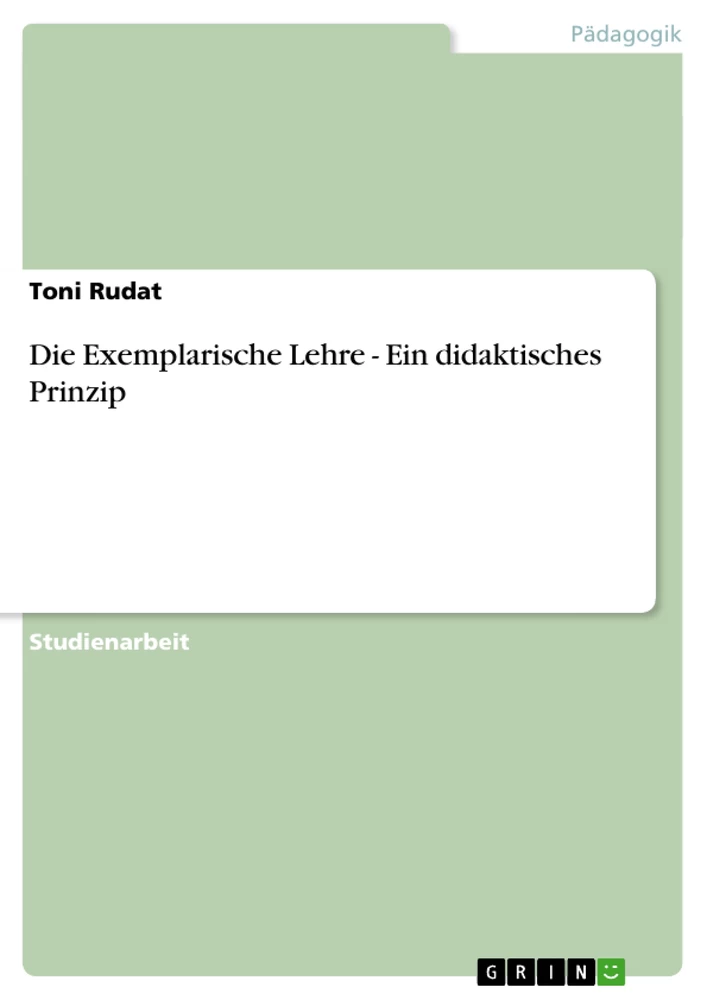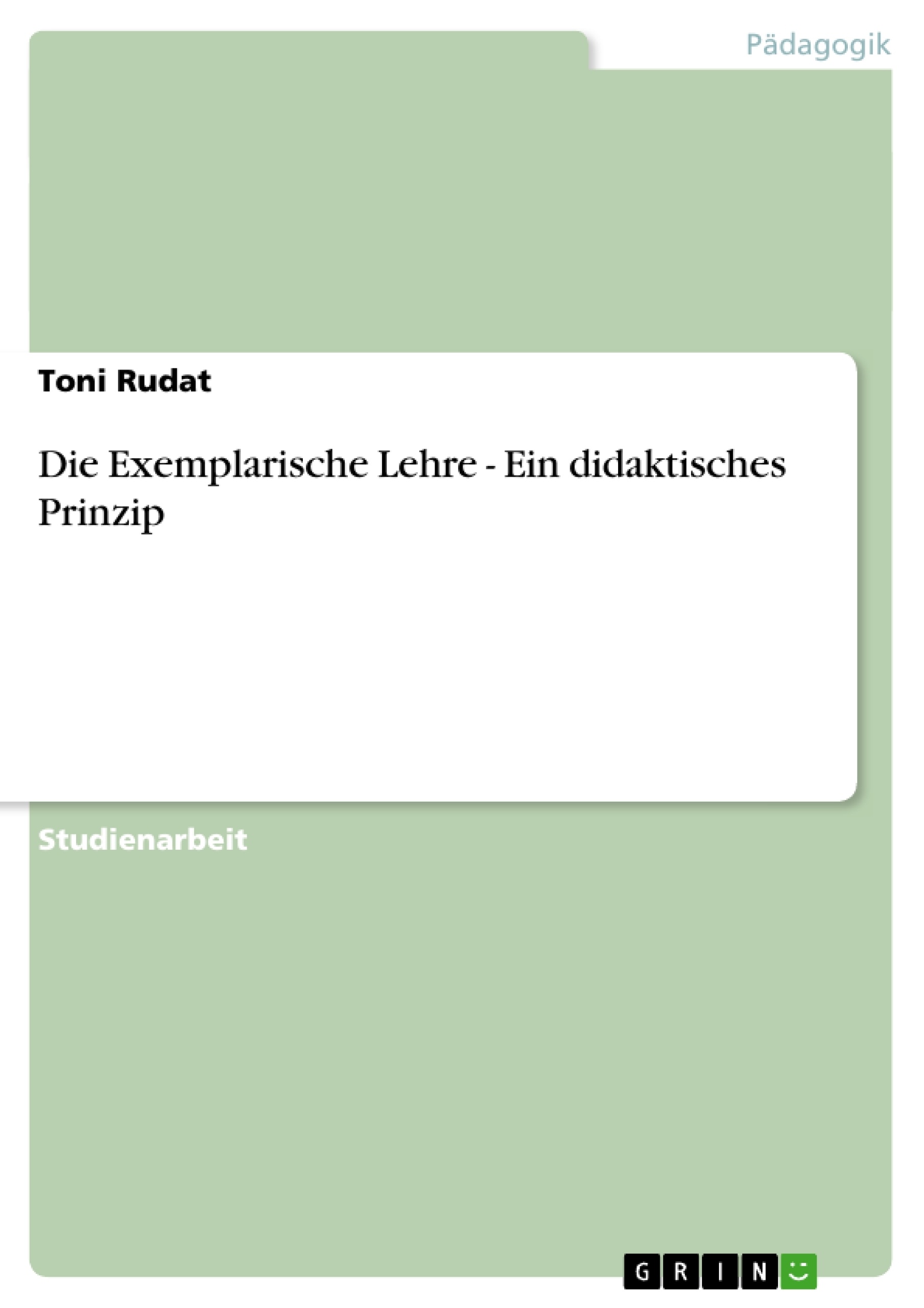Martin Wagenschein, der Mathematik, Geographie und Physik, zunächst in Gießen später in Freiburg, auf Lehramt studierte, setzte sich früh mit der Problematik der Stofffülle an wissenschaftsspezifischen Gymnasien auseinander. Vorallem in den fünfziger und sechziger Jahren forderte er eine „neue Art des Lehrens und Lernens“.1 Er war der Überzeugung, dass die Fülle an zu lernendem Stoff an Schulen zum Einen hervorgerufen werde durch die Wirtschaft, die »fertige Endprodukte« von den Schulen verlange, also Schüler, die regelrechte Spezialisten sind, und zum anderen durch die Fachlehrer, die als »Anwälte ihrer Wissenschaft« in den Schulen fungieren würden und ihre Wissenschaft, als die wichtigste Wissenschaft unter allen anderen ansehen. Wagenschein suchte nach einer entlastenden Lehrmethode für Schüler, sowie für Lehrer. Er war der Überzeugung, dass der ursprünglichste Sinn der Schule, als »Stätte der Muße für geistiges Leben« zu dienen, durch den zum Teil von außen ausgeübten Druck, aber auch durch den Druck von innen verloren ginge. Wagenschein sah es als einen utopischen Versuch an, bereits abgeschlossene Weltbilder und Spezialisten von der Schule zu entlassen und glaubte das Ziel der Schule bzw. die Bildungsaufgabe der Lehrer bestünde viel mehr darin, die Schüler geistig zu öffnen. Er strebte danach mit den Schülern ein Minimalziel zu erreichen, durch welches sie in der Lage wären alles weitere Wissen zu erschließen. Er sah das Durchdringen des Wesentlichen der Unterrichtsgegenstände als vorrangig vor jeder stofflichen Ausweitung an. Er suchte also nach dem exemplarischen Prinzip zu lehren. Damit trat Wagenschein eine fundamentale Diskussion in der Bildungspolitik und -didaktik los.2
Gustav Siewerth bezeichnet den Stoffplan an Gymnasien als »die Erledigungsmaschinerie des Unterrichts« und verweist darauf, dass das Hasten durch bereits getroffene Erkenntnisse in den Wissenschaften zu einer Demotivation von Schülern und Lehrern führt und schließlich gipfelt zu einem mehr oder minder gestörtem Verhältnis der Schüler zum Lehrgegenstand. Er prangert das regelkonforme Auswendiglernen von Formel an und warnt vor der »gedankenlosen Phantastik des Materialismus«. Denn bei dem stupiden Auswendiglernen von bereits durch andere erfahrene Gegebenheiten verkümmere die Erfahrung der Schüler im Bezug auf die Welt. Verloren in Abstraktionen und Formel seien Schüler nicht mehr im Stande dazu eigene Erfahrungswerte zu sammeln, zu deuten, zu verstehen.3
Inhaltsverzeichnis
- Impuls, der zur Lehre führte
- Problematik
- Einführende Wesensbestimmung
- Das eigentlich Exemplarische
- Formen und Prinzipien der Exemplarische Repräsentation
- Das Paradigma
- Das Exemplar
- Das Exempel
- Der Typus einer Gruppe
- Der Fall einer Regel
- Das Gleichnis
- >>Mut zur Lücke-Mut zur Gründlichkeit«
- Kurze kritische Auseinandersetzung mit der exempl. Lehre
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text „Die exemplarische Lehre“ von Toni Frauke Rudat befasst sich mit dem didaktischen Prinzip der exemplarischen Lehre. Die Arbeit untersucht das Konzept, die Geschichte und die Anwendung der exemplarischen Lehre in der Bildungspraxis. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Möglichkeiten, die dieses Prinzip für den Unterricht bietet.
- Die Kritik an der Stofffülle im Bildungssystem
- Die Bedeutung von Gründlichkeit und Selbsttätigkeit im Lernen
- Die Rolle von Exempeln und Paradigmen in der Wissensvermittlung
- Die Relevanz der historischen Entwicklung eines Fachgebiets
- Die Beziehung zwischen Schüler und Lehrgegenstand
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Einleitung, die den Impuls für die exemplarische Lehre darstellt. Martin Wagenschein, ein wichtiger Vertreter dieses Konzepts, kritisiert die Stofffülle im Bildungssystem und die daraus resultierenden Probleme für Schüler und Lehrer. Die Problematik der exemplarischen Lehre wird diskutiert, insbesondere die Frage, wie das Wesentliche eines Fachgebiets exemplarisch repräsentiert werden kann.
Die Wesensbestimmung des Exemplarischen fokussiert auf wichtige Elemente wie Gründlichkeit, Selbsttätigkeit, Spontaneität und das genetische Verfahren. Wagenschein betont die Notwendigkeit, sich eingehend mit einem Problem auseinanderzusetzen und die historische Entwicklung eines Fachgebiets zu berücksichtigen.
Formen und Prinzipien der exemplarischen Repräsentation werden im Detail beschrieben, wobei unterschiedliche Typen von Exempeln vorgestellt werden. Die Bedeutung von Mut zur Lücke und zur Gründlichkeit wird im Kontext der exemplarischen Lehre erläutert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter in diesem Text sind: exemplarische Lehre, Martin Wagenschein, Stofffülle, Gründlichkeit, Selbsttätigkeit, Spontaneität, genetisches Verfahren, Exempel, Paradigma, historische Entwicklung, Wissensvermittlung, Bildungspraxis, Unterrichtsprinzip.
- Quote paper
- Toni Rudat (Author), 2005, Die Exemplarische Lehre - Ein didaktisches Prinzip, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/58357