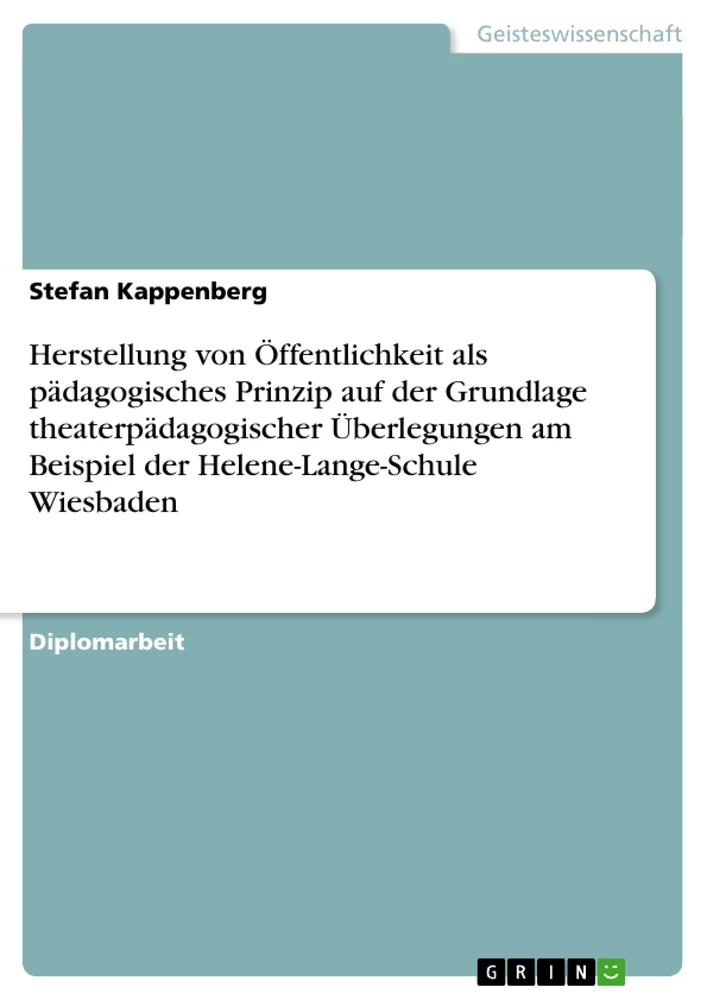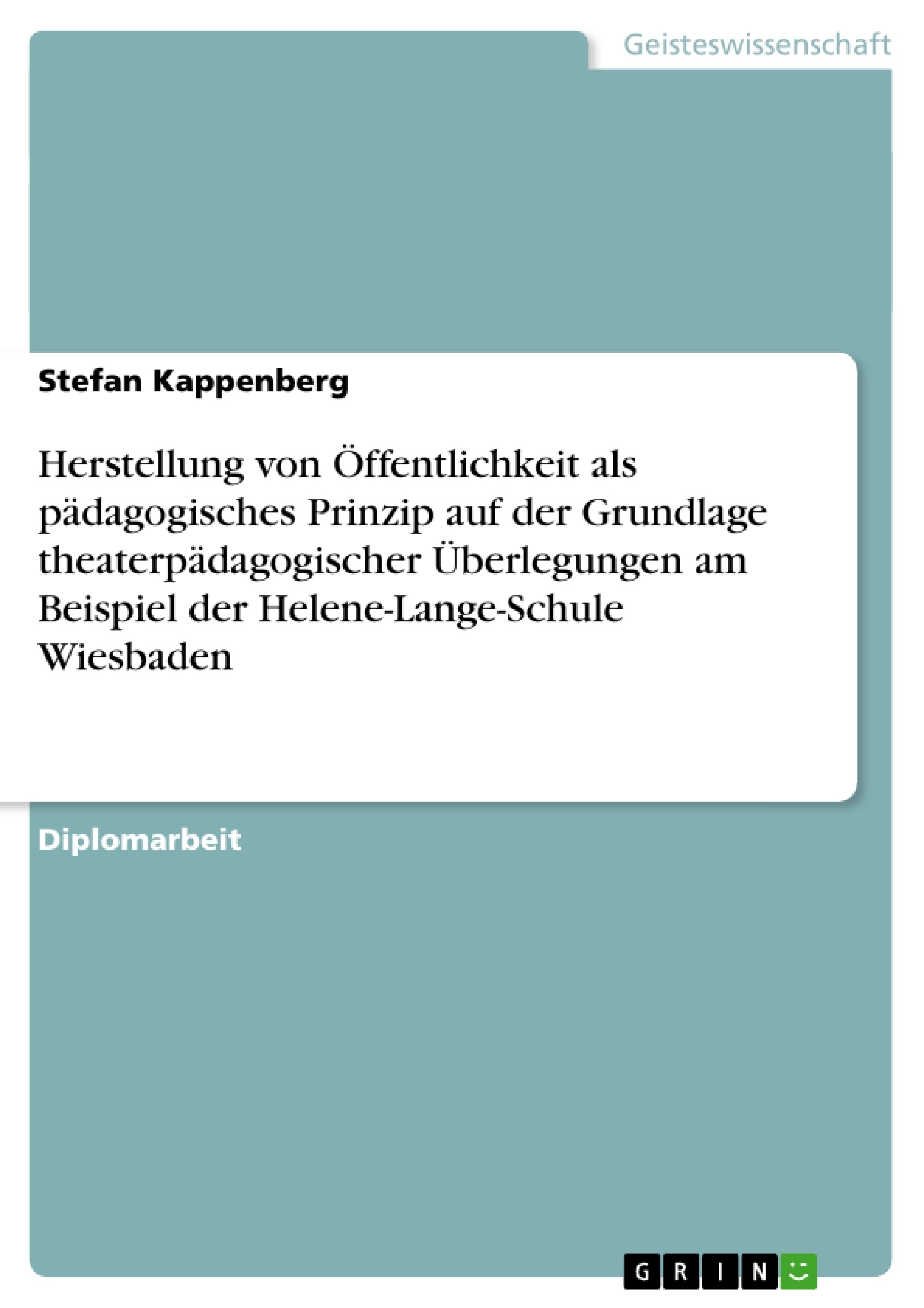Die aktuellen Ergebnisse der Pisa- und Iglustudien haben den Reformdiskussionen um die Schule der Zukunft neue Impulse gegeben. Wer jedoch nach grundlegend neuen Konzepten sucht, wird sich schwer tun, denn alles scheint schon einmal da gewesen zu sein. Die Experten scheinen jedoch darin einig zu sein, dass die Bedingungen für Persönlichkeitsentwicklung und effektiveres Lernen in der zukünftigen Schulwirklichkeit dringend verbessert werden müssen. Wie dies jedoch nach dem Pisa-Schock durch immer wieder geforderte Qualitätssicherungsmaßnahmen in Form stärkerer Leistungsüberwachung geschehen soll, bleibt äußerst fraglich und ruft etablierte Reformpädagogen wie Hartmut von Hentig und Enja Riegel, die für deutlich weiter gehende Veränderungen plädieren, auf den Plan.
Bei einer Vielzahl von Kritikern am heutigen Schulsystem wird immer wieder Klage geführt, dass Schule in der jetzigen Form zu wenig praxisnah sei und dass beim Lernstoff in der Regel der Lebenssinnzusammenhang fehle, was wiederum die Schülermotivation minimiere. Auch die Kommunikation werde durch den nach wie vor großen Anteil des Frontalunterrichts eher gehemmt als gefördert, und schließlich bleibe die Hauptaufgabe, Selbstbewusstsein und Persönlichkeit zu fördern, weit hinter dem Anspruch an die Leistungsfähigkeit der Schüler zurück.
Untersuchungen, die sowohl an der Helene-Lange-Schule (HLS) in Wiesbaden als auch an der Laborschule Bielefeld durchgeführt wurden, belegen, dass ein höherer Anspruch an die Persönlichkeitsentwicklung, z. B. im Rahmen ästhetischer Bildung, trotz Reduzierung des Fachunterrichts nicht zu schlechteren Leistungen führen muss.
Will man den Ergebnissen der Pisa-Studie an der Helene-Lange-Schule Glauben schenken, so könnte man die These aufstellen, dass es gerade mit diesem Bildungsschwerpunkt möglich war, unter den Gesamtschulen Testsieger zu werden.
Was ist nun das Besondere an der Reformschule in Hessen, deren Schulleiterin, Enja Riegel, die provokante These aufstellt: „Theater macht gut in Mathe.“?
Bei genauerer Betrachtung der pädagogischen Arbeit fällt auf, dass die Herstellung von Öffentlichkeit eine besondere Rolle einnimmt und gezielt in der pädagogischen Praxis eingesetzt wird.
Wie und mit welchem Erfolg dies bisher geschehen ist und wie es möglich war, dass diese Schule trotz einer Verminderung des Fachunterrichts um ein Drittel der Stundenzahl an die Spitze der deutschen Gesamtschulen vorstoßen konnte, sollen die Kernfragen dieser Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lernpsychologische Grundlagen
- Grundbedingungen effizienten Lernens
- Lernmotivation
- Flow-Erlebnisse als Handlungsmotivation
- Pädagogische Grundlagen
- Erfahrungslernen nach Freinet
- Praxislernen
- Lernen im LdL-Verfahren
- Schule als Polis
- Theaterpädagogische Überlegungen
- Möglichkeiten theaterpädagogischer Arbeit
- Ästhetisches und psychosoziales Erfahrungsspektrum
- Öffentlichkeit als Motor der Theaterarbeit
- Theaterpädagogische Spielformen
- Erfahrungslernen im Szenischen Spiel
- Forumtheater als Instrument politischer Bildung in der Schule
- Herstellung von Öffentlichkeit an der Helene-Lange-Schule
- Formen von Öffentlichkeit
- Pädagogische Grundsätze
- Veröffentlichung schulischer Leistung
- Wirtschaftlichkeit
- Schule als Erfahrungsraum politischer und sozialer Verantwortung
- Montag-Morgen-Kreis
- Einbindung von Fachleuten
- Innerschulische Lernfelder
- Für andere lesen und schreiben
- Schüler als Lehrende
- ,,Radio Aktiv”
- Raus aus der Schule - Lernen in Ernstsituationen
- Forschungsreisen statt Klassenfahrten
- Praktika
- Das Sozialpraktikum
- Das Nepal-Projekt
- Theaterarbeit an der HLS
- Professionelle Theaterarbeit
- Thematische Theaterarbeit
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die pädagogische Praxis der Helene-Lange-Schule (HLS) in Wiesbaden, die sich durch die gezielte Herstellung von Öffentlichkeit auszeichnet. Ziel ist es, zu verstehen, wie die HLS trotz einer Reduzierung des Fachunterrichts um ein Drittel der Stundenzahl an die Spitze der deutschen Gesamtschulen vorstoßen konnte und welche Rolle die Herstellung von Öffentlichkeit dabei spielt.
- Herstellung von Öffentlichkeit als pädagogisches Prinzip
- Einfluss von Theaterpädagogik auf die Lernmotivation und -ergebnisse
- Praxisnähe und Erfahrungslernen in der pädagogischen Arbeit der HLS
- Bedeutung von Selbstverantwortung und -initiative für die Schüler
- Integration von Theaterpädagogik in den Schulalltag
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Relevanz der HLS als Beispiel für eine erfolgreiche Reformschule dar, die den Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung und Praxisnähe legt.
- Lernpsychologische Grundlagen: Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Lernmotivation und Flow-Erlebnissen für effektives Lernen.
- Pädagogische Grundlagen: Das Kapitel erläutert wichtige pädagogische Konzepte wie Erfahrungslernen nach Freinet und Praxislernen, die an der HLS umgesetzt werden.
- Theaterpädagogische Überlegungen: Das Kapitel beschäftigt sich mit der Verwendung von Theaterpädagogik als Mittel zur Förderung von Selbstbewusstsein, Kreativität und kritischem Denken.
- Herstellung von Öffentlichkeit an der Helene-Lange-Schule: Das Kapitel beschreibt die verschiedenen Formen der Öffentlichkeitsarbeit an der HLS, wie z.B. die Veröffentlichung schulischer Leistungen und die Einbindung von Fachleuten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Themen wie Theaterpädagogik, Herstellung von Öffentlichkeit, Praxislernen, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstverantwortung, Motivation, Flow-Erlebnisse, Reformschule, Helene-Lange-Schule, Wiesbaden.
- Quote paper
- Stefan Kappenberg (Author), 2006, Herstellung von Öffentlichkeit als pädagogisches Prinzip auf der Grundlage theaterpädagogischer Überlegungen am Beispiel der Helene-Lange-Schule Wiesbaden, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/58139