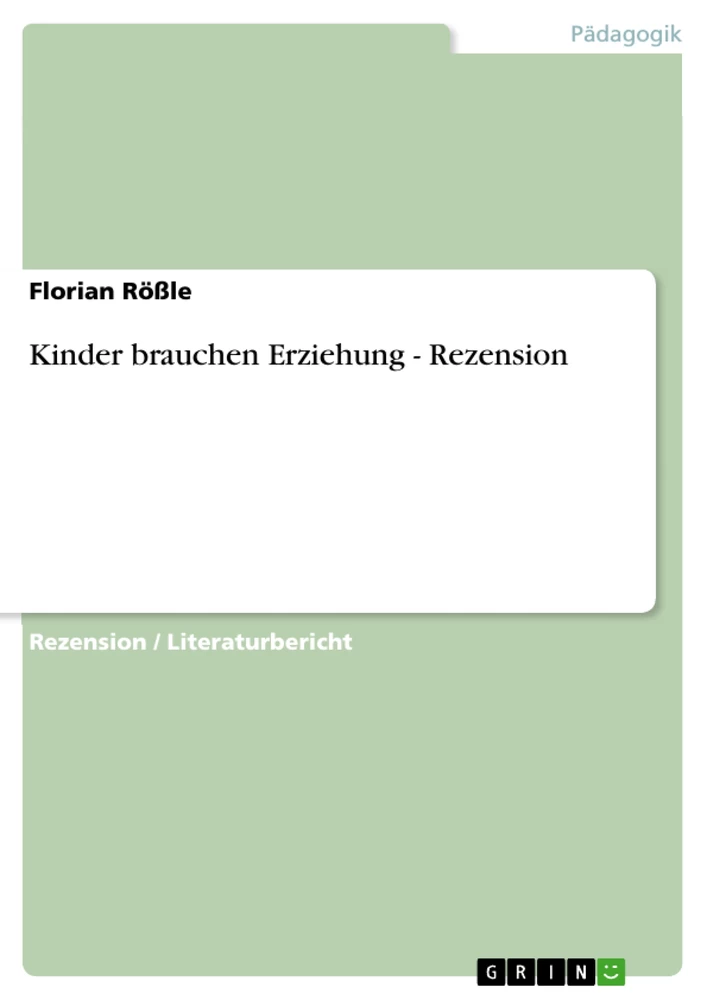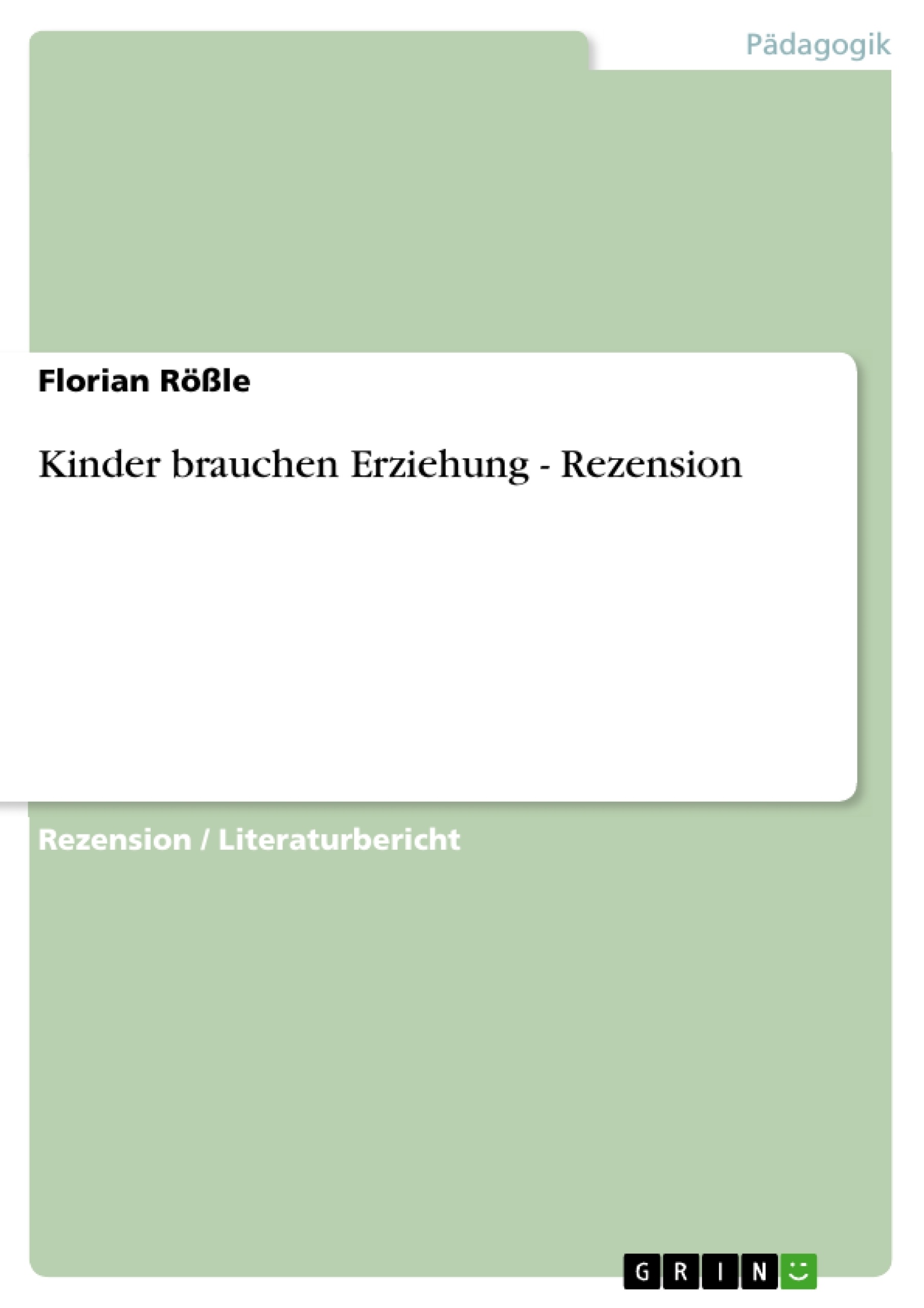Destruktives durch eine geglückte, also spannungsfreie, Mutter - Kind Bindung relativ einfach zu verhindern sei. Dieser Position kann sich Ahrbeck nicht anschließen (vgl. Ahrbeck, 2004, S. 30). Im folgenden Kapitel beschäftigt sich Ahrbeck nun mit neueren Erkenntnissen der Säuglings- und Kleinkindforschung. Hierbei beruft er sich vor allem auf Schriften von Dornes (Dornes, 1996) und fasst deren Aussagen wie folgt zusammen: „Der Säugling gilt nicht mehr als ein passives Triebwesen, dass in erster Linie hilflos und abhängig ist, sondern von Anfang an als beziehungsfähig und mit einer Vielzahl von Kompetenzen ausgestattet.“ (Ahrbeck, 2004, S. 31). Nach einer kurzen Zusammenfassung der Ergebnisse und Vorgehenswiese der Säuglingsforschung, setzt sich Ahrbeck kritisch mit dieser auseinander. Der für ihn entscheidende Kritikpunkt ist erneut die Ausblendung der Triebe: „Der kompetente Säugling leidet nicht, ist nicht in sich zerrissen, er funktioniertwie ein kleiner Erwachsener.“ (Ahrbeck, 2004, S. 48). Des weiteren missfällt ihm der zunehmende Einfluss der Naturwissenschaften auf primär geistes-und gesellschaftswissenschaftliche Problembereiche (vgl. Ahrbeck, 2004, S. 49). Anschließend nimmt er sich der 68er Bewegung und der daraus resultierten Erziehungsziele und Methoden an. Deren scheitern will er exemplarisch anhand des aktuellen pädagogischen Umgangs mit Kindern und Jugendlichen in extremen Lebenssituationen zeigen, da sich seiner Meinung nach vor allem in diesem Arbeitsfeld die alten Ideale unreflektiert bis heute gehalten hätten (vgl. Ahrbeck, 2004, S. 58). Hierzu greift er das Thema der Jugendkriminalität heraus. Hier zeige sich anhand extrem delinquenter Jugendlicher ein zeittypisches Problem: „Es ist das einer Erwachsenengeneration, die sich ihres eigenen Erziehungsauftrages unsicher geworden ist. Mit ‚Erziehungsvergessenheit’ lässt es sich grob, aber zutreffend umreißen.“ (Ahrbeck, 2004, S. 60). Diese Erziehungsvergessenheit der Eltern fördere delinquentes Verhalten. Aufgrund von Prinzipien wie dem der Freiwilligkeit oder der Ansicht Kinder und Jugendliche seinen Experten ihres Lebens, sei es den entsprechenden sozialpädagogisch tätigen nicht möglich adäquat zu intervenieren und extrem delinquenten Jugendlichen zu helfen (vgl. Ahrbeck, 2004, S. 65ff). [...]
Inhaltsverzeichnis
- Zentrale Aussagen Ahrbecks
- Aufbau, Sprache und Sekundärliteratur bei Ahrbeck
- Kritikpunkte an Ahrbecks Thesen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Bernd Ahrbecks Buch "Kinder brauchen Erziehung" befasst sich mit der Bedeutung von Erziehung im 21. Jahrhundert. Es stellt die These auf, dass eine zunehmende Abkehr von traditionellen Erziehungsmodellen zu einer "Erziehungsvergessenheit" in der Gesellschaft führt, welche negative Folgen für Kinder und Jugendliche hat.
- Kritik an der modernen Säuglingsforschung und ihren Auswirkungen auf die Erziehung
- Die Rolle der 68er-Bewegung und ihre Folgen für die Erziehungspraxis
- Die Auswirkungen von Konstruktivismus und Systemtheorie auf die Erziehung
- Die zunehmende Ökonomisierung der sozialen Arbeit und ihre Folgen für die Erziehung
- Die Bedeutung der Generation für die Erziehung und die Unterscheidung zwischen Kindheit und Erwachsensein
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Ahrbeck kritisiert die moderne Säuglingsforschung und stellt fest, dass sie die Rolle von Trieben und inneren Konflikten im Kind vernachlässigt. Er argumentiert, dass die Betonung von Bindung und Harmonie die Bedeutung von inneren Konflikten für die Entwicklung des Kindes ignoriert.
- Kapitel 2: Ahrbeck stellt die Auswirkungen der 68er-Bewegung auf die Erziehungspraxis dar. Er argumentiert, dass die Prinzipien der Freiwilligkeit und der Autonomie des Kindes in der heutigen Zeit zu einer Schwächung von Erziehungspositionen geführt haben und damit zu einer Zunahme von delinquentem Verhalten.
- Kapitel 3: Ahrbeck kritisiert die zunehmende Ökonomisierung der sozialen Arbeit. Er argumentiert, dass die Sichtweise des Zöglings als Kunde, der frei aus einem Angebot wählen kann, zu einer Abnahme der Verantwortung von Erziehern und zu einer Vernachlässigung von Erziehungszielen führt.
- Kapitel 4: Ahrbeck beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Globalisierung auf die Erziehung. Er argumentiert, dass die These der Individualisierung und der Auflösung von traditionellen Familienstrukturen nicht haltbar ist. Die zunehmende Zeitverknappung in der heutigen Gesellschaft führe zu einer fehlenden Frustrationstoleranz und einem Ausbleiben der Beschäftigung mit dem eigenen Innenleben bei Heranwachsenden.
Schlüsselwörter
Erziehung, Säuglingsforschung, 68er-Bewegung, Konstruktivismus, Systemtheorie, Ökonomisierung, Globalisierung, Individualisierung, Zeitverknappung, Generation, Kindheit, Erwachsensein.
- Quote paper
- Florian Rößle (Author), 2006, Kinder brauchen Erziehung - Rezension, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/57964