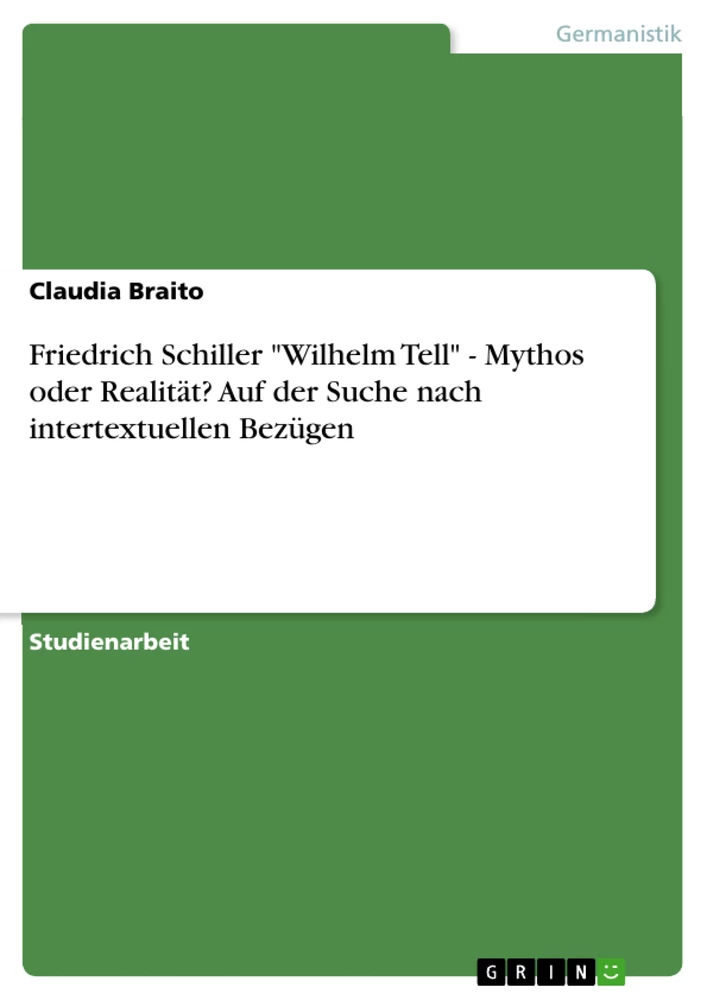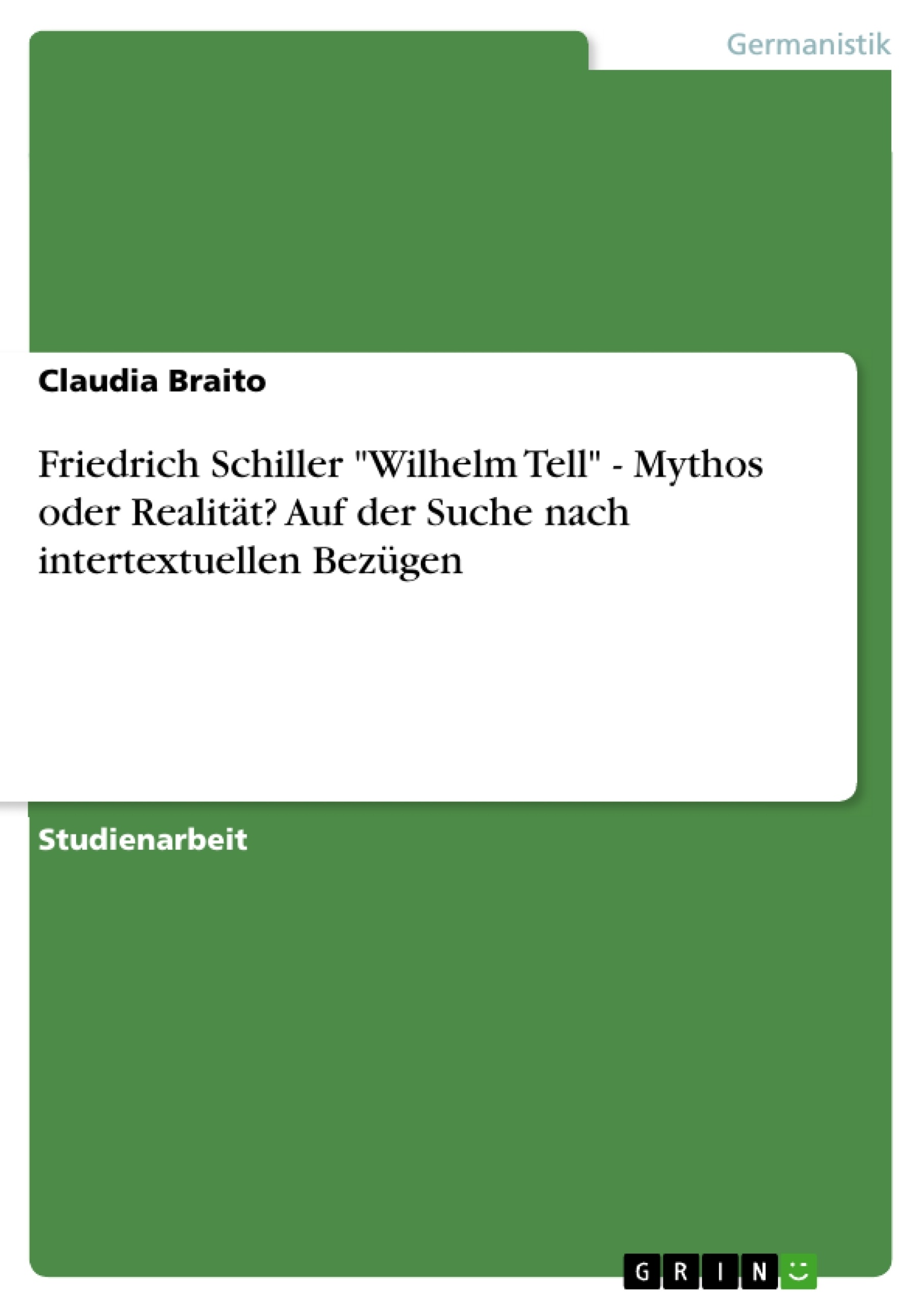Wilhelm Tell, die Titelfigur von Schillers Drama, die Mythen, die ihn umgeben und seine Bedeutung für die Geschichte der Schweiz stehen im Mittelpunkt dieser Proseminararbeit. Zudem sollen intertextuelle Bezüge zwischen Schillers Tell, dem „echten“ Tell und der Geschichte hergestellt werden. Im Wesentlichen lässt sich die Legende von Wilhelm Tell wie folgt zusammenfassen: Wilhelm Tell, ein Schweizer Bauer und Jäger, ist unter seinen Landsgenossen als ehrbarer und hilfsbereiter Mensch bekannt. Als die Waldstätte durch die Tyrannei der Habsburger in ihrer Freiheit beschnitten werden, schließen sich Uri, Schwyz und Unterwalden zum Eidgenössischen Bund zusammen. Bei Nacht und Nebel schwören sie, sich im Kampf gegen die Tyrannen (Vögte) beizustehen. Tell beteiligt sich nicht an diesem Schwur, wird aber indirekt zum Auslöser für den Beginn der Schweizer Befreiungskämpfe. Als er dem am Marktplatz aufgestellten Hut, ein Symbol für die Macht der Vögte, nicht den nötigen Respekt erweist, wird er kurzerhand gefangen genommen. Der niederträchtige Landvogt Gessler zwingt Tell, einen Apfel vom Kopf seines Kindes zu schießen, andernfalls würde er den Jungen töten. Dem Schützen bleibt keine Wahl. Er nimmt zwei Pfeile, zielt mit einem auf die Frucht und schießt. Der Schuss gelingt, die beiden werden frei gelassen. Als Tell jedoch auf Gesslers Frage, was er denn mit dem zweiten Pfeil vor gehabt hätte, antwortet, er hätte den tyrannischen Vogt im Falle des Misslingens erschossen, wird er erneut gefesselt und auf Gesslers Schiff gebracht. Auf dem See kommt jedoch ein Sturm auf, Tell steuert das Boot durch das Unwetter und flüchtet an einer geeigneten Stelle von Bord. Daraufhin macht er sich auf dem Weg nach Küssnacht, wo er Gessler schließlich in der Hohlen Gasse aus dem Hinterhalt mit dem besagten zweiten Pfeil erschießt. Die Eidgenossen erobern - inspiriert durch Tells Mut - in der Folge zahlreiche Burgen, bis sie die Habsburger aus ihrem Land vertrieben haben.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die Tell-Legende
- Die Bedeutung des Namens „Wilhelm Tell“
- Die Entstehung des Mythos vom heldenhaften Bogenschützen
- Saxo Grammaticus: Gesta Danorum“ bzw. „Historia Danorum Regum Heroumque”
- Die Legende von Egil
- Olaf II. Haraldsson
- Der griechische Sarpedon
- Der englische William of Cloudesly
- Resümee:
- Die Quellen der Tell-Legende
- Früheste Erscheinungen (ab 15. Jahrhundert)
- „Das Weiße Buch“ von Sarnen (~1470)
- Das „Alte Tellenlied “/„Das Lied von der Entstehung der Eidgenossenschaft“ (1477)
- Chronik von Melchior Russ von Luzern (1482)
- Das Urner Tellenspiel (1511/ 1512)
- Ägidius Tschudi: „Chronicon Helveticum“ (16. Jahrhundert)
- Das „Entlebuecher Tellenlied“ (1653)
- Johannes von Müller: „Geschichte schweizerischer Eidgenossenschaft“ (1786/1787)
- Schillers „Wilhelm Tell“
- Die Haupthandlungen
- Das Individuum „Tell“
- Das Bündniskollektiv
- Die Bedeutung der Kernsszene
- Das Symbol „Apfel“
- Der „punctum saliens“
- Resümee:
- Der einheimische Adel
- Die Haupthandlungen
- Intertextuelle Bezüge
- Die Geschichte der Schweiz - Die Entstehung der Eidgenossenschaft
- Die politische Situation ab dem 11. Jahrhundert
- Der Bundesbrief 1291 und seine Verarbeitung im „Tell“
- Die Französische Revolution
- Der Verlauf der Französischen Revolution
- Schillers Haltung gegenüber der Revolution
- Der symbolträchtige „Hut“
- Schillers „Tell“ im 19. Jahrhundert
- Die Geschichte der Schweiz - Die Entstehung der Eidgenossenschaft
- Weitere intertextuelle Bezüge:
- Der Bezug zur Bibel
- Rousseaus Gesellschaftsvertrag
- Wiederentdeckung „Tells“ für den Nationalsozialismus
- Die Unterzeichnung des Staatsvertrages
- Geographische Gegebenheiten der Schweiz und ihr Andenken bis heute
- Die Teufelsbrücke und der Teufelsstein
- Die Rütliwiese
- Tell-Denkmäler
- Beispiele für weitere Verarbeitungen der Tellsage
- Tell in der Musik
- Tell und Literatur
- Amüsante Verarbeitungen
- Die Tellskapelle
- Traditionelles Rütlischießen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Legende von Wilhelm Tell und deren intertextuelle Bezüge. Ziel ist es, die historische Realität hinter dem Mythos zu beleuchten und die Bedeutung Tells für die Schweizer Geschichte und nationale Identität zu ergründen. Die Arbeit analysiert Schillers „Wilhelm Tell“ im Kontext seiner Entstehungszeit und im Hinblick auf seine literarischen Vorläufer und späteren Rezeptionen.
- Die Entstehung und Entwicklung der Tell-Legende
- Die Analyse der Quellen und ihrer Interpretationen
- Die Darstellung Tells in Schillers Drama und dessen literarische Strategien
- Intertextuelle Bezüge zu historischen Ereignissen (z.B. Entstehung der Eidgenossenschaft, Französische Revolution)
- Die Rezeption der Tell-Legende in verschiedenen Epochen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Tell-Legende: Die Legende schildert Wilhelm Tell als ehrenwerten Schweizer, der durch seinen Widerstand gegen die Habsburger zur Symbolfigur der Schweizer Unabhängigkeit wird. Sein Apfel-Szenario und die Ermordung Gesslers werden als entscheidende Momente der Befreiung dargestellt, die den Eidgenössischen Bund inspiriert. Die Zusammenfassung präsentiert den Mythus als eine vereinfachte Darstellung historischer Konflikte.
Die Bedeutung des Namens „Wilhelm Tell“: Die Namensdeutung analysiert verschiedene etymologische Ansätze. Der Name „Wilhelm“ deutet auf „Wille“ und „Schutz“ hin, während „Tell“ sowohl mit „Wurfgeschoss“ als auch mit Begriffen wie „Schlucht“ oder „kindisches Benehmen“ in Verbindung gebracht wird. Die Vieldeutigkeit des Namens wirft Fragen nach der historischen Realität der Figur auf und legt nahe, dass der Name symbolische Bedeutung trägt.
Die Entstehung des Mythos vom heldenhaften Bogenschützen: Dieses Kapitel vergleicht die Tell-Legende mit ähnlichen Geschichten aus anderen Kulturen und Zeiten, wie der Geschichte von Egil, Olaf Haraldsson oder William of Cloudesly. Es zeigt Parallelen in den Handlungsstrukturen und hebt die überzeitliche Attraktivität des Bogenschützen-Motivs hervor, das sich in verschiedenen kulturellen Kontexten entwickelt hat. Die Untersuchung legt nahe, dass die Tell-Legende aus einer Verschmelzung verschiedener Erzähltraditionen hervorgegangen ist.
Die Quellen der Tell-Legende: Hier werden verschiedene historische Quellen zur Tell-Legende analysiert, von frühen Erwähnungen im 15. Jahrhundert bis hin zu den Werken von Tschudi und Müller. Die Arbeit zeigt, wie die Geschichte im Laufe der Zeit verändert und interpretiert wurde, um die Schweizer nationale Identität zu konstruieren. Die verschiedenen Versionen der Legende spiegeln unterschiedliche politische und soziale Interessen wider.
Schillers „Wilhelm Tell“: Dieser Abschnitt befasst sich mit Schillers dramatischer Bearbeitung der Tell-Legende. Er analysiert die Hauptfiguren, die Handlungsstruktur, und die symbolische Bedeutung wichtiger Szenen. Das Kapitel hebt die Bedeutung des Apfel-Motivs, des „punctum saliens“, und der Konfrontation zwischen Individuum und kollektiver Identität hervor und zeigt wie Schiller die Legende neu gestaltet um seine politischen Botschaften zu vermitteln.
Intertextuelle Bezüge: Der Abschnitt untersucht die Verbindungen zwischen Schillers „Wilhelm Tell“ und historischen Ereignissen wie der Entstehung der Eidgenossenschaft und der Französischen Revolution. Es wird analysiert, wie Schiller historische Fakten und politische Ideale in seinem Drama verarbeitet. Das Kapitel erläutert wie der “Hut” symbolisch aufgeladen ist und die politische Lage in der Schweiz widerspiegelt.
Schlüsselwörter
Wilhelm Tell, Tell-Legende, Schillers Wilhelm Tell, Schweizer Geschichte, Eidgenossenschaft, Habsburger, Nationalmythos, Intertextualität, Französische Revolution, Symbol, Apfel, Bogenschütze, historische Quellen, nationale Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassung der Kapitel, Schlüsselwörter"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Legende von Wilhelm Tell und deren intertextuelle Bezüge. Ziel ist es, die historische Realität hinter dem Mythos zu beleuchten und die Bedeutung Tells für die Schweizer Geschichte und nationale Identität zu ergründen. Die Arbeit analysiert Schillers „Wilhelm Tell“ im Kontext seiner Entstehungszeit und im Hinblick auf seine literarischen Vorläufer und späteren Rezeptionen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und Entwicklung der Tell-Legende, die Analyse der Quellen und ihrer Interpretationen, die Darstellung Tells in Schillers Drama und dessen literarische Strategien, intertextuelle Bezüge zu historischen Ereignissen (z.B. Entstehung der Eidgenossenschaft, Französische Revolution) und die Rezeption der Tell-Legende in verschiedenen Epochen.
Welche Quellen werden zur Analyse der Tell-Legende herangezogen?
Die Arbeit analysiert verschiedene historische Quellen, von frühen Erwähnungen im 15. Jahrhundert (z.B. "Das Weiße Buch" von Sarnen, "Das Alte Tellenlied") bis hin zu den Werken von Tschudi und Müller. Es werden auch Parallelen zu anderen Sagenfiguren wie Egil, Olaf Haraldsson oder William of Cloudesly gezogen.
Wie wird Schillers „Wilhelm Tell“ in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert Schillers dramatische Bearbeitung der Tell-Legende, die Hauptfiguren, die Handlungsstruktur und die symbolische Bedeutung wichtiger Szenen (z.B. das Apfel-Motiv, das „punctum saliens“). Es wird gezeigt, wie Schiller die Legende neu gestaltet, um seine politischen Botschaften zu vermitteln.
Welche intertextuellen Bezüge werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Verbindungen zwischen Schillers „Wilhelm Tell“ und historischen Ereignissen wie der Entstehung der Eidgenossenschaft und der Französischen Revolution. Es wird analysiert, wie Schiller historische Fakten und politische Ideale in seinem Drama verarbeitet. Der symbolische "Hut" und seine Bedeutung werden ebenfalls beleuchtet.
Welche weiteren intertextuellen Bezüge werden erwähnt?
Zusätzlich zu den genannten Bezügen werden Verbindungen zur Bibel, Rousseaus Gesellschaftsvertrag, die Rezeption der Tell-Legende im Nationalsozialismus, die geographischen Gegebenheiten der Schweiz (Teufelsbrücke, Rütliwiese, Tell-Denkmäler) und diverse weitere Verarbeitungen der Tellsage in Musik, Literatur und anderen Medien behandelt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wilhelm Tell, Tell-Legende, Schillers Wilhelm Tell, Schweizer Geschichte, Eidgenossenschaft, Habsburger, Nationalmythos, Intertextualität, Französische Revolution, Symbol, Apfel, Bogenschütze, historische Quellen, nationale Identität.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Zusammenfassung der Kapitel fasst die wichtigsten Aspekte jedes Kapitels zusammen, beginnend mit der Darstellung der Tell-Legende als vereinfachte Darstellung historischer Konflikte, über die Bedeutung des Namens "Wilhelm Tell" und die Entstehung des Mythos, bis hin zur Analyse der Quellen, Schillers Drama und den intertextuellen Bezügen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Zielsetzung ist die Untersuchung der Legende von Wilhelm Tell und ihrer intertextuellen Bezüge, um die historische Realität hinter dem Mythos zu beleuchten und die Bedeutung Tells für die Schweizer Geschichte und nationale Identität zu ergründen.
- Quote paper
- Claudia Braito (Author), 2004, Friedrich Schiller "Wilhelm Tell" - Mythos oder Realität? Auf der Suche nach intertextuellen Bezügen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/57819