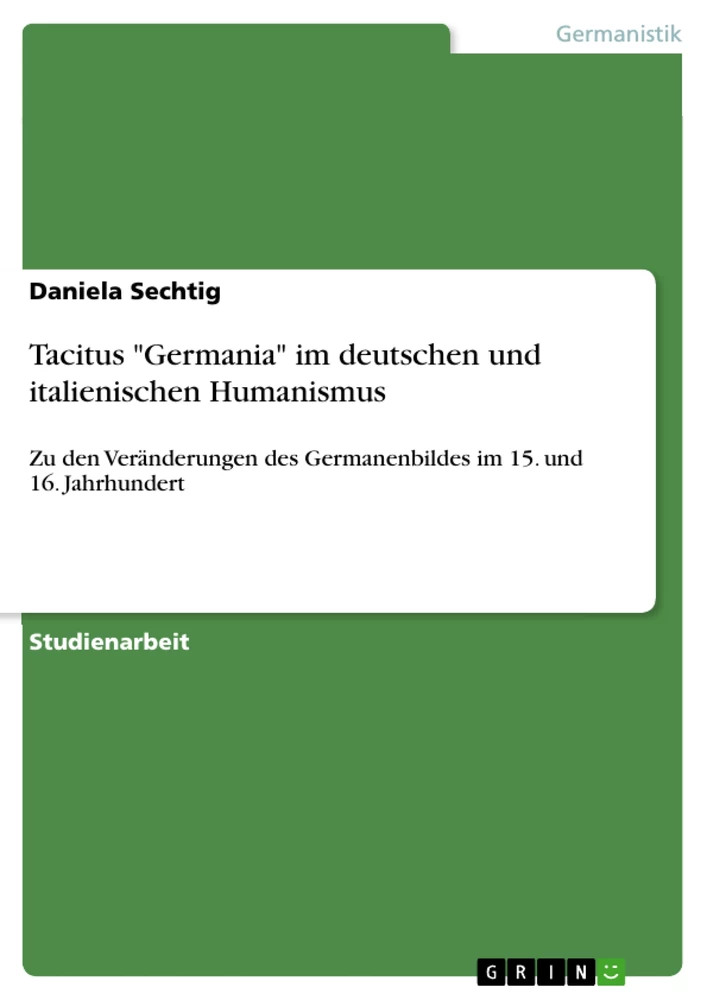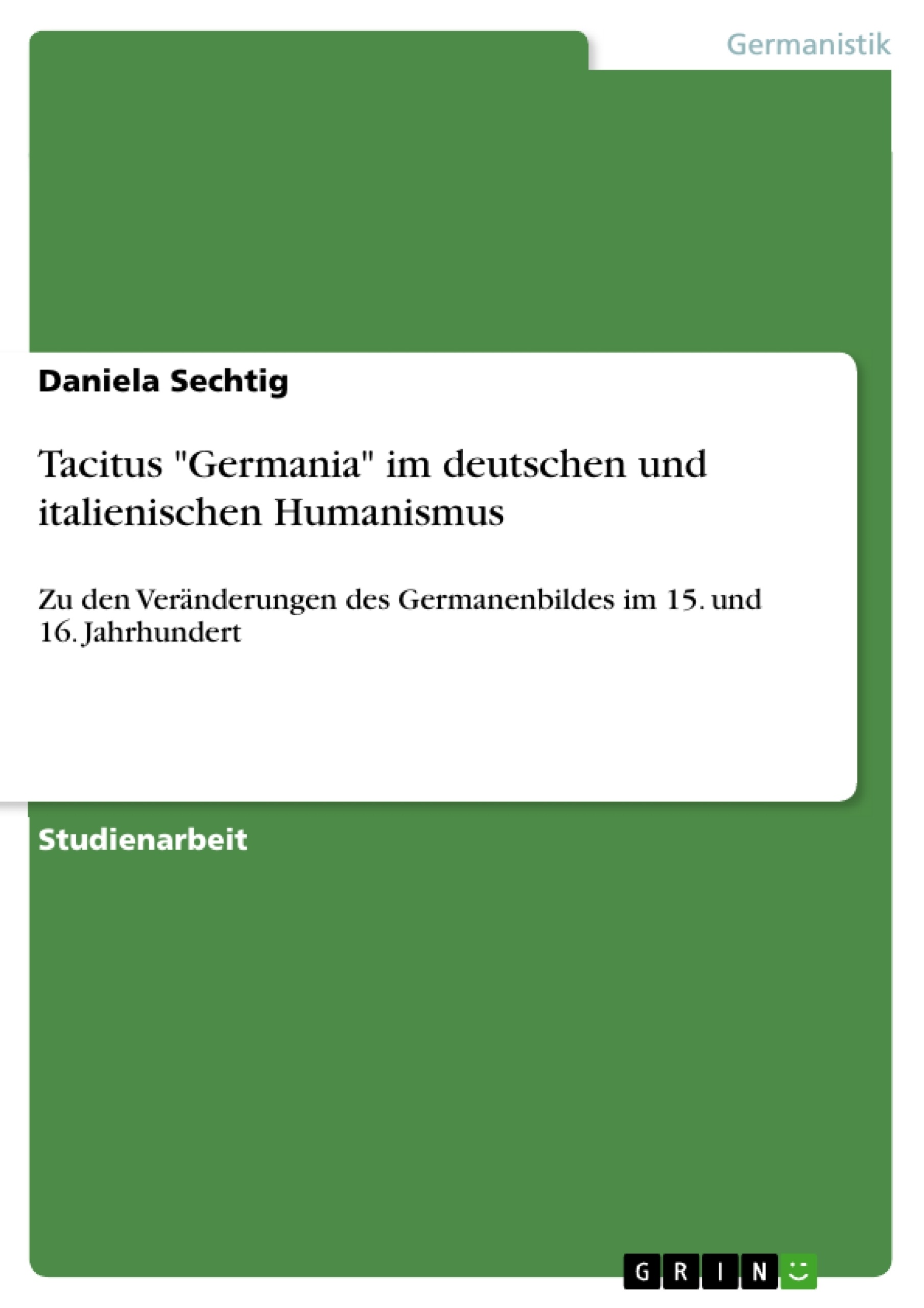„Wann der Hermann net gewäse wehr[...], dehte mer vielleicht ladeinisch schwätze." , so eine Darmstädter Lokalposse von 1841. Doch wer war dieser Hermann, woher wusste man im biedermeierlichen Deutschland von ihm und warum sollte er einen so großen Einfluss auf unsere Sprachgewohnheiten gehabt haben? Um zu einer Antwort auf diese Fragen zu kommen, muss man bis in das erste Jahrhundert unserer Zeitrechnung zurückgehen und die „Annalen“ sowie die „Germania“ des Tacitus heranziehen. Vor allem mit der kleinen Schrift über den Ursprung und Wohnsitz der Germanen verband sich im Laufe der Jahrhunderte ein Mythos , der bis in unsere Zeit lebendig geblieben ist und der immer wieder mit den verschiedensten Intentionen belegt wurde. Die italienischen und deutschen Humanisten der Renaissance bildeten den Anfang. Sie bemühten sich um eine neue Sichtweise der Germanen und ihrer Nachfahren, welche letztlich weitreichende Folgen hatte.
Der Gegenstand der vorliegenden Arbeit soll daher die Rezeption der Schrift „De origine et situ germanorum" des römischen Historikers Cornelius Tacitus im europäischen Humanismus des 15. und 16. Jahrhunderts sein. Die Zielsetzung besteht darin herauszufinden, ob und inwieweit das von Tacitus entworfene Germanenbild und dessen Intention durch die Humanisten einem Wandel unterlag. Dazu werde ich als erstes Tacitus und die „Germania“ vorstellen und die Intention seines Germanenbildes herausarbeiten. Im Folgenden soll die Wiederentdeckung des Werkes im 15. Jahrhundert und dessen Rezeption durch die italienischen Humanisten dargestellt werden. Daraufhin wird untersucht, welche Aufnahme die „Germania“ im deutschen Humanismus erfuhr und welche Auswirkungen der Germanenmythos seinerzeit hatte. Im Fazit wird das Ergebnis dieser Arbeit zusammengefasst dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Das Germanenbild in Tacitus` „Germania“
- 1.1. Tacitus: Biographie und Inhalt der „Germania“
- 1.2. Das Germanenbild des Tacitus und seine Intention
- 2. Die „Germania“ im italienischen Humanismus
- 2.1. Die Wiederentdeckung der „Germania“ im 15. Jahrhundert
- 2.2. Das Germanenbild der italienischen Humanisten und ihre Intention
- 3. Die „Germania“ im deutschen Humanismus
- 3.1. Der deutsche Humanismus vor der Wiederentdeckung der „Germania“
- 3.2. Das Germanenbild von Konrad Celtis und seine Intention
- 3.3. Das Germanenbild von Ulrich von Hutten und seine Intention
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rezeption von Tacitus' „Germania“ im europäischen Humanismus des 15. und 16. Jahrhunderts. Ziel ist es, den Wandel des Tacitus'schen Germanenbildes und dessen Intention durch die Humanisten zu analysieren.
- Die Darstellung des Germanenbildes bei Tacitus und dessen Intention.
- Die Wiederentdeckung der „Germania“ im 15. Jahrhundert und deren Rezeption durch italienische Humanisten.
- Die Rezeption der „Germania“ im deutschen Humanismus und die Auswirkungen des Germanenmythos.
- Der Vergleich der Interpretationen des Germanenbildes zwischen italienischen und deutschen Humanisten.
- Die Entwicklung des Germanenbildes im Laufe der Zeit und dessen Einfluss auf die nationale Identität.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Fragestellung nach der Veränderung des Germanenbildes im 15. und 16. Jahrhundert durch die Rezeption von Tacitus' „Germania“ im italienischen und deutschen Humanismus vor. Sie begründet die Relevanz der Untersuchung und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Bezug auf eine Darmstädter Lokalposse dient als eingängiger Einstieg, der die langfristige Wirkung des Tacitus'schen Germanenbildes verdeutlicht.
1. Das Germanenbild in Tacitus` „Germania“: Dieses Kapitel präsentiert zunächst eine kurze Biographie von Tacitus, beleuchtet seine politischen Aktivitäten und seinen schriftstellerischen Werdegang. Es wird detailliert auf den Inhalt der „Germania“ eingegangen, wobei die Struktur der Schrift, die Beschreibung des germanischen Lebensraums, der germanischen Gesellschaft und Kultur sowie der politischen und militärischen Organisation der Germanen erläutert werden. Die Analyse fokussiert auf Tacitus' Intention, wobei die Darstellung als ethnographische Studie mit potenziellen politischen Untertönen hervorgehoben wird. Die Abwesenheit einer klaren Einleitung und die direkte Darstellung des Ursprungs und der geographischen Lage der Germanen werden ebenfalls berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Tacitus, Germania, Humanismus, Italienischer Humanismus, Deutscher Humanismus, Germanenbild, Konrad Celtis, Ulrich von Hutten, Renaissance, Mythos, Rezeption, Intention, Ethnographie, Geschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Rezeption von Tacitus' „Germania“ im europäischen Humanismus
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rezeption von Tacitus' „Germania“ im italienischen und deutschen Humanismus des 15. und 16. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht die Analyse des Wandels des Tacitus'schen Germanenbildes und der Intentionen der Humanisten bei der Interpretation dieses Bildes.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Darstellung des Germanenbildes bei Tacitus und dessen Intention, die Wiederentdeckung der „Germania“ im 15. Jahrhundert und deren Rezeption durch italienische Humanisten, die Rezeption der „Germania“ im deutschen Humanismus und die Auswirkungen des Germanenmythos, einen Vergleich der Interpretationen des Germanenbildes zwischen italienischen und deutschen Humanisten sowie die Entwicklung des Germanenbildes im Laufe der Zeit und dessen Einfluss auf die nationale Identität.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über das Germanenbild in Tacitus' „Germania“, ein Kapitel über die Rezeption der „Germania“ im italienischen Humanismus, ein Kapitel über die Rezeption im deutschen Humanismus (mit Fokus auf Konrad Celtis und Ulrich von Hutten) und ein Fazit.
Wer wird in der Arbeit genauer untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des Germanenbildes bei Tacitus selbst und dessen Interpretation durch italienische und deutsche Humanisten des 15. und 16. Jahrhunderts. Besonderes Augenmerk liegt auf Konrad Celtis und Ulrich von Hutten im Kontext des deutschen Humanismus.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Hauptquelle ist Tacitus' „Germania“. Die Arbeit analysiert dessen Inhalt und die verschiedenen Interpretationen dieses Werkes durch die Humanisten. Weitere Quellen sind die Schriften der italienischen und deutschen Humanisten, die sich mit Tacitus und dem Germanenbild auseinandergesetzt haben.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, den Wandel des Germanenbildes im Laufe der Rezeption von Tacitus' „Germania“ im europäischen Humanismus aufzuzeigen und die Intentionen der verschiedenen Interpreten zu analysieren. Es geht um die Verfolgung der Entwicklung des Germanenbildes und dessen Bedeutung für die nationale Identität.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Tacitus, Germania, Humanismus, Italienischer Humanismus, Deutscher Humanismus, Germanenbild, Konrad Celtis, Ulrich von Hutten, Renaissance, Mythos, Rezeption, Intention, Ethnographie, Geschichte.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik und die Forschungsfrage einführt. Es folgen Kapitel, die jeweils einen Aspekt der Rezeption der „Germania“ behandeln. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das die Ergebnisse zusammenfasst.
Wie wird Tacitus' „Germania“ in der Arbeit dargestellt?
Die Arbeit präsentiert zunächst eine kurze Biographie von Tacitus und einen detaillierten Überblick über den Inhalt der „Germania“, einschließlich der Beschreibung des germanischen Lebensraums, der Gesellschaft, Kultur, politischen und militärischen Organisation. Die Analyse fokussiert auf Tacitus' mögliche Intention und den Charakter der Schrift als ethnographische Studie mit potenziellen politischen Untertönen.
- Quote paper
- Daniela Sechtig (Author), 2003, Tacitus "Germania" im deutschen und italienischen Humanismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/57815