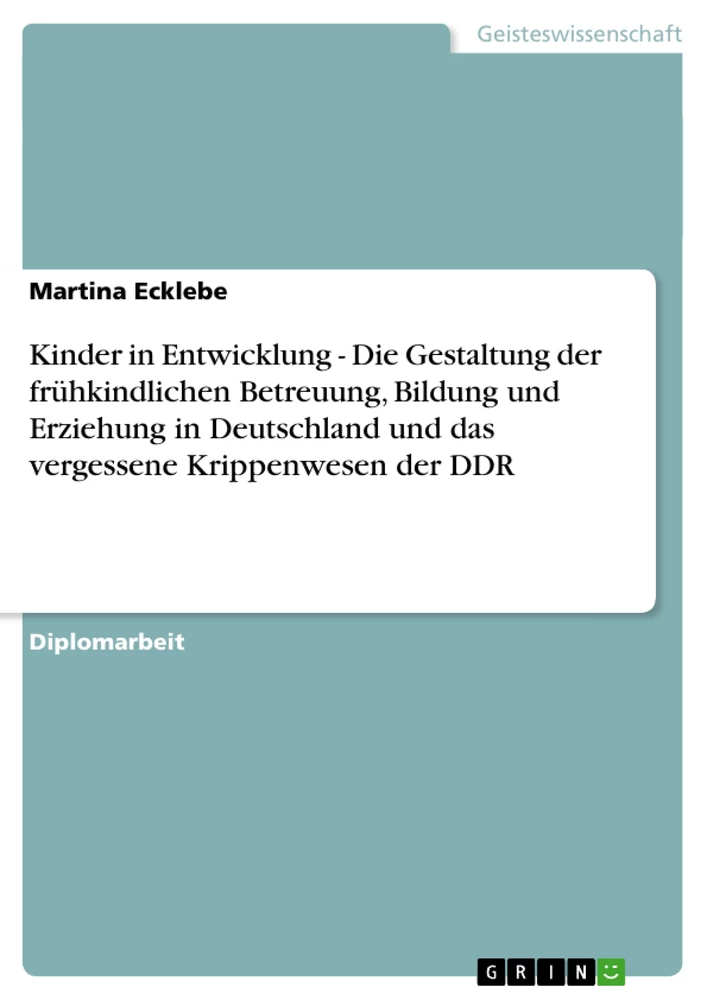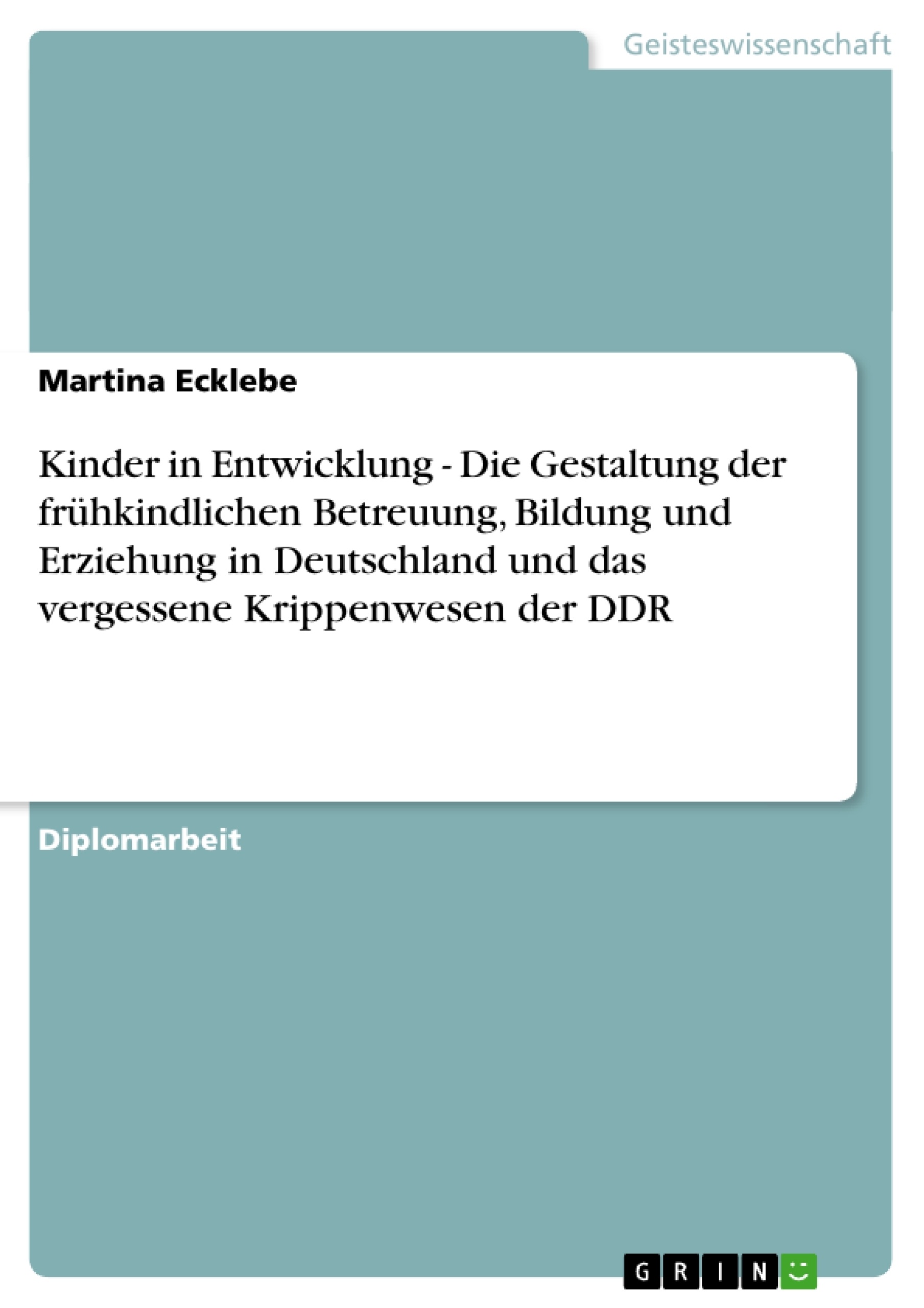1.1 Einleitung
Die ersten drei Lebensjahre sind eine sehr wichtige Zeit f¨ur die Entwicklung eines Kindes. In Hinsicht auf die körperliche, emotionale, soziale und kulturelle Entwicklung ist diese Zeit von großer Bedeutung. Sie betrifft gerade auch die Eltern, die Einrichtungen und die ganze umgebene Umwelt in der sich ein Kind befindet, denn sie haben entscheidenden Einfluss darauf, positiven im Sinne von fördernd oder auch negativen. Diese Zeit ist aber auch in einer anderen Hinsicht relevant geworden, denn die institutionelle Kinderbetreuung
in Deutschland ist dabei sich zu verändern. Immer lauter wurden seit Anfang des Jahrhunderts die Rufe nach Reformen im Elementarbereich. Der vorschulische Bereich rückte erstmals mit dem Schock der Ergebnisse der ersten PISA-Erhebung(1) im Dezember
2001, in das öffentliche Bewusstsein. Auf der Suche nach Gründen für das schlechte Abschneiden der Sch¨uler im Sekundarbereich I wandte man seinen Blick den lange vernachlässigten Krippen- und Kindergartenkindern zu. Denn die Grundlagen für gute oder schlechte Schulleistungen werden schon vor dem Schuleintritt gelegt. In diesem Sinn wurden nun auch die Null- bis Sechsjährigen stärker als Leistungsträger erkannt. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen demografischen Entwicklungen wurden sie als ’knapp
gewordene Ressource’ begriffen, deren Bildungschancen nach Ergebnissen der Hirnforschung, besonders im Kleinkindalter enorm sind, und nicht einfach verstreichen dürfen.
Infolgedessen bezog sich die Kritik unisono auf zu wenig qualitativ akzeptable Bildungsarbeit in den Kindertageseinrichtungen. Im Mittelpunkt der aktuellen Diskussion stehen demnach auch die Forderungen nach dem Ausbau von Ganztagsbetreuungsmöglichkeiten
und der Verbesserung der Bildungsqualität, gerade auch für die unter Dreijährigen. Im Westen Deutschlands lange verpönt und misstrauisch beäugt, erscheint die Betreuung von Kindern im Krippenalter außerhalb der Familie inzwischen in einem anderen Licht.
[...]
______
(1) Program for International Student Assessment (PISA) ist ein Programm zur regelm¨aßigen Erfassung
von Basiskompetenzen von Sch¨ulern im internationalen Vergleich.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Bemerkungen
- Einleitung
- Aufbau der Arbeit
- Sprachgebrauch und Terminologie
- Frühkindliche Entwicklung und Kinderkrippen
- Entwicklungstheorie und Förderungsbegriff
- Auswirkungen der Krippe
- Das Krippenwesen der DDR
- Die Krippen in der DDR
- Rahmenbedingungen
- Personelle Voraussetzungen
- Materielle Voraussetzungen
- Gesundheit und Hygiene
- Forschung
- Inhalte der Erziehungsarbeit
- Wende-Entwicklung
- Die Grundlagen des deutschen Systems
- Der nationale Kontext
- Demografischer, ökonomischer und sozialer Kontext
- Subsidarität und Förderalismus
- Gesetze, Rahmenbedingungen und aktuelle Entwicklungen
- SGB VIII
- Kita-Gesetze
- Quantitativer Ausbau und das TAG
- Qualitativer Ausbau
- Qualität in FBBE-Einrichtungen
- Bildungspläne der Länder
- Finanzierung
- Aktuelle Situation in Deutschland
- Situation der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung
- Die Versorgungslage
- Unterschiede Ost und West
- Gesellschaftlicher Kontext und Strukurbedingungen in West-deutschland vor der Wiedervereinigung
- Unterschiede bei Inanspruchnahme und Versorgungslage
- Die Beschäftigten
- Sozialstruktur, Frauenerwerbstätigkeit, Geburtenentwicklung und Kinderbetreuung
- Kindliche Lebenswelten
- Veränderte Bedingungen des Aufwachsens
- Ressource Gesundheit
- Frühkindliche Bildung
- Relevanz der DDR-Erfahrungen
- Annäherung der beiden deutschen Staaten
- Zentralisierung, Standards und Vereinheitlichung
- Qualifizierung der Fachkräfte
- Gesundheit und Hygiene
- Elternhaus und Krippe
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Gestaltung der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung in Deutschland, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland gelegt wird. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Krippenwesens in der DDR und untersucht die Relevanz der DDR-Erfahrungen für das heutige deutsche System.
- Entwicklung des Krippenwesens in der DDR
- Relevanz der DDR-Erfahrungen für das deutsche System
- Unterschiede in der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung zwischen Ost- und Westdeutschland
- Gesundheit und Hygiene in der frühkindlichen Betreuung
- Qualifikation der Fachkräfte in der frühkindlichen Betreuung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Aufbau der Arbeit und den Sprachgebrauch erklärt. Kapitel 2 befasst sich mit der frühkindlichen Entwicklung und den Auswirkungen der Krippe auf diese. Kapitel 3 beleuchtet das Krippenwesen der DDR, inklusive der Rahmenbedingungen und der Forschungsergebnisse. Kapitel 4 analysiert die Grundlagen des deutschen Systems, einschließlich der Gesetze, Rahmenbedingungen und der aktuellen Entwicklungen. Kapitel 5 beschäftigt sich mit der aktuellen Situation in Deutschland, wobei die Versorgungslage, die Beschäftigten und die veränderten Bedingungen des Aufwachsens im Vordergrund stehen. Kapitel 6 schließlich widmet sich der Relevanz der DDR-Erfahrungen für das deutsche System, unter anderem im Hinblick auf die Annäherung der beiden deutschen Staaten, die Zentralisierung und die Qualifizierung der Fachkräfte.
Schlüsselwörter
Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung, Krippenwesen, DDR, Deutschland, Vergleich, Ost-West, Rahmenbedingungen, Entwicklung, Forschung, Qualität, Finanzierung, Versorgungslage, Fachkräfte, Gesundheit, Hygiene, Elternhaus, Annäherung, Zentralisierung, Standards, Qualifizierung
- Quote paper
- Martina Ecklebe (Author), 2006, Kinder in Entwicklung - Die Gestaltung der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung in Deutschland und das vergessene Krippenwesen der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/57405