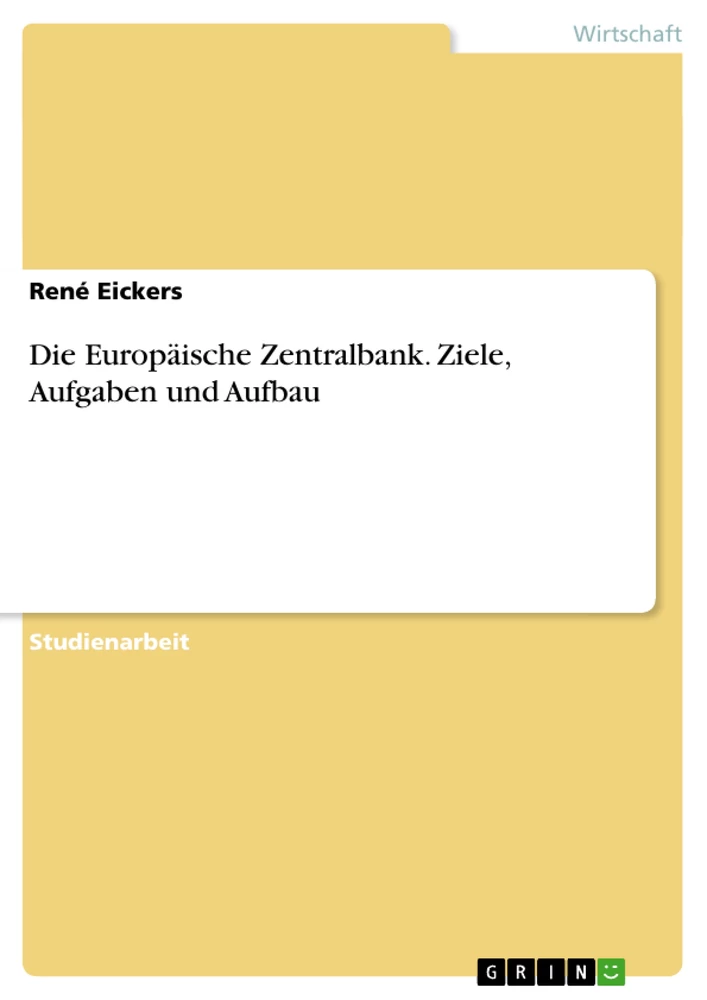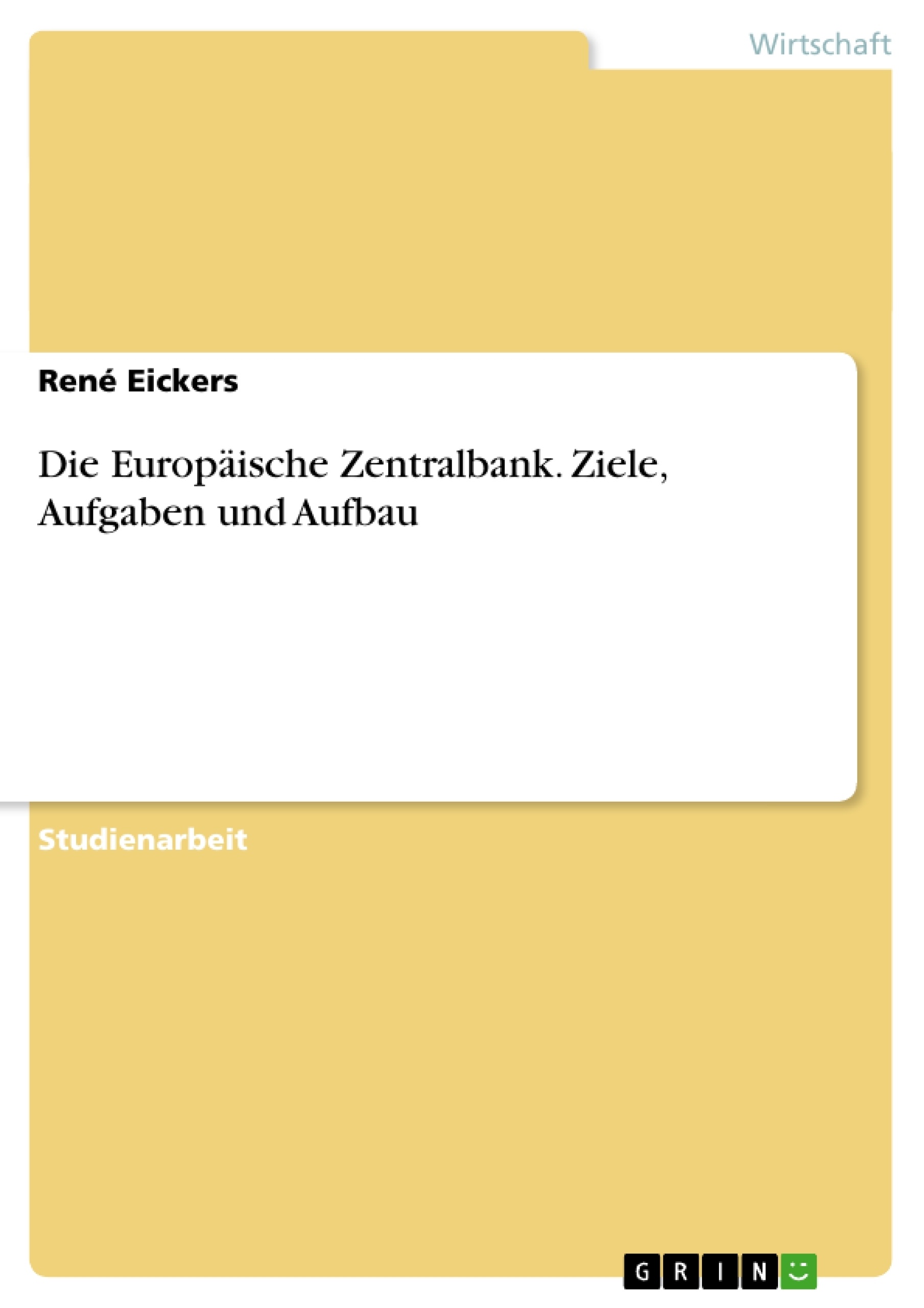Mit der Währungsunion wurde nicht nur eine neue Währung aus der Taufe gehoben, sondern es entstand auch eine neue Zentralbank, die Europäische Zentralbank (EZB).
Die EZB und die Zentralbanken der Länder, die den Euro eingeführt haben, bilden das Eurosystem. Da noch nicht alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union den Euro eingeführt haben, ist zwischen dem Eurosystem, dem 12 Länder angehören, und dem Europäischen System der Zentralbanken (ESZB), dem 15 Länder angehören, zu unterscheiden.
Am 1. Januar 1999 hat die EZB in Frankfurt am Main ihre Arbeit aufgenommen. Sie ist die Notenbank der Währungsunion und für die Geldpolitik im Euroland verantwortlich.
Die Deutsche Bundesbank und die nationalen Notenbanken der anderen Teilnehmerländer sind durch die EZB nicht etwa überflüssig geworden, sie sind vielmehr in das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) integriert. Die EZB trifft die Entscheidungen zur Geldpolitik, die die nationalen Notenbanken auf Weisung der EZB in den jeweiligen Ländern umsetzen.
Die Arbeit gliedert sich dabei so auf, dass zunächst der institutionelle Rahmen der EZB sowie dessen rechtliche Stellung aufgezeigt wird. Neben den bestehenden Organen werden auch die Ziele, die Aufgaben sowie die Befugnisse der EZB erläutert. Weiter wird auf die Geldpolitik der EZB eingegangen, indem die Strategie sowie dessen Instrumentatrium näher erklärt werden. Eine Schlussbetrachtung beendet diese Hausarbeit.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der institutionelle Rahmen
- 2.1. Die Rechtstellung
- 2.2. Die Rechtsinstrumente
- 3. Die Organe
- 3.1. Das Direktorium
- 3.2. Der EZB-Rat
- 3.3. Der Erweiterte Rat
- 4. Das Kapital
- 5. Die Ziele, die Aufgaben und die Befugnisse
- 6. Die geldpolitische Strategie
- 7. Das geldpolitische Instrumentarium
- 7.1. Offenmarktgeschäfte
- 7.2. Ständige Fazilitäten
- 7.3. Mindestreserven
- 8. Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Europäischen Zentralbank (EZB) und analysiert deren institutionellen Rahmen, ihre Organe, Ziele, Aufgaben, Befugnisse sowie die geldpolitische Strategie und deren Instrumentarium. Sie beleuchtet die Rolle der EZB innerhalb des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) und zeigt die Wechselwirkung zwischen der EZB und den nationalen Notenbanken auf.
- Institutionelle Rahmenbedingungen der EZB
- Rechtliche Stellung und Organisation der EZB
- Ziele, Aufgaben und Befugnisse der EZB
- Geldpolitische Strategie und Instrumente der EZB
- Bedeutung der EZB für die Stabilität der Währungsunion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Europäische Zentralbank (EZB) als zentrale Institution der Währungsunion vor und erklärt den Unterschied zwischen dem Eurosystem und dem Europäischen System der Zentralbanken (ESZB). Kapitel 2 behandelt den institutionellen Rahmen der EZB, einschließlich ihrer Rechtstellung und der Rechtsinstrumente. In Kapitel 3 werden die Organe der EZB, das Direktorium, der EZB-Rat und der Erweiterte Rat, näher beschrieben. Kapitel 4 beleuchtet die Kapitalstruktur der EZB. Kapitel 5 erläutert die Ziele, Aufgaben und Befugnisse der EZB. Kapitel 6 widmet sich der geldpolitischen Strategie der EZB, während Kapitel 7 deren Instrumentarium, bestehend aus Offenmarktgeschäften, ständigen Fazilitäten und Mindestreserven, analysiert. Die Arbeit schließt mit einer Schlussbetrachtung.
Schlüsselwörter
Europäische Zentralbank (EZB), Eurosystem, Europäisches System der Zentralbanken (ESZB), Geldpolitik, Währungsunion, Rechtstellung, Organe, Ziele, Aufgaben, Befugnisse, geldpolitische Strategie, Instrumentarium, Offenmarktgeschäfte, ständige Fazilitäten, Mindestreserven.
- Quote paper
- René Eickers (Author), 2002, Die Europäische Zentralbank. Ziele, Aufgaben und Aufbau, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/5710