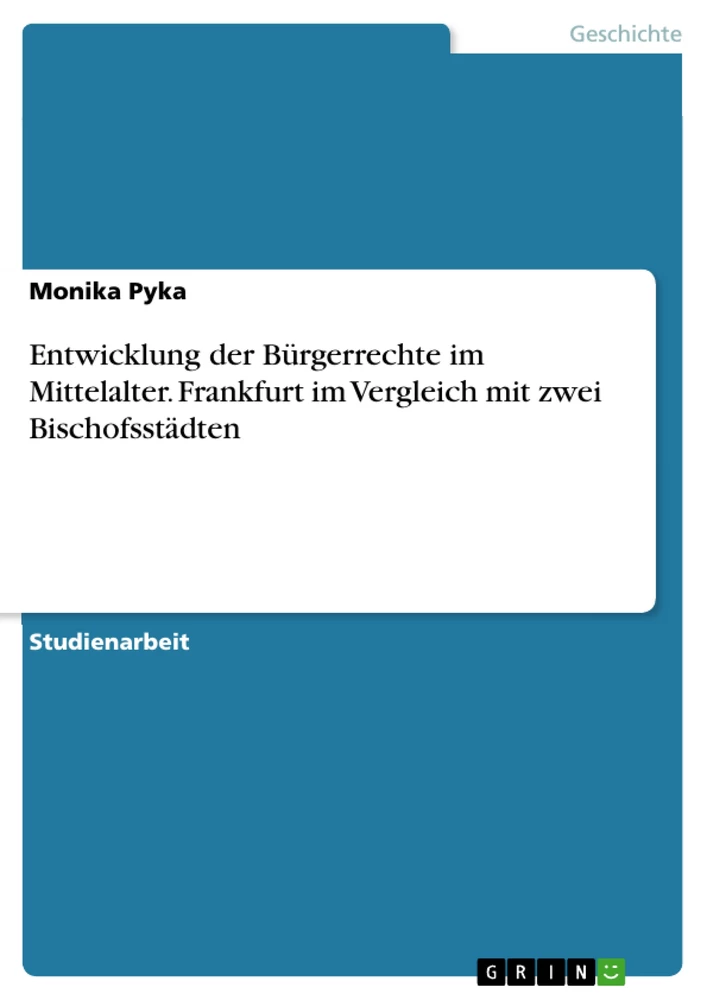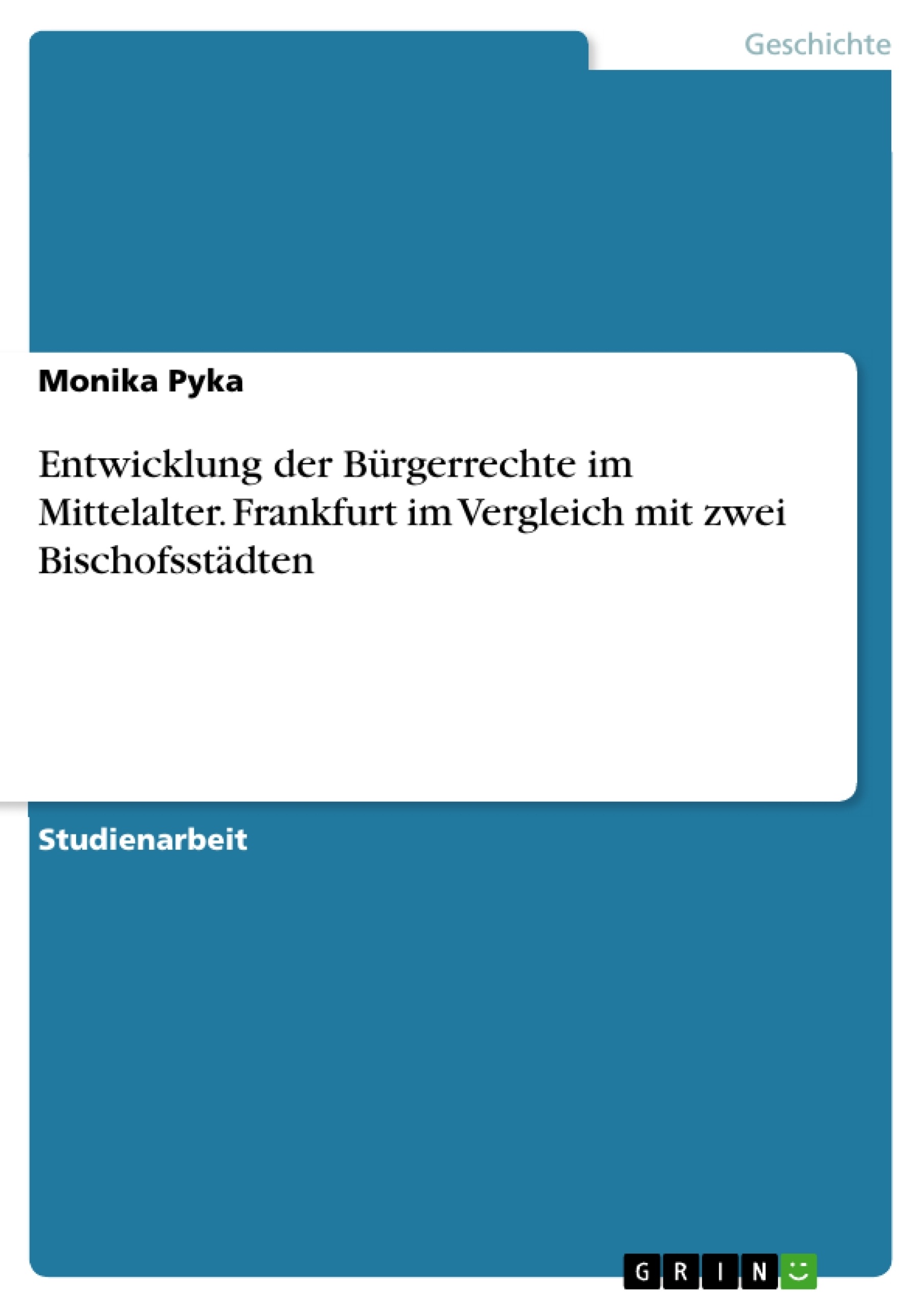Zuweilen wird der Beginn der kommunalen Selbstverwaltung, wie wir sie kennen, in der Preußischen Städteordnung von 1808 gesehen. Und obwohl sich ein Vergleich der mittelalterlichen Stadt mit der heutigen Stadt nicht unproblematisch darstellt, können dennoch bereits im Mittelalter die historischen Wurzeln dieser Entwicklung beobachtet werden. In zahlreichen Darstellungen wurde bereits herausgearbeitet, was die Motivation für den oft langen und harten Kampf der Stadtbewohner war. Das Motto „Stadtluft macht frei“ zieht sich wie ein roter Faden durch die mittelalterliche Stadtforschung, welches seinen Ausdruck schließlich im Bürgerrecht findet.
Wie aber vollzog sich diese Entwicklung hin zur allmählichen Loslösung vom Stadtherrn im Einzelnen? War ein Kämpfen und Ringen bis hin zum Morden die einzige Möglichkeit für die Stadtbewohner, ihre Rechte einzufordern? Freilich soll diese Frage nicht wie eine Alternativfrage verstanden werden, denn es darf bereits hier gesagt werden, dass jede Stadt ihre eigene Ausgangssituation hat, welche berücksichtigt werden muss. Die Antworten auf diese Fragen zu finden, ist das Anliegen der folgenden Ausführungen. Um den Bürgerbegriff und das Bürgerrecht im Mittelalter und ihre Bedeutung richtig einordnen zu können, erscheint es sinnvoll in einem ersten Schritt, diese beiden Begriffe zunächst abstrahiert und für alle Städte geltend nachzuzeichnen (vgl. Kap. 1). Im Zentrum der Arbeit sollen die Entwicklungen in Frankfurt und anderen Städten und Stadttypen stehen. Aus zwei Gründen beschränkt sich die Auswahl dabei vor allem auf zwei Bischofsstädte - Worms und Mainz. Zum einen ist es aus arbeitsökonomischen Gründen heraus notwendig, eine Auswahl zu treffen. Andererseits ist das mir zur Verfügung stehende Quellenmaterial für die anderen Städte nicht so reich wie für die Stadt Frankfurt, so dass der Blick in mindestens zwei Bischofsstädte erforderlich ist, um abschließend der Frage nachzugehen, inwiefern ein Vergleich zwischen der Reichsstadt und den Bischofsstädten möglich ist, und dabei aber nicht den Anspruch erhebt, einen absoluten Vergleich zwischen Bischofsstädten und Reichsstädten anzustellen (vgl. Kap.2).
Inhaltsverzeichnis
- Problemaufriss und Fragestellung
- Grundlagen des Bürgerbegriffs und Bürgerrechts im Mittelalter
- Der Bürgerbegriff als Rechtsbegriff
- Rechte und Pflichten der Bürger
- Unterschiedliche Entwicklungen: Frankfurt, Worms und Mainz
- Frankfurt auf dem Weg zur privilegierten Bürgergemeinde
- Das Ringen der Bischofsstädte um das Bürgerrecht
- Beispiel Worms
- Beispiel Mainz
- Versuch eines Vergleichs: Reichsstadt versus Bischofsstadt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Bürgerrechte im Mittelalter, insbesondere in Frankfurt am Main im Vergleich zu zwei Bischofsstädten, Worms und Mainz. Ziel ist es, die allmähliche Loslösung der Stadtbewohner vom Stadtherrn zu beleuchten und die unterschiedlichen Entwicklungspfade von Reichs- und Bischofsstädten zu analysieren. Die Arbeit hinterfragt dabei, ob der Kampf um Bürgerrechte immer gewaltsam geführt werden musste.
- Entwicklung des Bürgerbegriffs und Bürgerrechts im Mittelalter
- Vergleich der Entwicklung in Frankfurt am Main mit Worms und Mainz
- Unterschiede zwischen Reichs- und Bischofsstädten
- Der Einfluss der Stadtstruktur auf die Bürgerrechte
- Die Rolle des Eides und des Grundbesitzes beim Erwerb des Bürgerrechts
Zusammenfassung der Kapitel
Problemaufriss und Fragestellung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Entwicklung kommunaler Selbstverwaltung im Mittelalter und der Rolle des Bürgerrechts dar. Sie verortet die Arbeit im Kontext der mittelalterlichen Stadtforschung und betont die Notwendigkeit eines differenzierten Blicks auf die individuellen Entwicklungen in verschiedenen Städten. Der Fokus liegt auf dem Vergleich Frankfurts als Reichsstadt mit den Bischofsstädten Worms und Mainz, unter Berücksichtigung unterschiedlicher Ausgangssituationen. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die methodische Vorgehensweise, die in einer ersten Phase die abstrakten Grundlagen des Bürgerrechts beleuchtet, bevor der Vergleich verschiedener Stadttypen folgt.
Grundlagen des Bürgerbegriffs und Bürgerrechts im Mittelalter: Dieses Kapitel beleuchtet den Bürgerbegriff und das Bürgerrecht als Rechtsbegriff im Mittelalter. Es zeigt den Wandel der Abhängigkeitsverhältnisse vom 11. bis 13. Jahrhundert und die Entstehung der Städte als eigenständige Rechtsräume. Die coniuratio, die Eidesgemeinschaft, wird als zentraler Akt der Bürgerrechtsverleihung identifiziert. Der Erwerb des Bürgerrechts war an den Besitz von Grund und Boden in der Stadt gebunden, beispielsweise einem Mindestwert von 10 Mark in Frankfurt. Das Kapitel verdeutlicht den Bürgerbegriff als einen klar definierten normativen Begriff, der auf einem Rechtsakt basiert und über die Eidesleistung hinaus weitere Voraussetzungen enthielt.
Unterschiedliche Entwicklungen: Frankfurt, Worms und Mainz: Dieses Kapitel vergleicht die Entwicklung des Bürgerrechts in Frankfurt als Reichsstadt mit den Bischofsstädten Worms und Mainz. Es analysiert die jeweilige Entwicklung der Bürgergemeinde, das "Ringen" um Bürgerrechte und die spezifischen Herausforderungen in den untersuchten Städten. Der Vergleich soll die Unterschiede zwischen Reichs- und Bischofsstädten in Bezug auf die Entwicklung des Bürgerrechts beleuchten und mögliche Gemeinsamkeiten herausarbeiten, ohne einen vollständigen Vergleich aller Reichs- und Bischofsstädte anzustreben.
Schlüsselwörter
Bürgerrecht, Mittelalter, Reichsstadt, Bischofsstadt, Frankfurt am Main, Worms, Mainz, Kommunale Selbstverwaltung, Bürgerbegriff, Coniuratio, Eid, Grundbesitz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Entwicklung des Bürgerrechts im Mittelalter: Frankfurt am Main im Vergleich zu Worms und Mainz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Bürgerrechts im Mittelalter, insbesondere in Frankfurt am Main im Vergleich zu den Bischofsstädten Worms und Mainz. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der unterschiedlichen Entwicklungspfade von Reichs- und Bischofsstädten und der Frage, ob der Kampf um Bürgerrechte immer gewaltsam geführt werden musste.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Bürgerbegriffs und des Bürgerrechts im Mittelalter, einen detaillierten Vergleich der Entwicklung in Frankfurt am Main, Worms und Mainz, die Unterschiede zwischen Reichs- und Bischofsstädten, den Einfluss der Stadtstruktur auf die Bürgerrechte sowie die Rolle des Eides und des Grundbesitzes beim Erwerb des Bürgerrechts.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in einen Problemaufriss mit Forschungsfrage, die Darstellung der Grundlagen des Bürgerbegriffs und Bürgerrechts im Mittelalter, einen Vergleich der Entwicklungen in Frankfurt, Worms und Mainz und schließlich eine Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen. Die methodische Vorgehensweise beinhaltet zunächst die Klärung der abstrakten Grundlagen des Bürgerrechts, bevor ein Vergleich verschiedener Stadttypen erfolgt.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Analyse des Bürgerbegriffs im Mittelalter?
Das Kapitel zum Bürgerbegriff zeigt den Wandel der Abhängigkeitsverhältnisse vom 11. bis 13. Jahrhundert und die Entstehung der Städte als eigenständige Rechtsräume auf. Die coniuratio (Eidesgemeinschaft) wird als zentraler Akt der Bürgerrechtsverleihung identifiziert. Der Erwerb des Bürgerrechts war an den Besitz von Grund und Boden in der Stadt gebunden (z.B. ein Mindestwert von 10 Mark in Frankfurt).
Wie werden Frankfurt, Worms und Mainz verglichen?
Das Kapitel zum Vergleich analysiert die jeweilige Entwicklung der Bürgergemeinde in den drei Städten, das "Ringen" um Bürgerrechte und die spezifischen Herausforderungen. Der Vergleich soll die Unterschiede zwischen Reichs- und Bischofsstädten in Bezug auf die Entwicklung des Bürgerrechts beleuchten und mögliche Gemeinsamkeiten herausarbeiten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bürgerrecht, Mittelalter, Reichsstadt, Bischofsstadt, Frankfurt am Main, Worms, Mainz, Kommunale Selbstverwaltung, Bürgerbegriff, Coniuratio, Eid, Grundbesitz.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist die nach der Entwicklung kommunaler Selbstverwaltung im Mittelalter und der Rolle des Bürgerrechts. Die Arbeit betont die Notwendigkeit eines differenzierten Blicks auf die individuellen Entwicklungen in verschiedenen Städten.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit verwendet einen vergleichenden Ansatz, der zunächst die abstrakten Grundlagen des Bürgerrechts beleuchtet, bevor ein Vergleich verschiedener Stadttypen (Reichsstadt vs. Bischofsstadt) erfolgt. Der Fokus liegt auf der Analyse der Entwicklung in Frankfurt am Main im Vergleich zu Worms und Mainz.
- Quote paper
- Monika Pyka (Author), 2005, Entwicklung der Bürgerrechte im Mittelalter. Frankfurt im Vergleich mit zwei Bischofsstädten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/56576