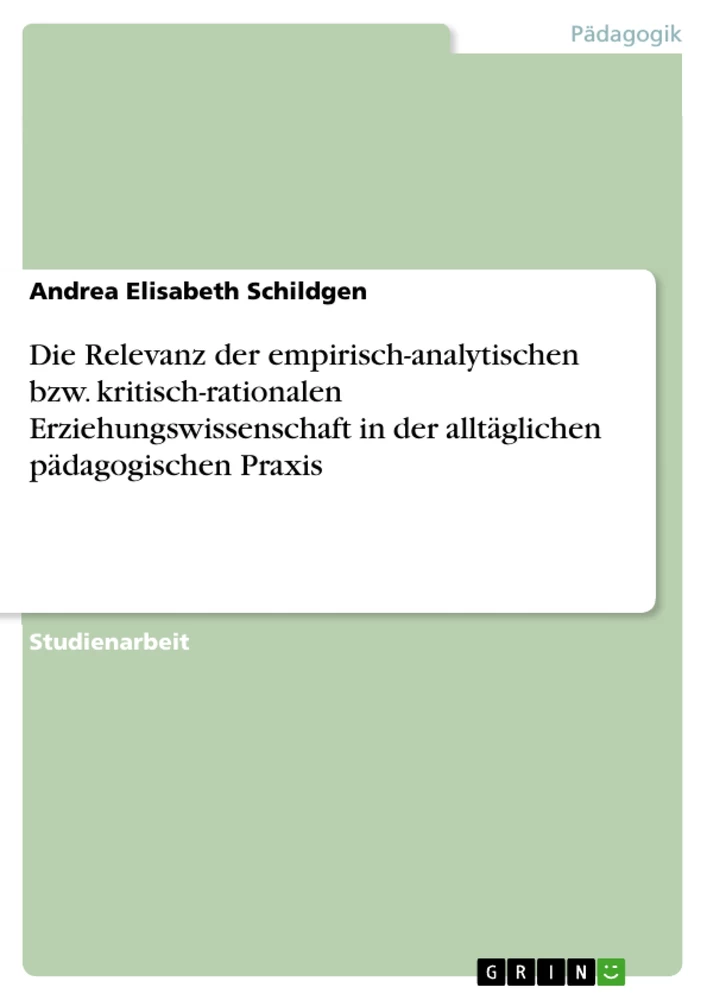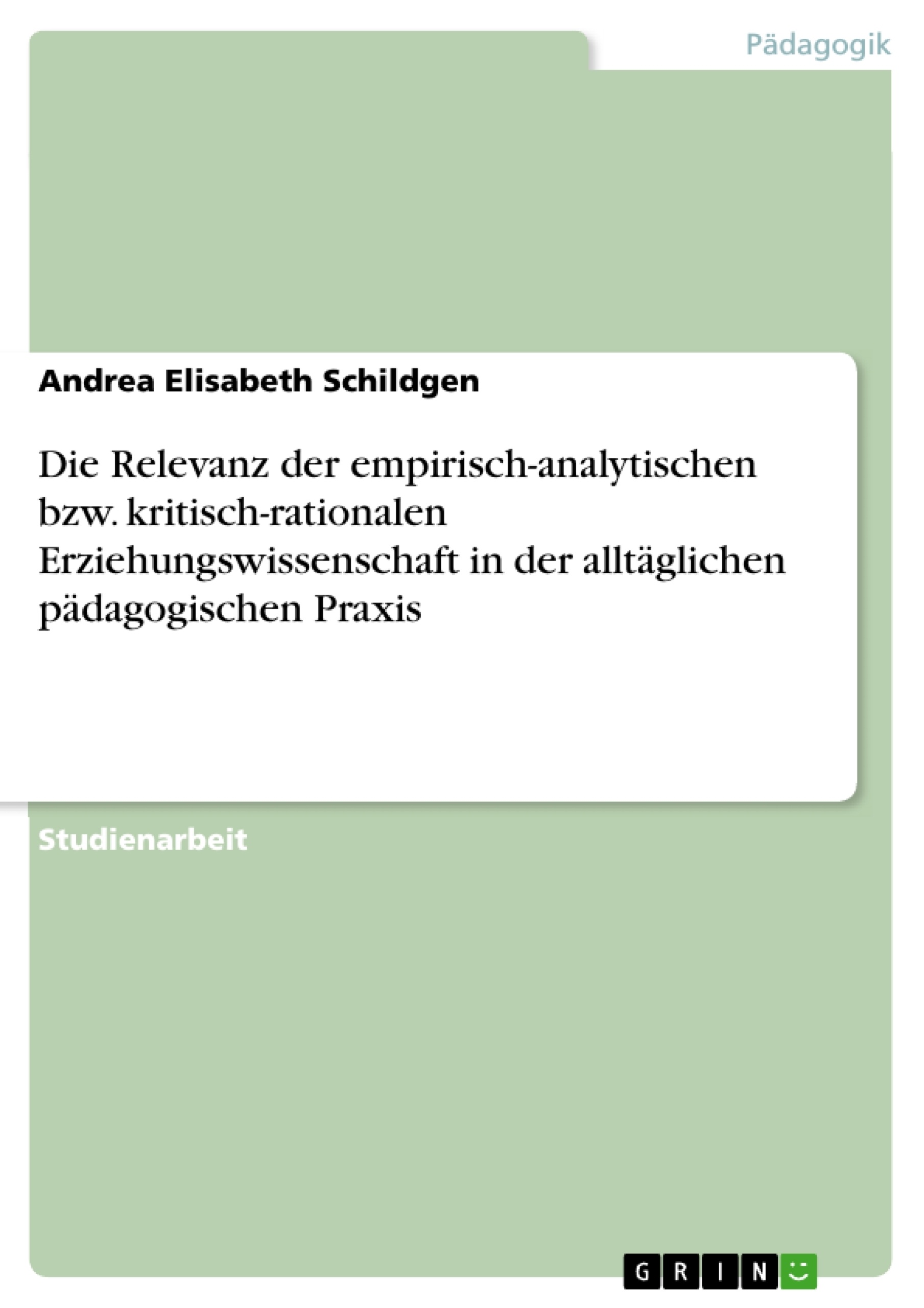Im Rahmen des Erziehungswissenschaftlichen Studiums meiner Lehramtsausbildung an der RWTH Aachen habe ich im Zeitraum vom 01. bis zum 29. März 2006 am Bischöflichen Gymnasium St. Ursula in Geilenkirchen das Orientierende Schulpraktikum (OSP) absolviert.
In Verbindung mit dem bereits im SS 2005 belegten Vorbereitungsseminar habe ich das OSP zunächst lediglich als einen obligatorischen Ausbildungsbestandteil des Grundstudiums begriffen, der in erster Linie der Berufsorientierung dienen und meine ganz persönliche Kompetenz und Eignung für eine Tätigkeit in der Lehre kontrollieren und kritisch hinterfragen sollte.
Da ich bereits vor dem Antritt meines vierwöchigen Blockpraktikums in unterschiedlichen Institutionen (Lehrkraft bei den Nachhilfeorganisationen 'Schülerförderung' und 'Schülerhilfe', Tutorin am Institut für Sprach- und Kommunikationswissenschaft der RWTH Aachen, Norwegisch- und Linguistik-Dozentin bei der VHS Heinsberg) eigenverantwortlich als Dozentin gearbeitet habe und auch zur Zeit noch in der Lehre beschäftigt bin, konnte ich meine didaktischen Vorerfahrungen in der Unterrichtspraxis gewinnbringend einsetzen und darüber hinaus noch eine Reihe von wichtigen pädagogischen und fachdidaktischen Erkenntnissen gewinnen.
Im Rahmen des OSPs konnte ich mir einen Einblick in die ganz spezielle Unterrichts- und Berufspraxis des Gymnasiallehrers verschaffen und die unterschiedlichen Berufsanforderungen dieser Arbeitswelt aus nächster Nähe kennen lernen.
Ich habe versucht, die vier Wochen meiner schulpraktischen Studien in pädagogischer und fachdidaktischer Hinsicht so optimal wie möglich zu gestalten. Vor diesem Hintergrund war ich bemüht, neben den Studien und Auswertungen zu meiner eigentlichen Beobachtungsaufgabe auch sehr schnell Assistenzaufgaben wahrzunehmen und nach Absprache mit dem jeweiligen Fachlehrer auch eigene Unterrichtsprojekte (mindestens drei Unterrichtseinheiten pro Woche) selbständig zu planen und durchzuführen. Besonders interessant war in diesem Kontext der dynamische Wechsel von der Beobachter- in die Lehrerrolle, der von den Schülern erfreulicherweise angenommen und konstruktiv begleitet worden ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Paradigmendiskussion in der Erziehungswissenschaft
- Metaproblematik
- Die verschiedenen erziehungswissenschaftlichen Positionen
- Zielsetzung der vorliegenden Hausarbeit
- Das Konzept einer kritisch-rationalen bzw. empirisch-analytischen Erziehungswissenschaft
- Das erkenntnistheoretische Modell des kritischen Rationalismus
- Historische Entwicklung der empirisch-analytischen Konzeption
- Methodologie
- Die empirisch-analytische Erziehungswissenschaft als 'technologische Wissenschaft'
- Relevanz der empirisch-analytischen Erziehungstheorie in der alltäglichen pädagogischen Praxis
- Das kausalanalytische Prinzip in der Erziehungswirklichkeit
- Kritik am technologischen Wissenschaftsverständnis der empirischen Erziehungstheorie. Das Theorie-Praxis-Verständnis: Theorie ohne Praxis?
- Das Problem der Komplexität und des Reduktionismus
- Das Induktionsproblem
- Praxisrelevanz des Falsifikationsprinzips
- Die Methoden der quantitativen Sozialforschung in der erzieherischen Praxis
- Das Postulat der Wertfreiheit in der pädagogischen Wirklichkeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Relevanz der kritisch-rationalen bzw. empirisch-analytischen Erziehungswissenschaft in der pädagogischen Praxis. Sie analysiert die erkenntnistheoretischen Grundlagen dieses Ansatzes und hinterfragt dessen Anwendbarkeit im komplexen Kontext der Erziehung. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Theorie und Praxis.
- Erkenntnistheoretische Grundlagen des kritischen Rationalismus in der Erziehungswissenschaft
- Methodologie der empirisch-analytischen Forschung in der Pädagogik
- Das Verhältnis von Theorie und Praxis im Kontext der empirischen Erziehungswissenschaft
- Kritik am technologischen Wissenschaftsverständnis in der Erziehung
- Die Bedeutung des Falsifikationsprinzips für die pädagogische Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Kontext des Seminars „Didaktische Konzeptionen in kritischer Sicht“, welches die Grundlage für die Arbeit bildet. Es wird die Bedeutung der Paradigmendiskussion in der Erziehungswissenschaft hervorgehoben, insbesondere die unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen Positionen und deren jeweilige Forschungsinteressen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Praxisrelevanz der verschiedenen Ansätze kritisch zu überprüfen und deren Ertrag und Leistungsfähigkeit im Hinblick auf die pädagogische Praxis zu evaluieren. Die historische Entwicklung der Wissenschaftsorientierungen innerhalb der Pädagogik und der "Methoden-" und "Grundlagenstreit" werden kurz angerissen.
Das Konzept einer kritisch-rationalen bzw. empirisch-analytischen Erziehungswissenschaft: Dieses Kapitel erläutert das erkenntnistheoretische Modell des kritischen Rationalismus und seine Anwendung in der Erziehungswissenschaft. Es beschreibt die historische Entwicklung der empirisch-analytischen Konzeption, die Methodologie und den Anspruch der empirisch-analytischen Erziehungswissenschaft als "technologische Wissenschaft". Das Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die spätere kritische Auseinandersetzung mit der Praxisrelevanz dieses Ansatzes.
Relevanz der empirisch-analytischen Erziehungstheorie in der alltäglichen pädagogischen Praxis: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Anwendung des kausalanalytischen Prinzips in der erzieherischen Praxis. Er analysiert kritisch das technologische Wissenschaftsverständnis der empirischen Erziehungstheorie und dessen Grenzen. Die Kapitel diskutiert das Problem der Komplexität und des Reduktionismus, das Induktionsproblem, die Praxisrelevanz des Falsifikationsprinzips, die Methoden der quantitativen Sozialforschung und das Postulat der Wertfreiheit in der pädagogischen Wirklichkeit.
Schlüsselwörter
Kritisch-rationale Erziehungswissenschaft, Empirisch-analytische Erziehungswissenschaft, Pädagogische Praxis, Theorie-Praxis-Verhältnis, Falsifikationsprinzip, Quantitative Sozialforschung, Wissenschaftsverständnis, Methodologie, Wertfreiheit, Komplexität, Reduktionismus.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Relevanz der empirisch-analytischen Erziehungswissenschaft in der pädagogischen Praxis
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Relevanz der kritisch-rationalen bzw. empirisch-analytischen Erziehungswissenschaft für die pädagogische Praxis. Sie analysiert die erkenntnistheoretischen Grundlagen dieses Ansatzes und hinterfragt dessen Anwendbarkeit im komplexen Kontext der Erziehung. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Theorie und Praxis.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: erkenntnistheoretische Grundlagen des kritischen Rationalismus in der Erziehungswissenschaft, Methodologie der empirisch-analytischen Forschung in der Pädagogik, das Verhältnis von Theorie und Praxis im Kontext der empirischen Erziehungswissenschaft, Kritik am technologischen Wissenschaftsverständnis in der Erziehung und die Bedeutung des Falsifikationsprinzips für die pädagogische Praxis.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in folgende Kapitel gegliedert: Einleitung (mit Paradigmendiskussion, Metaproblematik, Zielsetzung), Das Konzept einer kritisch-rationalen bzw. empirisch-analytischen Erziehungswissenschaft (mit erkenntnistheoretischem Modell, historischer Entwicklung, Methodologie und dem Anspruch als "technologische Wissenschaft"), Relevanz der empirisch-analytischen Erziehungstheorie in der alltäglichen pädagogischen Praxis (mit kausalanalytischem Prinzip, Kritik am technologischen Wissenschaftsverständnis, Komplexität, Reduktionismus, Induktionsproblem, Falsifikationsprinzip, quantitativen Methoden und Wertfreiheit) und Fazit.
Welche erkenntnistheoretischen Grundlagen werden betrachtet?
Die Hausarbeit basiert auf dem erkenntnistheoretischen Modell des kritischen Rationalismus und untersucht dessen Anwendung in der Erziehungswissenschaft. Es wird die historische Entwicklung der empirisch-analytischen Konzeption und deren Methodologie erläutert.
Wie wird das Verhältnis von Theorie und Praxis behandelt?
Die Hausarbeit analysiert kritisch das Verhältnis von Theorie und Praxis im Kontext der empirischen Erziehungswissenschaft. Ein besonderer Fokus liegt auf der Kritik am technologischen Wissenschaftsverständnis und der Frage, ob Theorie ohne Praxis bestehen kann. Die Herausforderungen durch Komplexität und Reduktionismus sowie die Relevanz des Falsifikationsprinzips werden diskutiert.
Welche Methoden werden in der Hausarbeit thematisiert?
Die Hausarbeit thematisiert die Methoden der quantitativen Sozialforschung und deren Anwendbarkeit in der pädagogischen Praxis. Die Diskussion umfasst auch das Postulat der Wertfreiheit in der pädagogischen Wirklichkeit.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Hausarbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Kritisch-rationale Erziehungswissenschaft, Empirisch-analytische Erziehungswissenschaft, Pädagogische Praxis, Theorie-Praxis-Verhältnis, Falsifikationsprinzip, Quantitative Sozialforschung, Wissenschaftsverständnis, Methodologie, Wertfreiheit, Komplexität und Reduktionismus.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Hausarbeit?
Die Schlussfolgerungen der Hausarbeit werden im Fazit zusammengefasst. Die Arbeit evaluiert den Ertrag und die Leistungsfähigkeit der empirisch-analytischen Erziehungswissenschaft im Hinblick auf die pädagogische Praxis und hinterfragt kritisch die Anwendbarkeit des kritisch-rationalen Ansatzes im komplexen Kontext der Erziehung.
- Quote paper
- Andrea Elisabeth Schildgen (Author), 2006, Die Relevanz der empirisch-analytischen bzw. kritisch-rationalen Erziehungswissenschaft in der alltäglichen pädagogischen Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/56109