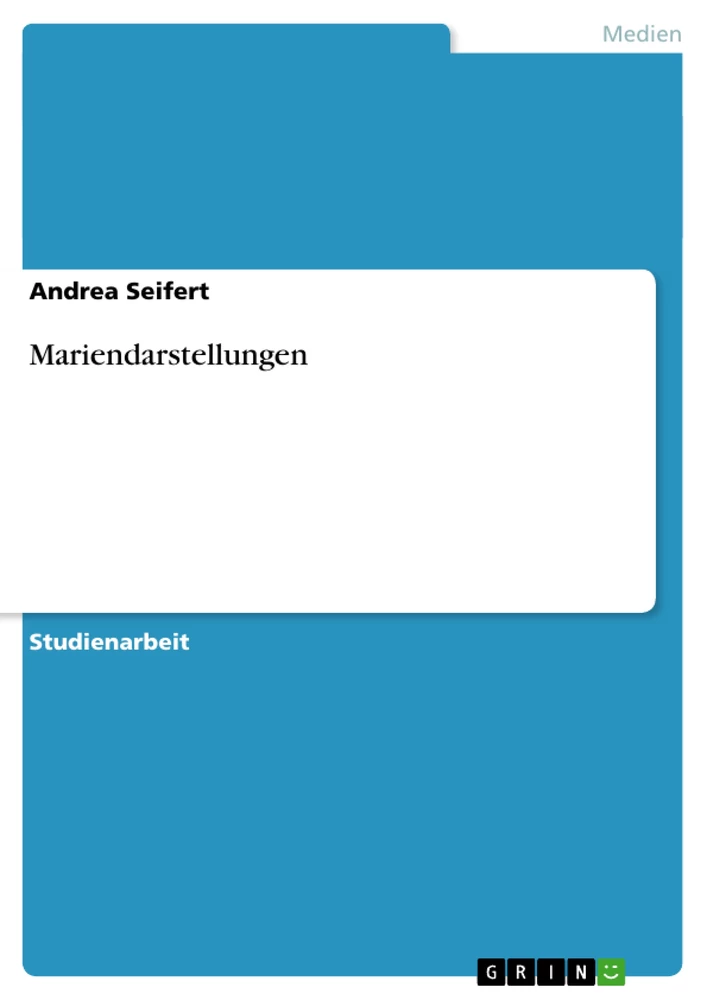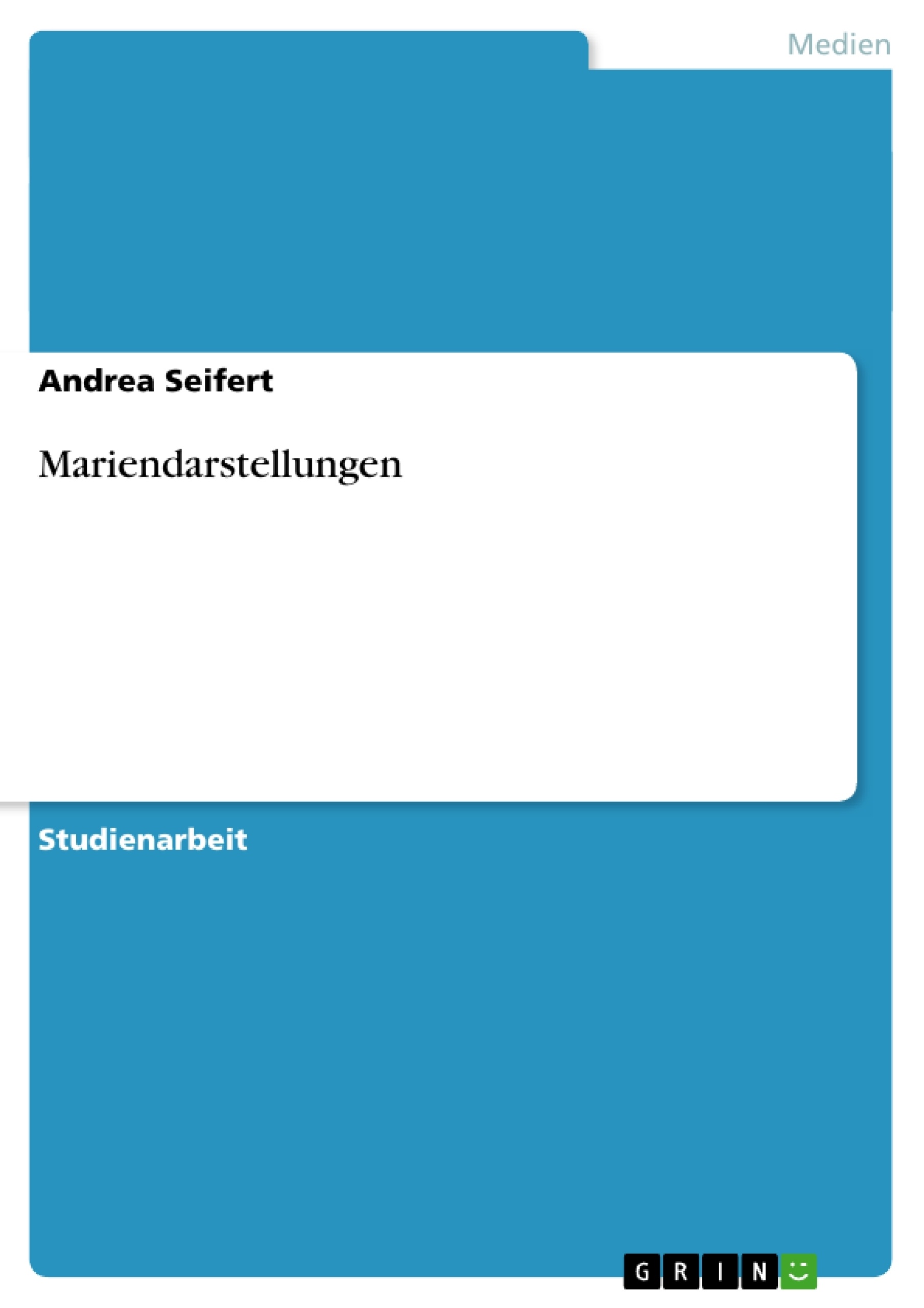Maria gilt als Vorbild des Glaubens und als "Mutter" der katholischen Kirche. Mit Ihrem Ja zu Gott hat sie Gott in sich Raum gewährt, hat ihn in sich wachsen lassen, hat sich von ihm einnehmen lassen. Gleichzeitig hat sie Gott ein menschliches Gesicht gegeben, hat ihn unter Menschen erfahrbar und erlebbar gemacht und damit den Mitmenschen geholfen, ihrerseits befreit und erlöst und damit richtig Mensch zu werden.
Inhaltsverzeichnis
- Maria gilt als Vorbild des Glaubens und als "Mutter" der katholischen Kirche
- Begriff „Maria“, „Madonna“, Mutter Jesu Christi“, „Gottesmutter“
- Dogmatische Aussagen der katholischen Kirche über Maria, die im Laufe der Kirchengeschichte formuliert wurden, sind:
- Maria ist wahre Gottesmutter;
- sie hat Jesus jungfräulich durch den Heiligen Geist empfangen;
- sie ist auch bei und nach der Geburt Jungfrau geblieben;
- Maria blieb in ihrem Leben ohne Sünde;
- auch sie selbst wurde empfangen, ohne in die Erbsünde verstrickt zu sein;
- sie ist mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden.
- Die Heimat Marias war die ca. 40 km von Haifa entfernte Stadt Nazareth
- 2Auszüge aus der Bibel:
- Matthäus, 1.18
- Lukas, 1.34
- 3Beim Ökumenischen Konzil von Ephesus wurde Maria 431 n. Chr. feierlich zur Theotokos, "Gottesgebärerin", erklärt und 649 bei der Lateransynode als Aei Parthenos, "immerwährende Jungfrau".
- In der religiösen Kunst des Ostens und Westens wird Maria nach Jesus am häufigsten wiedergegeben, meist gemeinsam mit dem Jesuskind.
- Göttin Isis mit dem Horusknaben, altägyptische Göttin der Natur, Beschützerin der Liebe, Ehe und Geburt, Schwestergemahlin des Osiris und Mutter des Horus.
- Das Mutter-Kind-Sujet soll als Vorbild für Darstellungen Marias mit dem Jesuskind gedient haben.
- Die Ägyptische Kunst ist eine der ältesten Kunstkulturen der Menschheit im Gebiet des Nils.
- Frühe Marienbilder stammen bereits aus dem 2. Jahrhundert.
- In der Ostkirche setzte die Verehrung Marias durch Marienbilder eher ein als im Westen.
- Oft werden Marienbilder als „Ikonen“ bezeichnet.
- Ikonen haben in der Darstellung gemeinsame Züge, die von westeuropäischen Kunstvorstellungen abweichen und die oft theologisch begründet sind.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Belegarbeit analysiert und interpretiert Marienbilder mit dem Jesuskind. Sie befasst sich mit dem Ursprung des Motivs, der Entwicklung der Marienbildtradition in Ost und West, sowie der theologischen Bedeutung und künstlerischen Besonderheiten von Ikonen.
- Entstehung und Entwicklung des Motivs der Maria mit dem Jesuskind
- Vergleich der Marienbildtradition in der Ostkirche und der Westkirche
- Theologische Bedeutung und Symbolismus von Marienbildern
- Künstlerische Besonderheiten und Merkmale von Ikonen
- Die Rolle der Marienbilder in der christlichen Kunst und Verehrung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Der Text stellt Maria als Vorbild des Glaubens und als "Mutter" der katholischen Kirche vor. Er beleuchtet die unterschiedlichen Bezeichnungen für Maria und erläutert die dogmatischen Aussagen der katholischen Kirche über sie.
- Kapitel 2: Der Text beleuchtet Marias Heimatstadt Nazareth und beschreibt die Verkündigung der Geburt Jesu durch den Erzengel Gabriel. Zwei Auszüge aus der Bibel, Matthäus 1,18 und Lukas 1,34, erzählen von Jesu Geburt und der Ankündigung seiner Geburt.
- Kapitel 3: Der Text beschreibt die Heiligsprechung Marias als "Gottesgebärerin" und "immerwährende Jungfrau" sowie den Anstieg ihrer Verehrung in der Kirchengeschichte. Er erklärt, warum es von Maria keine Reliquien gibt und warum Bildnisse von Bedeutung sind.
- Kapitel 4: Der Text betrachtet das altägyptische Motiv "Isis mit dem Horusknaben" als mögliches Vorbild für Mutter-Kind-Darstellungen in der christlichen Kunst. Er erklärt die Bedeutung von Isis als Göttin und die Bedeutung des Motivs in der ägyptischen Kunst.
- Kapitel 5: Der Text beschreibt die Entstehung der ersten Marienbilder im 2. Jahrhundert und den Anstieg ihrer Zahl nach der Dogmatisierung Marias als Gottesmutter. Er erläutert die Unterschiede in der Bildsprache von byzantinischen Madonnen und russischen Ikonen im Vergleich zu westeuropäischen Marienbildern.
- Kapitel 6: Der Text beleuchtet die Bedeutung von Marienbildern in der Ostkirche und erklärt die spezifischen Eigenschaften von Ikonen. Er beschreibt die Unterschiede in der Gestaltung von Ikonen im Vergleich zu westeuropäischen Bildern und erklärt die besondere Symbolsprache und die Bedeutung von Schriftrollen und Texten in den Ikonen.
Schlüsselwörter
Die Belegarbeit befasst sich mit den Themen Maria, Madonna, Gottesmutter, Marienbild, Ikone, Theotokos, Aei Parthenos, byzantinische Kunst, westeuropäische Kunst, christliche Kunst, Symbolismus, Theologie, Kunstgeschichte, Bildinterpretation, Ikonenmalerei.
- Quote paper
- Andrea Seifert (Author), 2006, Mariendarstellungen , Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/55504