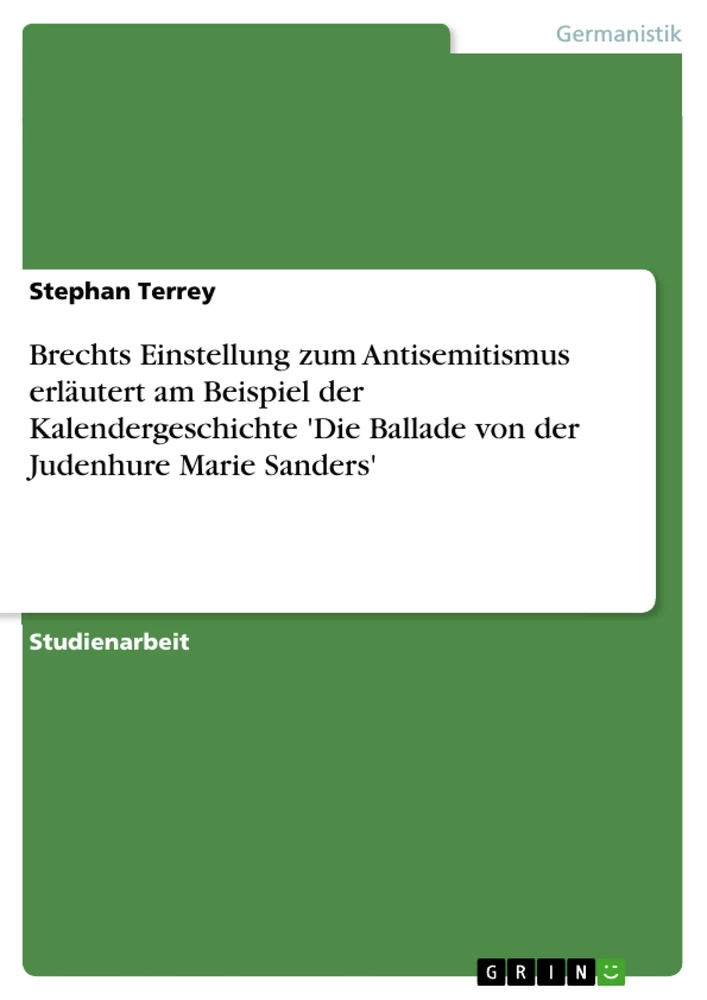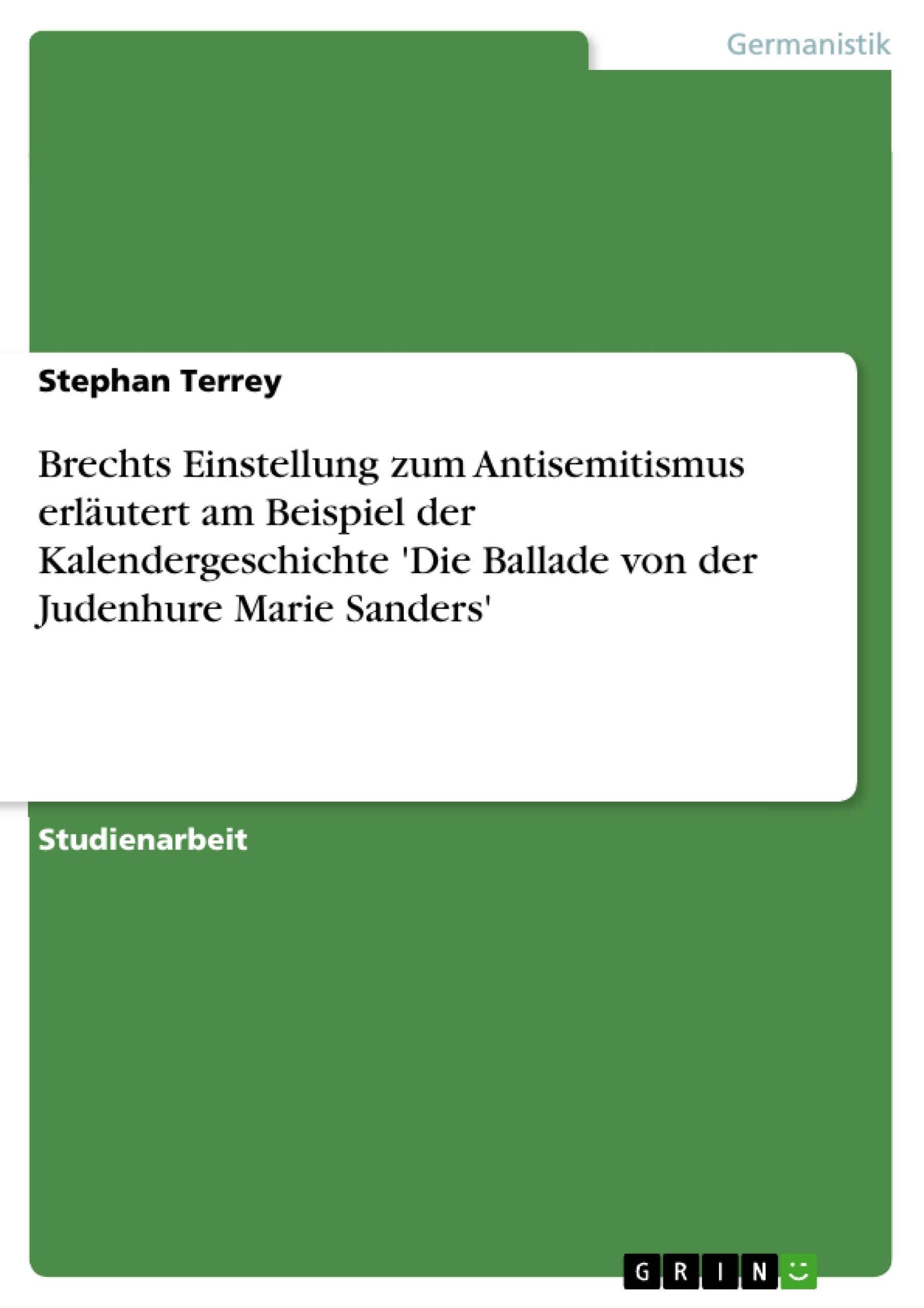Eine kurze volkstümliche, meist realitätsbezogene Erzählung, oft unterhaltend und stets didaktisch orientiert. Diese knappe Definition einer literarischen Gebrauchsform soll der Einstieg für die Untersuchung einer Kalendergeschichte sein.
Die folgende Arbeit hat sich zur Aufgabe gemacht diese literarische Gebrauchsform näher zu beleuchten, die Kalendergeschichte. Speziell setzt sich die Analyse mit einer Kalendergeschichte Bertolt Brechts auseinander.
Anfangs erfolgt eine kurze biographische Angabe zum Autor. Anschließend werden die Besonderheiten der Kalendergeschichte bei Brecht dargelegt. Des Weiteren wird die Entstehungszeit des Textes in den historischen Kontext eingeordnet. Auf diese Weise wird dem Rezipienten Hintergrundwissen vermittelt, wodurch das Textverständnis vereinfacht werden soll. Im Anschluss wird auf den Inhalt der Ballade eingegangen, was den Leser auf den weiteren Verlauf einstimmt. Der Titel „Ballade von der ‘Judenhure’ Marie Sanders“ verweist auf weitere Themenschwerpunkte der Betrachtung. Demzufolge soll mit Hilfe dieser Arbeit die Einstellung Brechts zum Antisemitismus erläutert sowie die Appell- und Erziehungsfunktion des Textes transparent gemacht werden. Dieser von Judengegner geschaffene Begriff, der Diskriminierung und Verfolgung von Juden als Gruppe begründen und legitimieren soll, stütz sich historisch auf rassistische Vorurteile. Damit wird ein religiös, völkisch oder nationalistisch bedingter Judenhass untermauert.
In diesem Zusammenhang fließen bei der Betrachtung der Problematik weitere Werke Brechts ein, umso die Thematik abwechslungsreicher und anschaulicher werden zu lassen. Sie thematisieren ebenfalls Antisemitismus und Fremdenhass und bekräftigen das Bild Brechts vom Antisemitismus.
Ein nächster Hauptpunkt analysiert den Text auf der Grundlage des Buches: „Einführung in die Erzähltheorie“ nach Martinez/Scheffel. Besondere Aufmerksamkeit wird hier auf das „Wie“ des Textes gerichtet. Daher werden die Stimme, die Zeit und das Modus untersucht. Als Grundlage für diese wissenschaftliche Arbeit diente eine fundierte Lektüre, bestehend aus Primär- und Sekundärliteratur. Hier zu besonders zu erwähnen sind, Frank Dietrich Wagner:Bertolt Brecht. Kritik des Faschismus;Werner Hecht:Bertolt Brecht. Arbeitsjournal 1938-1955;sowie Jan Knopf:Brecht-Handbuch. Lyrik, Prosa, Schriften.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Person Brecht
- Brechts Kalendergeschichten
- Historischer Kontext
- Analyse der Ballade
- Analyse des „Wie“ nach Martinez/Scheffel
- Didaktisches der Ballade/ intendierter Adressat
- Identität des Erzählers
- Titel und Volkstümlichkeit des Gedichtes
- Brecht und Antisemitismus
- Fazit/Schlussfolgerung
- Quellen und Literatur
- Quellen
- Literatur (Auswahlbiographie)
- Anhang
- Die Ballade der Judenhure Marie Sanders
- Die Medea von Lodz
- Der Jude, ein Unglück für das Volk
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Bertolt Brechts Kalendergeschichte „Die Ballade von der Judenhure Marie Sanders“ und untersucht die literarische Gebrauchsform der Kalendergeschichte. Ziel ist es, Brechts Einstellung zum Antisemitismus zu beleuchten und die Appell- und Erziehungsfunktion des Textes herauszuarbeiten.
- Analyse der Kalendergeschichte als literarische Gebrauchsform
- Biographie und Werk Bertolt Brechts
- Historischer Kontext der Entstehung des Textes
- Die Rolle des Antisemitismus im Werk Brechts
- Erziehungsfunktion und Appellcharakter der Ballade
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Kalendergeschichte als literarische Gebrauchsform vor. Die Analyse der Ballade „Die Ballade von der Judenhure Marie Sanders“ soll Brechts Einstellung zum Antisemitismus erhellen und die didaktische Funktion des Textes aufzeigen.
- Kapitel 2 gibt einen kurzen Überblick über das Leben und Werk Bertolt Brechts. Es werden seine Kalendergeschichten im Allgemeinen und die spezifischen Merkmale dieser Gattung bei Brecht beschrieben.
- Kapitel 3 ordnet die Entstehung der Ballade in den historischen Kontext ein und beleuchtet die Situation des Antisemitismus in der Zeit Brechts.
- Kapitel 4 analysiert die Ballade selbst. Es wird die narrative Struktur des Textes nach Martinez/Scheffel untersucht und die didaktische Funktion des Textes, sowie der intendierte Adressat betrachtet. Außerdem wird die Identität des Erzählers und die Bedeutung des Titels beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kalendergeschichte, Bertolt Brecht, Antisemitismus, Judengegner, Diskriminierung, Verfolgung, Fremdenhass, Ballade, Erzähltheorie, Martinez/Scheffel, Didaktik, Appellfunktion, Erziehungsfunktion.
- Quote paper
- Stephan Terrey (Author), 2005, Brechts Einstellung zum Antisemitismus erläutert am Beispiel der Kalendergeschichte 'Die Ballade von der Judenhure Marie Sanders', Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/55475