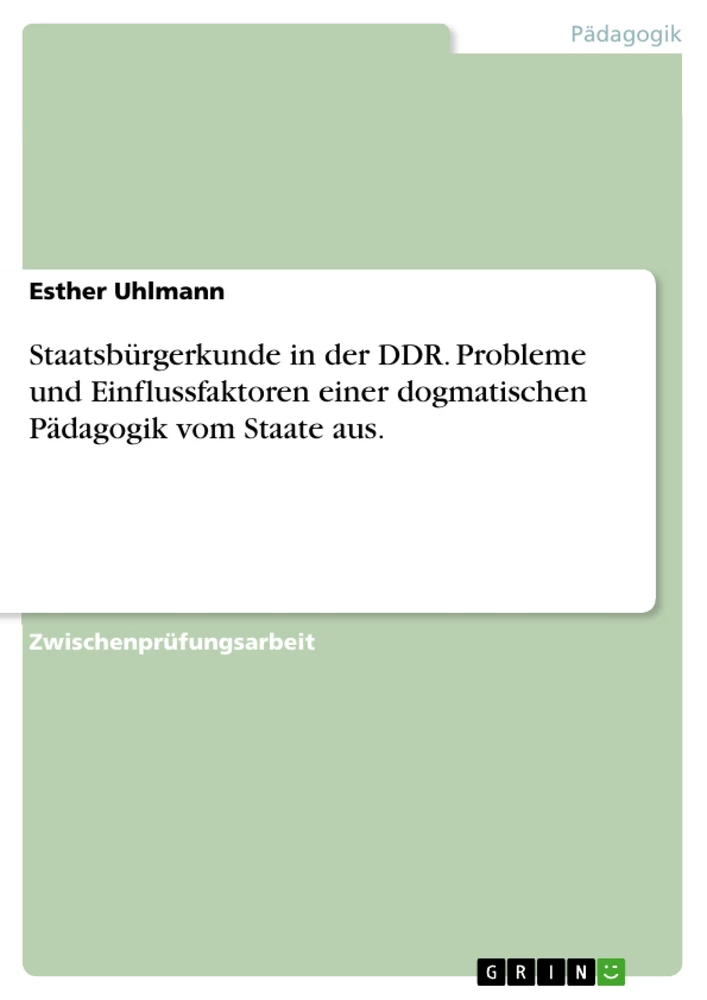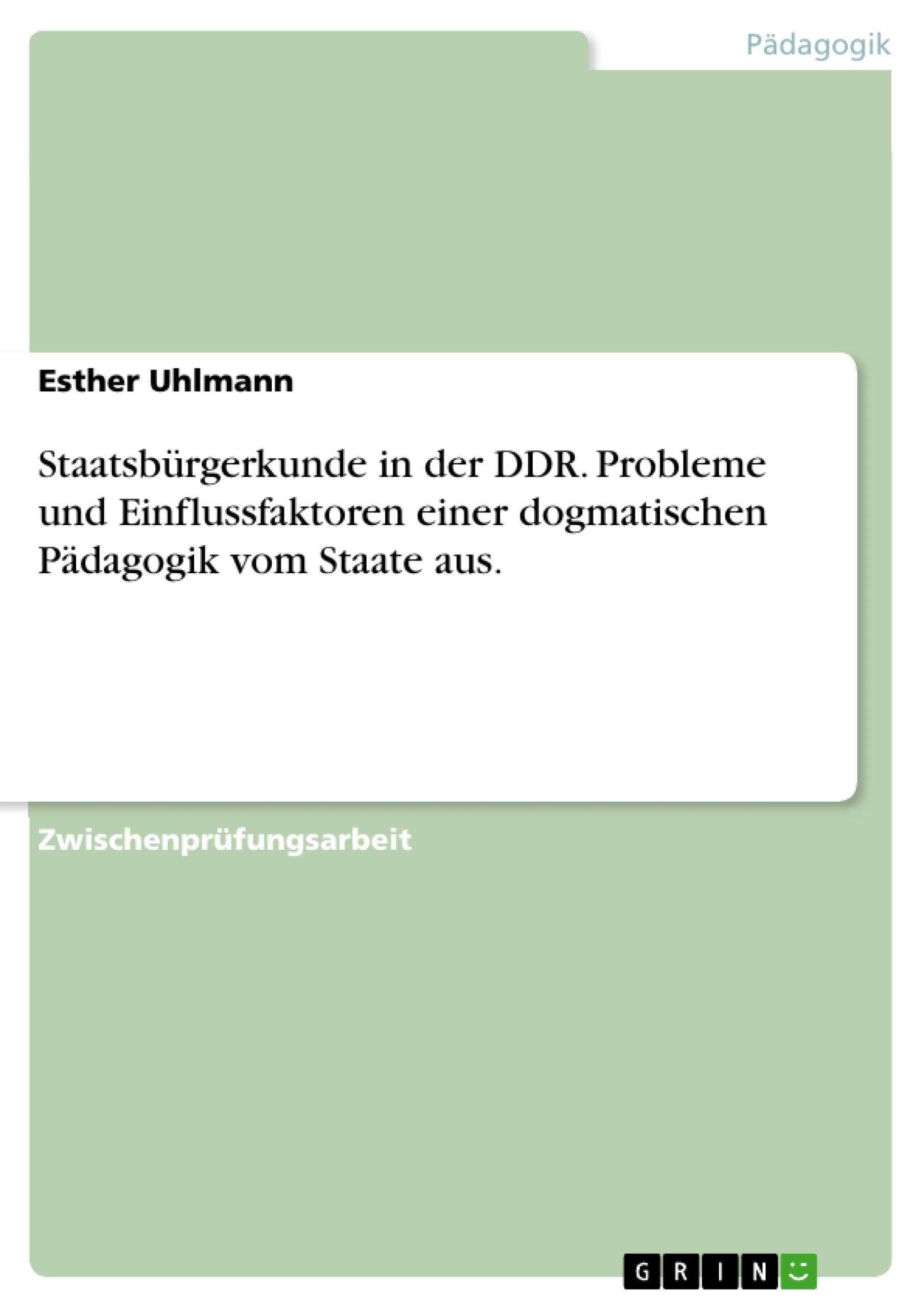Als sich Ende der 80iger Jahre durch die Reformbewegung in der UdSSR der Ost-West-Konflikt, als ein Konflikt zweier sich grundlegend unterscheidender Herrschaftssysteme, und auch der Kalte Krieg, der seit dem Zerbrechen der Anti- Hitler-Koalition das Weltgeschehen maßgeblich beeinflusste, dem Ende neigten, ging auch ein Kapitel deutscher Geschichte zu Ende. Dieses Kapitel war geprägt durch die Teilung Deutschlands und die damit verbundene Einbindung der neu entstandenen Staaten in den jeweiligen Machtbereich der Supermächte USA und UdSSR. Während 1949 im Westteil Deutschlands ein Staat mit westlich-demokratischen Prinzipien ausgerufen wurde, die Bundesrepublik Deutschland, entstand im Ostteil der „erste Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden“, die Deutsche Demokratische Republik. Sie wurde nach sowjetischem Muster auf den Prinzipien des Marxismus-Leninismus bzw. des Sozialismus aufgebaut.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Abriss der Entwicklung des Bildungssystems der DDR
- Antifaschistisch-demokratische Schulreform - Neuordnung ab 1945
- Aufbau der sozialistischen Schule
- Allgemeinbildung und Polytechnisierung
- Das einheitliche sozialistische Bildungssystem
- Ideologische Erziehung und Staatsbürgerkunde
- Das Ideal der „allseitig entwickelten sozialistischen Persönlichkeit“
- Ziele und Aufgaben des Staatsbürgerkundeunterrichts
- Lehrplan und Lehrplanvorgaben
- Begriffsbestimmung „Lehrplan“
- Inhaltsvorgaben für das Fach Staatsbürgerkunde
- Staatsbürgerkunde und Religion
- Die Rolle des Staatsbürgerkundelehrers
- Ansprüche an die Persönlichkeit des Lehrers
- Didaktisch-methodische Umsetzung des Lehrplanes
- Vorgaben
- Probleme
- Die Realität - Vergleich der Theorie und den Vorgaben des Staates mit der tatsächlichen Umsetzung im alltäglichen Schulbetrieb
- Pädagogik der DDR - Staatspädagogik einer Diktatur
- Zugänge
- Lehrerrolle und Lehrersein
- Schülerrolle, Schülersein und die Rolle der familialen Sozialisation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Fach Staatsbürgerkunde in der DDR als Instrument staatlicher, politisch-ideologischer Erziehung und Bildung. Sie analysiert die Entwicklung des DDR-Bildungssystems im Kontext des Kalten Krieges und der marxistisch-leninistischen Ideologie. Die Arbeit beleuchtet die Rolle des Lehrers, die Umsetzung staatlicher Vorgaben im Schulalltag und die Herausforderungen bei der Vermittlung der Ideologie.
- Entwicklung des DDR-Bildungssystems
- Staatsbürgerkunde als Instrument der Ideologievermittlung
- Rolle des Lehrers im System der staatlichen Erziehung
- Vergleich von Theorie und Praxis im Staatsbürgerkundeunterricht
- Grenzen des staatlichen Einflusses auf die Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit, indem sie den Zusammenbruch des Ost-West-Konflikts und das Ende der DDR als Hintergrund für die Untersuchung des staatlichen Erziehungssystems darstellt. Sie hebt die Rolle der Schule als staatliche Instanz der Erziehung hervor und führt in das Thema Staatsbürgerkunde als ein Werkzeug der ideologischen Einflussnahme ein. Die Arbeit kündigt den Aufbau an, beginnend mit der Entwicklung des Bildungssystems, der Darstellung der staatlichen Vorgaben und des Vergleichs zwischen Theorie und Praxis.
Abriss der Entwicklung des Bildungssystems der DDR: Dieses Kapitel skizziert die Entwicklung des DDR-Bildungssystems, beginnend mit der antifaschistisch-demokratischen Schulreform nach dem Zweiten Weltkrieg. Es beschreibt die zunehmende Einflussnahme der KPD/SED auf das Bildungssystem und die Herausbildung eines einheitlichen, sozialistischen Bildungssystems. Der Fokus liegt auf der Schulpolitik bis 1965, um den Kontext für die spätere Betrachtung des Staatsbürgerkundeunterrichts zu schaffen. Die Kapitel beschreibt die Entwicklung von der antifaschistisch-demokratischen Schulreform bis hin zum einheitlichen sozialistischen Bildungssystem, wobei die zunehmende politische Einflussnahme der SED und die Herausbildung eines Systems der staatlichen Kontrolle der Erziehung deutlich werden.
Ideologische Erziehung und Staatsbürgerkunde: Dieses Kapitel befasst sich mit der ideologischen Ausrichtung der Erziehung in der DDR und der Rolle des Faches Staatsbürgerkunde. Es beschreibt das Ideal der „allseitig entwickelten sozialistischen Persönlichkeit“ und die Ziele des Staatsbürgerkundeunterrichts. Der Lehrplan und seine Vorgaben werden analysiert, ebenso wie der Umgang mit Religion im Unterricht. Das Kapitel betont die enge Verknüpfung von Bildung und Ideologie und die Einbindung des Faches Staatsbürgerkunde in die Gesamtstrategie der staatlichen Erziehung.
Die Rolle des Staatsbürgerkundelehrers: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Anforderungen an die Persönlichkeit des Staatsbürgerkundelehrers und die didaktisch-methodische Umsetzung des Lehrplans. Es werden sowohl die Vorgaben des Staates als auch die Probleme bei deren Umsetzung im Unterricht beleuchtet. Das Kapitel zeigt die besondere Verantwortung und den enormen Druck, der auf den Lehrern lastete, um die ideologischen Ziele des Staates zu erreichen. Die Diskrepanz zwischen den hohen Anforderungen und den praktischen Möglichkeiten der Umsetzung im Schulalltag wird hervorgehoben.
Die Realität - Vergleich der Theorie und den Vorgaben des Staates mit der tatsächlichen Umsetzung im alltäglichen Schulbetrieb: Dieses Kapitel vergleicht die Theorie der staatlichen Erziehung mit der tatsächlichen Umsetzung im Schulalltag. Es analysiert die Pädagogik der DDR als Staatspädagogik einer Diktatur und beleuchtet verschiedene Zugänge zum Thema, darunter die Lehrerrolle und die Rolle der Schüler und ihrer familiären Sozialisation. Der Vergleich offenbart die Widersprüche zwischen den offiziellen Zielen und der Realität im Unterricht und verdeutlicht die Grenzen der staatlichen Einflussnahme auf die Pädagogik.
Schlüsselwörter
Staatsbürgerkunde, DDR, Bildungssystem, Ideologie, sozialistische Erziehung, Lehrplan, Lehrerrolle, Schülerrolle, Staatspädagogik, Diktatur, politische Bildung, Marxismus-Leninismus, SED.
Häufig gestellte Fragen zum Thema "Staatsbürgerkunde in der DDR"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Fach Staatsbürgerkunde in der DDR als Instrument staatlicher, politisch-ideologischer Erziehung und Bildung. Sie analysiert die Entwicklung des DDR-Bildungssystems im Kontext des Kalten Krieges und der marxistisch-leninistischen Ideologie. Die Arbeit beleuchtet die Rolle des Lehrers, die Umsetzung staatlicher Vorgaben im Schulalltag und die Herausforderungen bei der Vermittlung der Ideologie. Der Text beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Abriss der Entwicklung des Bildungssystems der DDR, Ideologische Erziehung und Staatsbürgerkunde, Die Rolle des Staatsbürgerkundelehrers, und Die Realität - Vergleich der Theorie und den Vorgaben des Staates mit der tatsächlichen Umsetzung im alltäglichen Schulbetrieb.
Wie beschreibt die Arbeit die Entwicklung des DDR-Bildungssystems?
Das Kapitel zum DDR-Bildungssystem skizziert dessen Entwicklung von der antifaschistisch-demokratischen Schulreform nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum einheitlichen sozialistischen Bildungssystem. Es beschreibt die zunehmende Einflussnahme der KPD/SED und die Herausbildung eines Systems der staatlichen Kontrolle der Erziehung. Der Fokus liegt auf der Schulpolitik bis 1965.
Welche Rolle spielte Staatsbürgerkunde in der DDR?
Staatsbürgerkunde wird als Instrument der Ideologievermittlung dargestellt. Die Arbeit analysiert das Ideal der „allseitig entwickelten sozialistischen Persönlichkeit“ und die Ziele des Staatsbürgerkundeunterrichts. Die enge Verknüpfung von Bildung und Ideologie und die Einbindung des Faches in die Gesamtstrategie der staatlichen Erziehung werden hervorgehoben.
Welche Anforderungen wurden an Staatsbürgerkundelehrer gestellt?
Die Arbeit beleuchtet die Anforderungen an die Persönlichkeit des Staatsbürgerkundelehrers und die didaktisch-methodische Umsetzung des Lehrplans. Sowohl die Vorgaben des Staates als auch die Probleme bei deren Umsetzung im Unterricht werden beschrieben. Die besondere Verantwortung und der Druck auf die Lehrer zur Erreichung der ideologischen Ziele des Staates werden hervorgehoben.
Wie wurde die Theorie in der Praxis umgesetzt?
Das Kapitel zum Vergleich von Theorie und Praxis analysiert die Pädagogik der DDR als Staatspädagogik einer Diktatur. Es beleuchtet die Lehrerrolle, die Rolle der Schüler und ihrer familiären Sozialisation. Der Vergleich offenbart Widersprüche zwischen den offiziellen Zielen und der Realität im Unterricht und verdeutlicht die Grenzen des staatlichen Einflusses auf die Pädagogik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Staatsbürgerkunde, DDR, Bildungssystem, Ideologie, sozialistische Erziehung, Lehrplan, Lehrerrolle, Schülerrolle, Staatspädagogik, Diktatur, politische Bildung, Marxismus-Leninismus, SED.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht Staatsbürgerkunde als Instrument staatlicher, politisch-ideologischer Erziehung und Bildung in der DDR. Sie analysiert die Entwicklung des Bildungssystems, die Rolle des Lehrers, die Umsetzung staatlicher Vorgaben und den Vergleich zwischen Theorie und Praxis. Die Grenzen des staatlichen Einflusses auf die Pädagogik werden ebenfalls beleuchtet.
- Arbeit zitieren
- Esther Uhlmann (Autor:in), 2001, Staatsbürgerkunde in der DDR. Probleme und Einflussfaktoren einer dogmatischen Pädagogik vom Staate aus., München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/54859