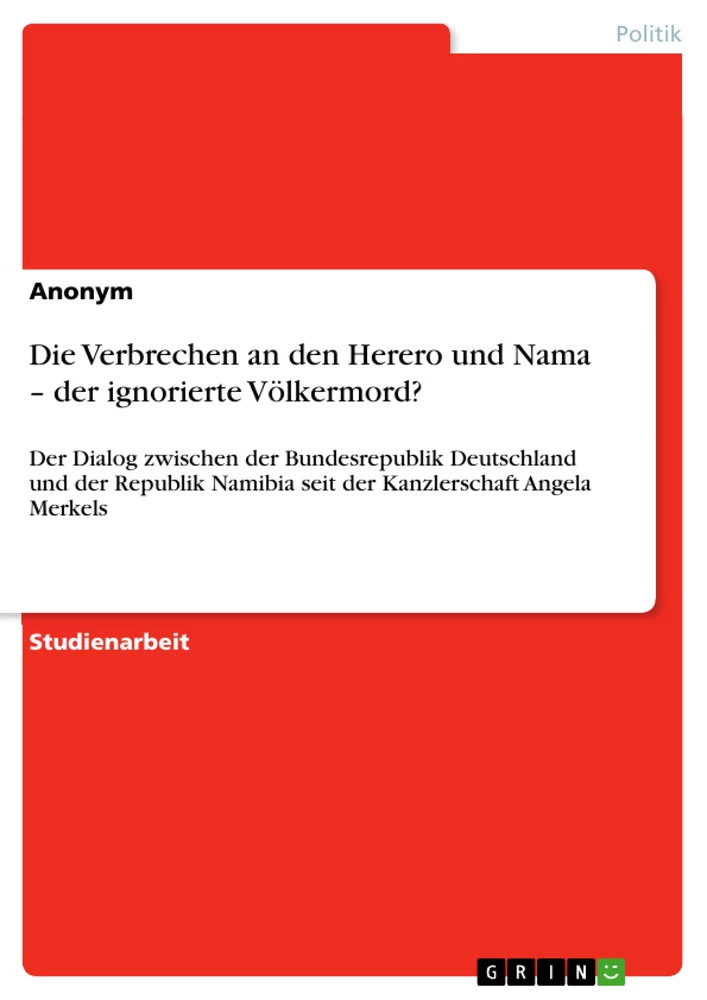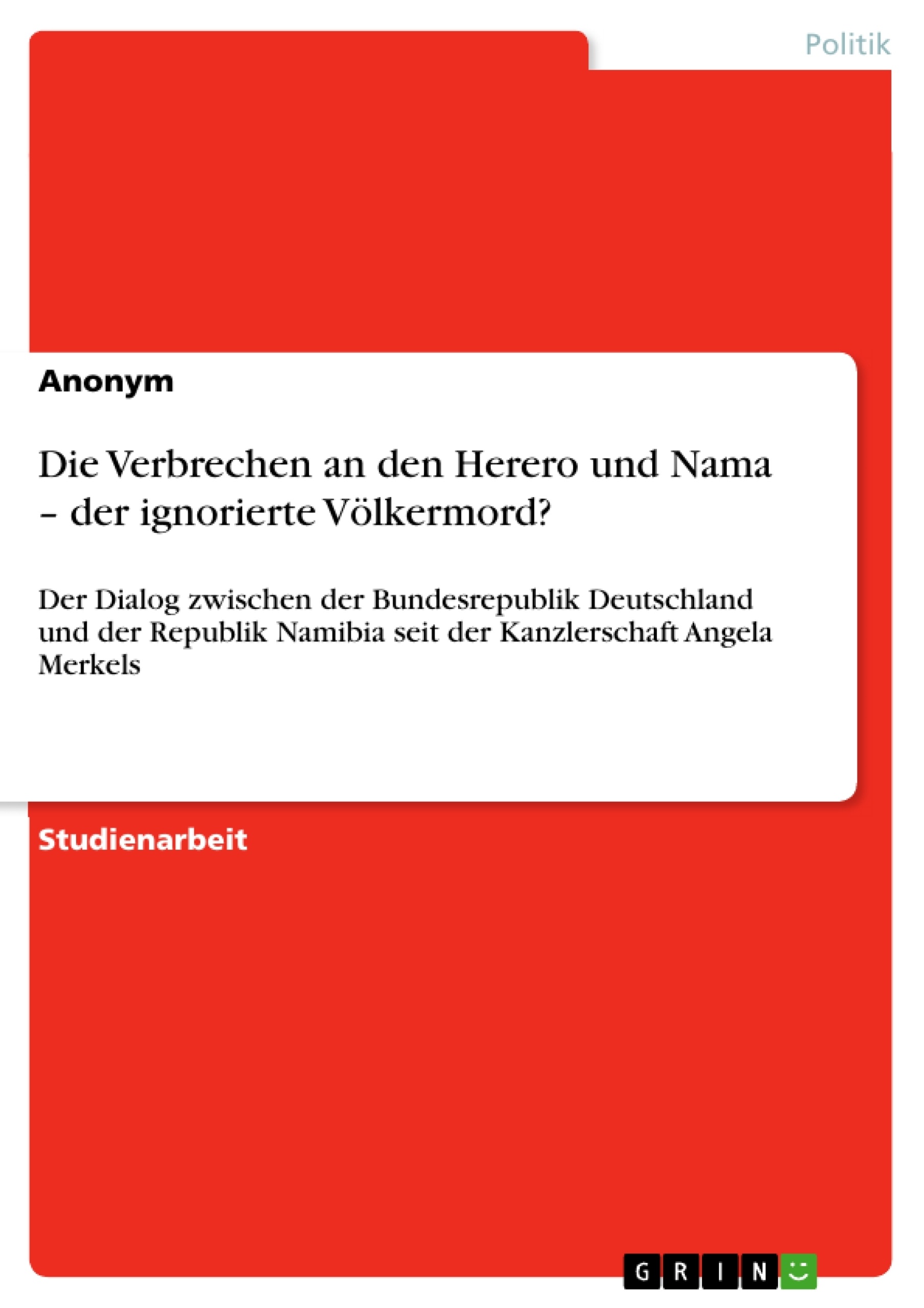Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Namibia befinden sich seit Jahrzehnten in stockenden Verhandlungen über die gemeinsame koloniale Vergangenheit. Inhalt der Debatte bilden dabei vor allem die von den Stämmen der Herero und Nama geforderten Entschädigungsansprüche an die Bundesrepublik, die sich unter anderem auf den durch das damalige deutsche Kaiserreich von 1904 bis 1908 begangenen Völkermord an den Herero und Nama, stützen.
In der vorliegenden Arbeit soll der laufende Dialog zwischen den beiden Regierungen aus geschichtspolitischer Perspektive dargelegt und analysiert werden. Der Fokus wird dabei auf die Phase der Verhandlungen seit der Kanzlerschaft Angela Merkels gelegt. Eine zeitliche Begrenzung ist dabei notwendig, um eine Kernphase des langwidrigen Prozesses betrachten zu können. Die Debatte hat in den letzten Jahren immer mehr an internationaler Aufmerksamkeit erlangt, nicht nur aufgrund neuer Faktoren, wie der Migrationsfrage aus Afrika Richtung Europa. In dieser Arbeit sollen besonders die deutsche Perspektive sowie die politische Handlungsbereitschaft innerhalb des Dialogs betrachtet werden. Hierzu werden die Positionen der Parteien im Bundestag erläutert und besondere Wendepunkte des Diskurses dargestellt. Es soll geklärt werden, ob der Völkermord an den Herero und Nama von deutscher Regierungsseite ignoriert wird und wo andere Konfliktpunkte in der jahrzehntelangen Debatte liegen. Ob das Handeln der deutschen Politik in der Namibiafrage mehr Inhalte der Verdrängung oder Versöhnung hervorbringt, soll an der Frage des Umgangs mit dem Genozid, erläutert werden.
Die postkoloniale Debatte zwischen Deutschland und Namibia erfährt in den letzten Jahren vermehrt Interesse von Seiten der deutschen Hochschulen und deren Forschung. Die Inhalte der Debatte erstrecken sich insbesondere über entwicklungs- und wirtschafts-, als auch bildungspolitische Diskurse. Vor allem in Zeiten der gesellschaftlich und politisch regen Phase von neuem Rechtspopulismus in Deutschland, ist die Bedeutung der landeseigenen Erinnerungskultur, bereits aus Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg, daher von unabdingbarer Relevanz.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Deutsch-Südwestafrika: Die deutsche Kolonialzeit
- Der Völkermord: Herero und Nama
- Die postkoloniale Debatte
- Historischer Rückblick der Debatte
- Die Debatte seit der Kanzlerschaft Angela Merkels
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den deutsch-namibischen Dialog über die koloniale Vergangenheit, insbesondere die seit der Kanzlerschaft Angela Merkels geführten Verhandlungen über Entschädigungsansprüche der Herero und Nama. Der Fokus liegt auf der deutschen Perspektive und der politischen Handlungsbereitschaft im Umgang mit dem Völkermord.
- Der deutsch-namibische Dialog über die koloniale Vergangenheit
- Die deutschen Kolonialhandlungen in Deutsch-Südwestafrika
- Der Völkermord an den Herero und Nama
- Die postkoloniale Debatte und die Rolle Deutschlands
- Die deutsche Erinnerungskultur und der Umgang mit dem Genozid
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den stockenden Dialog zwischen Deutschland und Namibia über die gemeinsame koloniale Vergangenheit und die Entschädigungsansprüche der Herero und Nama. Sie erläutert die Zielsetzung der Arbeit, den Fokus auf die Verhandlungen seit Angela Merkels Kanzlerschaft und die Betrachtung der deutschen Perspektive und politischen Handlungsbereitschaft. Die zunehmende internationale Aufmerksamkeit für die Debatte wird erwähnt, sowie der Einfluss von Faktoren wie die Migrationsfrage. Die Arbeit untersucht, ob der Völkermord ignoriert wird und ob die deutsche Politik eher auf Verdrängung oder Versöhnung setzt, anhand des Umgangs mit dem Genozid.
Deutsch-Südwestafrika: Die deutsche Kolonialzeit: Dieses Kapitel beleuchtet den vergleichsweise späten Eintritt des Deutschen Reichs in die Kolonialpolitik. Es erklärt die Motive, wie die Erschließung neuer Absatzmärkte, das angebliche Problem der Überbevölkerung und das Streben nach Weltmachtstatus. Die Berliner Afrika-Konferenz von 1884/85 wird als entscheidendes Ereignis dargestellt, bei dem die Aufteilung Afrikas unter europäischen Mächten ohne die Beteiligung der afrikanischen Bevölkerung erfolgte. Die Entstehung der Kolonie Deutsch-Südwestafrika, basierend auf den Landbesitzungen Adolf Lüderitz, wird beschrieben. Der Kapitel beschreibt die anfängliche wirtschaftliche Vormachtstellung der Herero, die durch Rinderpest, Malaria und Dürreperioden erodiert wurde, was zu betrügerischen Handelsgeschäften und dem Zugriff der deutschen Kolonialmacht auf Arbeitskräfte und Land führte. Es beschreibt die Eskalation der Situation und den Beginn des Krieges im Jahre 1904, initiiert durch den Widerstand des Herero-Häuptlings Samuel Maharero gegen die deutsche Kolonialherrschaft.
Der Völkermord: Herero und Nama: Dieses Kapitel beschreibt die Schlacht am Waterberg als Höhepunkt des Krieges und den Beginn des Völkermordes. Es erläutert, wie die Deutschen die Herero in die Omaheke-Halbwüste trieben, die Wasserstellen besetzten und einen Schießbefehl gegen flüchtende Herero erließen. Dies führte zum Tod zehntausender Herero. Das Kapitel schildert, wie die Nama, die anfangs die deutschen Truppen unterstützt hatten, nach den Ereignissen am Waterberg ihre Haltung änderten. Der Text deutet darauf hin, dass die Ereignisse nach den Angriffen der Herero nicht final geklärt sind.
Schlüsselwörter
Deutsch-namibischer Dialog, Kolonialgeschichte, Völkermord, Herero, Nama, Entschädigungsansprüche, Angela Merkel, postkoloniale Debatte, Erinnerungskultur, Genozid, deutsche Kolonialpolitik.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Deutsch-namibischer Dialog über die koloniale Vergangenheit
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text analysiert den deutsch-namibischen Dialog über die koloniale Vergangenheit, insbesondere die seit der Kanzlerschaft Angela Merkels geführten Verhandlungen über Entschädigungsansprüche der Herero und Nama. Der Fokus liegt auf der deutschen Perspektive und der politischen Handlungsbereitschaft im Umgang mit dem Völkermord an den Herero und Nama.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die deutsche Kolonialzeit in Deutsch-Südwestafrika, den Völkermord an den Herero und Nama, die postkoloniale Debatte, die Rolle Deutschlands in dieser Debatte, die deutsche Erinnerungskultur und den Umgang mit dem Genozid. Es wird der deutsch-namibische Dialog, die deutschen Kolonialhandlungen, die Verhandlungen über Entschädigungsansprüche und der Einfluss von Faktoren wie der Migrationsfrage beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die deutsche Kolonialzeit in Deutsch-Südwestafrika, ein Kapitel über den Völkermord an den Herero und Nama, ein Kapitel über die postkoloniale Debatte und ein Fazit. Die postkoloniale Debatte wird weiter unterteilt in einen historischen Rückblick und die Debatte seit Angela Merkels Kanzlerschaft.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Der Text analysiert, ob der Völkermord ignoriert wird und ob die deutsche Politik eher auf Verdrängung oder Versöhnung setzt. Er untersucht den deutsch-namibischen Dialog, die deutschen Kolonialhandlungen, den Völkermord an den Herero und Nama, die postkoloniale Debatte und die deutsche Erinnerungskultur im Umgang mit dem Genozid.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Schlüsselwörter sind: Deutsch-namibischer Dialog, Kolonialgeschichte, Völkermord, Herero, Nama, Entschädigungsansprüche, Angela Merkel, postkoloniale Debatte, Erinnerungskultur, Genozid, deutsche Kolonialpolitik.
Welche Aspekte der deutschen Kolonialzeit werden im Text hervorgehoben?
Der Text hebt den späten Eintritt des Deutschen Reichs in die Kolonialpolitik hervor, die Motive wie Absatzmärkte, Überbevölkerung und Weltmachtstreben, die Berliner Afrika-Konferenz, die Entstehung der Kolonie Deutsch-Südwestafrika, die anfängliche wirtschaftliche Stärke der Herero, deren Erosion durch Krankheit und Dürre, betrügerische Handelsgeschäfte, den Zugriff auf Arbeitskräfte und Land, die Eskalation der Situation und den Beginn des Krieges 1904.
Wie wird der Völkermord an den Herero und Nama im Text dargestellt?
Der Text beschreibt die Schlacht am Waterberg als Höhepunkt des Krieges und den Beginn des Völkermordes, das Vertreiben der Herero in die Omaheke-Halbwüste, die Besetzung der Wasserstellen, den Schießbefehl gegen flüchtende Herero und den Tod zehntausender Herero. Die anfängliche Unterstützung der Nama für die deutschen Truppen und deren späterer Wandel der Haltung wird ebenfalls geschildert. Der Text deutet darauf hin, dass die Ereignisse nach den Angriffen der Herero nicht final geklärt sind.
Welche Rolle spielt Angela Merkel in dem Text?
Der Text betrachtet die Verhandlungen über Entschädigungsansprüche der Herero und Nama seit Angela Merkels Kanzlerschaft und analysiert die deutsche Perspektive und politische Handlungsbereitschaft in dieser Zeit. Die Debatte seit ihrer Kanzlerschaft bildet einen wichtigen Teil der postkolonialen Debatte im Text.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Die Verbrechen an den Herero und Nama – der ignorierte Völkermord?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/542562